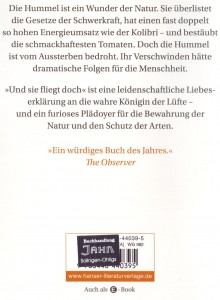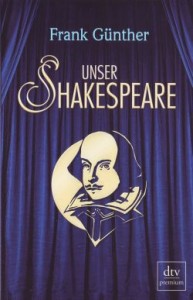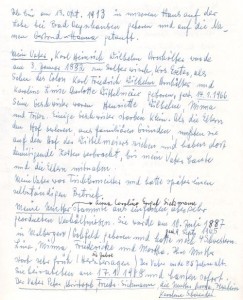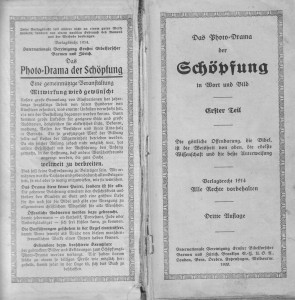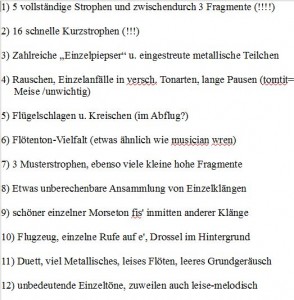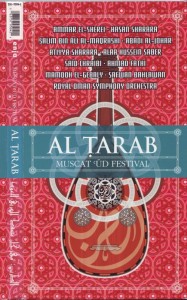(Fortsetzung der Darstellung, die HIER nachzulesen ist)
12) Denkbar wäre auch eine Methode des Hörens, die eine physische Beeinflussung des Ohres bzw. des Kopfes voraussetzt: z.B. durch Drogen. (Schumanns Versuche mit Trunkenheit: ”Wenn ich betrunken bin oder mich gebrochen habe, so war am anderen Tage die Fantasie schwebender und erhöhter. Während der Trunkenheit kann ich nichts machen, aber nach ihr.” Arnfried Edler: Robert Schumann und seine Zeit / Laaber 1982 / S. 280
Man könnte darauf hinweisen, dass ja auch das Aufsuchen bestimmter Räume, das Ritual des Sich-ruhig-stellens, in diese Richtung geht; in Köln erfreut sich das Musikangebot der Romanischen Nacht einer besonderen Beliebtheit, Gregorianik, Bach-Messen, indische Sarangi, Solowerke von Georg Kröll, Improvisationen von Markus Stockhausen, – die Leute harren aus von ½ 8 abends bis 2 Uhr morgens: es ist nicht nur die Musik, es ist der schön beleuchtete Innenraum der Romanischen Kirche St. Maria im Kapitol und es ist die Dehnung der Zeit in den frühen Morgen.
Im ungarischen Szombately habe ich einmal im abgedunkelten Saal eine phonetisch gedehnte Lesung von Finnegan’s Wake durch John Cage erlebt („Reading through Finnegan’s Wake“); ich habe sie leider nach 3 Stunden müde und uneingeweiht verlassen.
Wieder einen anderen Aspekt hätten wir in der afrikanischen Musik zu berücksichtigen, die in einem Maße bewegungs- und körperbezogen ist, dass schon der Begriff ”Methode des Hörens” unzulässig eng wirkt.
Andererseits diskutieren wir afrikanische Musik, weil ihre Strukturen bereits interessant genug sind und auch unabhängig vom Tanz als sinnvoll erlebt werden können.
***
Letztlich müssen wir wohl die physische Situation nicht ernsthaft in unsere Überlegungen einbeziehen. Wir gehen von einem ganz prosaischen Zusammenspiel der alltäglichen individuellen geistigen Kräfte aus, und nicht von Wundern, blitzartigen Erleuchtungen, Rauschzuständen, Derwisch-Drehungen, Trancetänzen u.ä. aus.
Zwar haben wir es etwa bei der Entdeckung der Obertonklänge mit einer Art Umschlagserlebnis zu tun: Sie haben vielleicht bis eben nur die Basis gehört, die etwas nervende Repetierung des Grundtones, und plötzlich tut sich Ihnen darüber eine Obertonreihe auf, eine Skala, eine Melodie. Jahrelang hat die Esoterik von diesem Phänomen zehren können. (Am Ende fehlte es nur an wirklicher Musik.)
Aber es ist etwas anderes als die Mode der dreidimensionalen Illusionsbilder, an die Sie sich vielleicht erinnern: Sie starren ein buntes Muster an und plötzlich öffnet sich die farbige Fläche und ein plastisch wirkender Drache liegt zwischen mehrschichtig angeordneten Blumenbeeten. ”Das magische Auge”!
Tom Baccei “N.E. Thing Enterprises“ / Das Magische Auge / Dreidimensionale Illusionsbilder / ars edition / München 1994
Vielleicht erinnern Sie sich auch, dass Sie dieser visuellen Phänomene überdrüssig wurden. Sie erleben keine Kunst und kein Ritual, sondern einen Effekt in einer netten Dekoration, und der Blick in ein Aquarium ist letztlich faszinierender. (Auch der reine Pointillismus in der Malerei hatte nur kurze Lebensdauer.)
Und noch ein Beispiel: das Déjà-vu-Erlebnis. Sie treten ins Sonnenlicht vor dem Bahnhof und wissen: genau dies habe ich schon einmal genau so erlebt! (Besonders gefährlich, wenn Sie Proust gelesen haben.) Kaiser Wilhelm II. hat sich angeblich durch solche scheinbar mystischen Erlebnisse bei politischen Entscheidungen beeinflussen lassen.
In Wahrheit sind es die beiden Gehirnhälften, die uns diesen Streich spielen: Die zweifache, minimal zeitversetzte Meldung ein und desselben Ereignisses wird nicht als Verdoppelung erkannt, sondern eine von beiden scheint aus der tiefsten Vergangenheit emporzusteigen.
13) Dies wäre eine Hörmethode, die wir tagtäglich anwenden und deshalb von Grund auf zu erneuern hätten: das „unbefangene“, bloße Hören, das registrierende Wahrnehmen der puren Klangereignisse und Geräusche, ob sie nun als Musik gemeint sind oder nicht.
Es soll von unserer Entscheidung oder der Suggestion eines Künstlers abhängen, ob wir die „Klangkunst“ als Kunst- oder als Klangereignis hören: John Cage hat diese Methode angeregt, Christian Wolff hat sie definiert, Murray Schafer detailliert ausgearbeitet: „Es wird kein Unterschied zwischen den Klängen des ‚Werks’ und Tönen überhaupt gemacht – Tönen, die dem Werk vorausgehen, es begleiten oder ihm folgen. Kunst – Musik – und Natur werden nicht als getrennt gedacht.“
Christian Wolff: Über Form / in: Kommentare zur Neuen Musik / Dumont Köln bzw. Wien 1955-1960 S. 166
***
Ob unsere Liste nun vollständig ist oder nicht, – man muss sich darüber klar sein, dass die Methoden niemandem wie eine Palette zur Verfügung stehen, bisweilen schließt eine die andere aus.
Und jede Methode lässt sich symbolisch verwenden oder kann sogar nur auf symbolischer Ebene voll verstanden werden: die Töne bedeuten etwas – über ihr schieres Erklingen hinaus. Wer den 2. Satz der Eroica nicht als Trauermarsch erkennt, verfehlt einen wesentlichen Aspekt.
Wer dem Spiel der chinesischen Zither Qin lauscht, ohne in den Sinn dieser Musik eingeweiht zu sein, wird nichts Wesentliches hören.
Man könnte darüber diskutieren, ob es wirklich Universalien gibt, ob diese nicht so allgemein zu fassen wären, dass sie alles und nichts aussagen, oder ob die Zuschreibungen nur kulturbedingt funktionieren, also eingeübt werden müssen.
Deryck Cookes Buch ”The Language of Music” bezieht sich ausschließlich auf abendländische Musik; aber es wäre durchaus vorstellbar, z.B. die Lamento-Figur von Gibbons und Tschaikowsky, die den Umschlag des Buches ziert, auch im indischen Raga Bhairavi oder in zahlreichen Liedern Afghanistans wiederzuerkennen.
Deryck Cooke: The Language of Music / Oxford University Press 1959 (1964)
Allerdings kenne ich keinen Raga, der aussschließlich traurigen Charakter hat, und im Fall der iranischen und arabischen Musik müsste man den Charakter gerade der Töne berücksichtigen, die gewissermaßen zwischen unseren Klaviertasten liegen und keine unmittelbare Zuordnung zu westlichen Tonarten erlauben.
***
Hans Zender sieht – in seinem anregenden Buch ”Happy New Ears” –
Hans Zender: Happy New Ears – Das Abenteuer, Musik zu hören / Freiburg 1991
die westliche Musik seit Bach als ”Emanzipationsbewegung größten Umfangs” (S.42) und meint, dass nunmehr eine Stufe erreicht sei, ”auf welcher wir lernen müssten, mit unserer schrankenlosen Freiheit sinnvoll umzugehen. Konnte ein Komponist in früheren Jahrzehnten wenigstens noch der Empörung und dadurch der Aufmerksamkeit eines Teiles der Öffentlichkeit sicher sein, wenn er zum ersten Mal ein Tabu der überkommenen Ästhetik verletzte, so sind inzwischen keine Tabus mehr vorhanden, welche man brechen könnte: der Komponist befindet sich in einer Freiheit, die ihm einerseits jede denkbare Klangverbindung, jede vorstellbare Gestaltung erreichbar macht, andererseits ihm auch die Musik aller Zeiten und Völker als Material zur Verfügung stellt. Denn da das komponierende Subjekt die Grenzen des Kunstwerks nicht mehr definieren kann, fällt auch die Vorstellung eines Personal- oder Zeitstils in sich zusammen; alle Stile aller Zeitalter können zitiert, verarbeitet, miteinander gemischt werden, wenn das Konzept des Autors es verlangt.” (S.42)
Ich finde diese Bemerkungen problematisch.
Zender selbst kann unmöglich daran glauben, dass eine fortschreitende Auflösung von Tabus eine immer höhere Emanzipation gewährleiste, – genau solche längst mechanisierten Vorstellungen richten Schaden an, jeder Tölpel könnte sich drauf berufen. Ob der Bruch eines Tabus bereits ein kreativer Schritt sei, muss ja erst durch das Werk erwiesen sein. Das Wort ”Freiheit” darf nicht als Fetisch dienen: für Palestrina hätte ein Bruch mit den Regeln der Satzkunst keineswegs ”Freiheit” bedeutet, sie bestand vielmehr in der eleganten Handhabung der scheinbar strengen Regeln. Mozart ist durchaus nicht dort am größten, wo er die Gesetze der überkommenen Harmonik aufs äußerste strapaziert, wie in den Durchführungen der G-moll-Sinfonie, sondern auch überall dort, wo er ”ganz normale” Werke schreibt (sich scheinbar in den Grenzen der Konvention bewegt).
Und was hat es zu bedeuten, wenn die heutige Freiheit dem Komponisten ”die Musik aller Zeiten und Völker als Material zur Verfügung stellt”???
Ist sie denn damit auch wirklich verfügbar? Sie existiert ja überhaupt nicht ”als Material”? Dieser Begriff stammt aus einer Schrift- und Werkkultur.
Wie aber wollen Sie den Geist eines Ragas oder die inspiriertesten Augenblicke einer Interpretation von Vilayat Khan ”zitieren”?
Wer aber diese Augenblicke an sich erfahren hat (durch vorhergehendes gründliches Studium der indischen Musik und ihres gesamten Umfeldes), der wird nicht mehr an die Zitierbarkeit glauben.
In der Tat steht der Pluralismus, der an solchen Stellen anklingt, durchaus nicht auf so sicheren Füßen.
Wenn Zender über ”Geistliche Musik und Liturgie” spricht, klingt es ganz anders:
”Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der es keine gemeinsame Sprache gibt. Deswegen haben die überlieferten folkloristischen Formen auf die Dauer keine Chance; sie können allenfalls noch als Sprachen von Minderheiten betrachtet werden.” (a.a.O. S. 100) Etwas später: ”Die Suche nach Strukturen, welche unabhängig von allen Traditionen einer rassischen, nationalen oder sonstwie geprägten Folklore ist, gehört (…) zu den großen Themen der modernen Kunst.” Und dann kommt das Wort von der ”Universalsprache” (in Anführungszeichen gesetzt), die allerdings weiterhin ”Zitate” erlaube von der Folklore bis zum großen Kunstwerk der Vergangenheit.
Vielleicht klingt das alles an dieser Stelle etwas anders, weil es ja um Musik für die Kirche geht, die sich bekanntermaßen als ”universal” versteht.
Abschließend weist Zender auf das für ihn größte Werk geistlicher Musik des Jahrhunderts: Zimmermanns ”Antiphonen”. (a.a.O. S.102)
Dabei zeigt es sich, dass die verwendeten Sprachen, Texte und Autoren, schließlich auch die zeichenhaft eingesetzte Choralmelodie ”Christ ist erstanden”, für Zender entscheidende Bedeutung haben, – symbolische Bedeutung -, der Musik an sich gelten nur diese wenigen Worte: ”…mitten in der seriellen Perfektion der Struktur…”
Ich sage dies nicht, um Zender zu kritisieren. Es ist symptomatisch, dass wir uns an die vertonten Texte halten, wenn es an Hinweisen, wie wir die Musik adäquat wahrnehmen können, fehlt.
Gehört also die genaue Kenntnis der Texte zur Methode des Hörens?
Muss ich z.B. den Text der Consolation II von Helmut Lachenmann gelesen haben, da er im Erklingen des Werks – aufgrund phonetischer Demontage nicht mehr verstehbar ist? Lachenmann selbst sagt: ”Solche ‚Unverständlichkeit’ scheint mir legitim und dort kaum vermeidlich, wo Musik und musikalische Form ihre alten sprach-analogen Gesetzmäßigkeiten mit anderen vertauscht haben, mit Gesetzmäßigkeiten nämlich, welche sich gegen die oberflächliche Koppelung mit einem semantisch orientierten und grammatikalisch gerichteten Sprachverlauf sperren.” Dennoch rechnet er damit, ”dass die semantische Bedeutung doch noch quasi ‚von fern’ signalisiert bleibt.” (Lachenmann 1969)
Jedenfalls hat Lachenmann seine Methode damit genau bezeichnet: es ist die kritische.
Helmut Lachenmann: CD Mouvement (-vor der Erstarrung) / „…zwei Gefühle…“, Musik mit Leonardo / Consolation I / Consolation II / Kairos 0012202KAI
Ich spiele jetzt das Vokalwerk eines anderen Komponisten an, das mich überhaupt nicht aufgrund des Textes interessiert hat, sondern allein aufgrund der Klänge, der Reibungen und der Glissandi, für mich eine Angelegenheit der Hörmethode Nr.3, der bulgarischen Diaphonie.
Musik 8 Nuits „Ave Maria“ Hosokawa Tr. 1 ab 1’45” bis 2’38”
CD Nuits – weiß wie Lilien / SCHOLA HEIDELBERG ensemble aisthesis Walter Nußbaum / Toshio Hosokawa „Ave Maria“ / Schott Japan Company Tokyo / BIS & SWR / BIS-CD-1090
Ein Negativschock kam erst in dem Moment, als der Text eindeutig verständlich war. Sie werden es in wenigen Sekunden hören, ziemlich genau in der Mitte des 8-Minuten-Werkes.
Musik 9 Nuits Hosokawa ab 4’25” bis (“Jesus Christus!!!”) 5’03”
Das Barrabam-Pathos dieses Aufschreies ist mir sehr unangenehm und Ihnen vermutlich auch. Ich behaupte jetzt einfach, dass es kein Bekenntnis, sondern ein Zugeständnis des Japaners Toshio Hosokawa ist, und zwar an seine christlichen Auftraggeber.
Wie wir die folgende Musik adäquat hören, ist wohl keine Frage: die Glocke mit ihrem hartnäckigen, asymmetrischen Rhythmus wirkt fast wie ein afrikanisches Zitat, im Gegensatz zu Hosokawa bewusst ohne dynamische oder klangliche Raffinesse zusammengesetzt, der Komponist drohte vor der Aufführung, dass es keine Pause geben und darüber hinaus auch noch sehr laut werden würde. ”Vielleicht zum Trost: Es gibt auch leise Stellen, aber nur wenige.” Ein bewusster Barbar natürlich, aber Feinsinnigkeit ist nun einmal nicht die Voraussetzung von Kunst…
Musik 10 Ödipus Tr. 8 Anfang bis 0’49”
Steffen Schleiermacher: Das Testament des Ödipus (2002). Deutsche Erstaufführung.
Steffen Schleiermacher – Tasteninstrumente, Stefan Stopora – Schlagzeug, Martin Losert – Saxophon / 03.07.2003 MDR-Studio am Augustusplatz / MDR Musiksommer.
Auch an anderer Stelle wirken die Ostinati wie Anklänge an eine unbekannte Volksmusik, dazu die atemlose, erregte Erzählweise, von fern an Rap erinnernd, – unmöglich, sich dazu einen seriösen Methoden-Text wie den von Lachenmann vorzustellen. Hier orientiert sich jemand an nicht-geschriebener Musik.
Musik 11 Ödipus Tr.7 ab 1’38” bis Ende (3’03”)
(wie oben) Schleiermacher: Das Testament des Ödipus (2002). Truike van de Poel, Stimme
Das waren Ausschnitte aus Steffen Schleiermachers “Das Testament des Ödipus” nach Sophokles/Heiner Müller.
Zu den ganz wichtigen Dingen des musikalischen Denkens gehört nicht nur, wie in Musik Sprache behandelt wird, sondern natürlich auch, wie über Musik gesprochen wird. Der Diskurs, wie man heute sagt. Wir wissen, was Adornos Buch über Mahler bewirkt hat: man lernte positiv über das zu reden, was vorher als Makel gegolten hatte: die Brüche, das Triviale, die angebliche Kapellmeistermusik.
Sie erinnern sich sicher auch an George Steiners leidenschaftliches Plädoyer gegen alles Sekundäre und Parasitäre: “Ein ängstliches Verlangen nach Zwischenstufen, nach erläuternd-wertender Vermittlung zwischen uns und dem Primären durchdringen unser Wesen,” schreibt er, und stellt dagegen die direkte Begegnung mit jener “realen Gegenwart”, von der sein ganzes Buch handelt. Die des Kunstwerkes. Die Kritik blieb nicht aus und bei allem Respekt vor seinen Gedankengängen möchte man sie auch zu dem notwendigen sekundären Diskurs zählen, der uns das Primäre deutlicher sehen und hören lässt.
George Steiner: Von realer Gegenwart – Hat unser Sprechen Inhalt? / München Wien 1990
Mir scheint es inzwischen verdächtig, wenn man angesichts der Diversifizierung von Stilen und musikalischen Möglichkeiten verbal immer wieder die Notwendigkeit der Stille beschwört, – womit ich nichts gegen die legitime Auskomponierung der Stille bei Feldman und anderen sage.
Die Stille hilft nicht unbedingt. Jedenfalls nicht, wenn danach ein ausgewachsenes Streichquartett von Wolfgang Rihm folgt.
Wolfgang Rihm: String Quartets Vol. 1 (Nos. 1.4) und Vol. 2 (Nos. 5-6) col legno WWE 20211/12
Mir scheint es auch zu wenig, was dieser Komponist, ein hoch beredter Mann, oder sein Produzent uns mitgibt, wenn wir seine Streichquartette hören (und vielleicht verstehen) wollen. Das fünfte heißt ”Ohne Titel”, das sechste ”Blaubuch”. Was soviel heißt wie: Schlagt ruhig im Lexikon nach, das hilft auch nicht!
Da steht: siehe Farbbücher. Und das waren amtliche Dokumentensammlungen, die die Außenministerien der Öffentlichkeit aus Anlass bestimmter außenpolitischer Ereignisse unterbreiten. Großbritannien veröffentlichte zuerst Blaubücher, das Deutsche Reich seit 1879 Weißbücher, die USA bedienten sich des Rotbuches usw.
Ein Blaubuch also.
Und dann steht da noch: Auf die Frage, was er mit seiner Musik beabsichtige, antwortete Wolfgang Rihm einmal: ”Bewegen und bewegt sein”. Der Kommentator fügt hinzu: ”Dem ist bei der Beschreibung des 5. und 6. Streichquartettes nichts hinzuzufügen.”
Es handelt sich aber immerhin um 30 plus 47 Minuten Musik.
****************************************************************
1953 erschien „Le degré zéro de l’écriture” von Roland Barthes, und diese Vorstellung vom Nullpunkt, von einer tabula rasa, bei ihm als Utopie entworfen, hat sich von ihm gelöst und geistert seither durch die Sekundärliteratur.
Roland Barthes: Le dégré zéro de l’écriture Paris 1953 / auf deutsch: Am Nullpunkt der Literatur / Frankfurt am Main 1982
Es geht um die Suggestion, dass wir überhaupt einen neuen Nullpunkt setzen können; dass aus der Stille gewissermaßen ein neues, jugendfrisches Hören komme. Ein Argument, womit sich die Jugend womöglich gern die gewaltige Hörarbeit erspart, die zum Erlebnis klassischer Musik gehört.
Und ich denke daran, dass z.B. die indische Musik diese Stille überhaupt nicht kennt: das Surren der Tanpura, der Grundtonlaute, ist ihrer Idee nach ewig. Das andächtige Schweigen und Lauschen in unseren Konzersälen hat indische Meister durchaus überrascht. Die indische Musik kommt nicht aus der Stille, sondern ganz bewusst aus deren Verletzung, Aghat, Schlagen, Verwunden. Erst wenn der indische Musiker sich veranlasst sieht, philosophisch über den Hintergrund dieses ersten Klanges zu sprechen, kommt er auf Anhad, die Stille.
Nur der Philosoph beginnt auf der anderen Seite: ”At the heart of music is silence. This silence, anhad, when made audible is nad, the primordial sound.” (Vidya Rao).
Music Appreciation Vol 1 A three part understanding of Hindustani music 1992 Script: Vidya Rao / Music Today CD-A92017
Auf dieser abstrakten Ebene bewegen sich wohl auch Rihms Worte vom Ziel seiner Musik: Bewegen und Bewegtsein. Es sagt jedenfalls nicht viel mehr als Beethoven, wenn er über seine Missa solemnis schreibt ”Von Herzen möge es zu Herzen gehen.”
Einer so vom Komponisten bezeichneten ”Hörmethode” ist schwer zu widersprechen. Wer will schon herzlos sein… und wer – unbeweglich.
Aber gerade die Missa solemnis hat ihren Text und ihre schwierige Deutungsgeschichte bis hin zum dunklen ”Verfremdeten Hauptwerk” bei Adorno.
Anderen Werken kann es widerfahren, dass sie durch wohlmeinende Willkür an dem Nullpunkt angesiedelt werden, den die Klangkunst bezeichnet.
David Rothenberg (Editor): Music from Nature / in: TERRA NOVA vol. 2 Nr. 3 Massachusetts 1997 / Kommentar zur beigegebenen Terra Nova CD / S.133
Der amerikanische Naturklangsammler und Musiker David Rothenberg hat in seine Essay- und Klang-Anthologie ”Music of Nature” den ersten Satz der Beethoven-Sonate op. 109, E-dur, einbezogen und es etwa so begründet:
”Wie kann Beethovens Musik über irgendetwas anderes gehen als über Natur? Mit dem Drängen und Wogen ihres Meeres, ihren Wasserfällen und Windböen, ihren Zusammenstößen und ihrem freien Verströmen?” (a.a.O. S. 134) (Übers. J.R.)
”Für mich hat dieser eine Satz einen erstaunlich modernen, fließenden, fast impressionistischen Klang, eher dem Lauf der Wellen folgend als seiner eigenen rigorosen Sonatenform.”
Er fügt hinzu, dass Beethoven hier mit Zeitgestaltung und irregulären rhythmischen Emanationen N a t u r evoziert, ebenso ”präzise wie fluide”; Muster, die nicht perfekt gerundet sind, die sich zubewegen auf Unerwartetes – auf etwas, das durch eine Maschine nie ersetzt werden könne. (a.a.O. S. 134)
Man schaut verblüfft in die Beethoven-Sonate, die einer solchen Vereinnahmung nicht widersprechen kann, und in die entsprechende Literatur. Beethoven selbst beruft sich ja durchaus nicht auf die Natur, sondern – in seinem Widmungsbrief zu dieser Sonate – auf den ”Geist, der edle und bessere Menschen zusammenhält und den keine Zeit zerstören kann, dieser ist es”, so schreibt er an die 19jährige Maximiliane von Brentano, ”dieser ist es, der jetzt zu Ihnen spricht…” Der Geist und das Mädchen, das wäre durchaus eine mögliche Deutungsrichtung. ”Mit aller Macht stemmen sich solche Beethoven-Stücke gegen das Vergehen der Zeit”, schrieb Jürgen Uhde unter Bezugnahme auf den letzten Satz, der das Ziel der ganzen Sonate ist. Es liegt auf der Hand, das Beethovens Spätwerk auch mit dem Erlebnis des Alterns zu tun hat.
Jürgen Uhde: Beethovens Klaviermusik Band III Stuttgart 1974 / 1991 S. 465 ff
Rothenberg aber macht gar nicht den Versuch, Beethovens Intentionen zu erfassen, das Gebilde spricht nicht zu ihm, er beobachtet es, aus seiner Sicht verhält es sich wie ein Naturvorgang.
Der Vorteil liegt auf der Hand: man hat mit Bildungsballast und Deutungsnot wenig zu schaffen hat. Peter Kivy, der Fürsprecher des Phänomens ”Music alone” hätte dennoch wenig Freude daran, da die Beschaffenheit der musikalischen Struktur letztlich gleichgültig ist:
N a t u r ist alles – und nichts.
Die Natur gibt es nicht, sagte Paul Valéry.
Ich habe auch dies als eine letzte (in der Musik sicher atavistische) Hörmethode eingegliedert: Die intendierte, assoziierte oder sorgsam eingelagerte Bedeutungsebene einer Musik auszublenden und ihr dadurch möglicherweise eine andere zu unterschieben.
Meistens beginnt man an dieser Stelle von ”Material” zu sprechen. Oder von ”klanglichen Ereignissen”. Auf die Reduzierung der Musik zur ”Klangkunst” (von dieser sicher als längst fällige Öffnung der Musik verstanden) ist Max Nyffeler in seinem Essay ”Neue Wege des Hörens” gründlich eingegangen.
Max Nyffeler: Neue Wege des Hörens? Gedankengänge zwischen Konzertsaal und Klangkunst 2002 / Web: beckmesser.de
Es habe – in der Zeit nach John Cage und der Fluxus-Bewegung – ”vereinzelt Stimmen gegeben, die nach altvertrauter Fortschrittsideologie bereits das Ende des durchkomponierten Kunstwerks diagnostizierten, an dessen Stelle nun die Klangkunst treten sollte.”
”Was heute unter dem designerhaften Titel ‚Klangkunst’ daherkommt, kann als Reflex auf eine Konzertsaal-Avantgarde gesehen werden, deren strukturbezogenes Denken immer wieder zur Selbstreferentialität tendiert und neuen Publikumsschichten den Zugang notorisch erschwert. Eine Klangskulptur im Freien oder ein begehbarer Schallraum öffnet die hermetische Kunstsphäre zum Alltag und ermöglicht die zwanglose Wahrnehmung. Der adornosche Hörertyp des Experten, an den sich komponierte Musik bei aller gewonnenen Flexibilität noch immer richtet, wird dann vom Flaneur abgelöst. Das kommt auch den veränderten Hörgewohnheiten der nachrückenden Generation entgegen. Viele junge, musikinteressierte Hörer sind mit Walkman und Computer besser vertraut als mit Klavier und Streichquartett. Bei ihnen geht Sound vor Struktur, beiläufiges Hören vor Notenlesen, Konsum vor Eigenaktivität.”
Nyffeler schließt daran die Frage, ob dies nicht ”Symptom des Niedergangs musikalischer Bildung, wenn nicht von Kultur überhaupt” sei, hütet sich allerdings vor einer allzu eiligen Verurteilung.
Könnte es nicht der Beginn von etwas Neuem sein? ”Zurück zur reinen Wahrnehmung”.
Wahrnehmung allerdings, ich zitiere weiter, “die nicht mehr auf den hörenden Nachvollzug von musikalischen Binnenstrukturen und Formverläufen ausgerichtet ist, sondern auf die durch den Klang vermittelte Eigenbefindlichkeit in Raum und Zeit. Diese Art von Wahrnehmung kann mithin Vehikel einer symbolischen Standortbestimmung des Ichs in der Welt sein.”
Ein sehr interessanter Gedanke: dass auch die von jeglicher Bedeutung losgelösten Klangstrukturen eine symbolische Bedeutung für das hörende Ich annehmen können.”
Nyffeler fährt fort: ”Doch gerade die Symbolhaftigkeit, bei der das Kunstwerk als Zeichen für etwas anderes steht, soll nach Auffassung der Klangkunst-Anhänger tunlichst vermieden werden. Das ist für sie eine Eigenschaft der ‚alten’ Konzertmusik. Sie wollen Klang als reines Wahrnehmungsphänomen behandelt wissen.”
Jeder von uns wird sagen: Nichts gegen die reine Wahrnehmung und die reale Gegenwart! Aber die reine Wahrnehmung ist weder rein noch ahistorisch, und auch real „gegenwärtige“ Kunstwerke werden durch Theorie nicht zerstört: je näher wir ihnen damit kommen, desto ferner schauen sie zurück.
Unsere Eigenbefindlichkeit kann ihr Problem nicht sein.
*** ©Reichow07/2004 ***