Lesen als lebensnotwendiges Mittel
Vorläufige Merkzettel
Die Wiederentdeckung des Anfangs
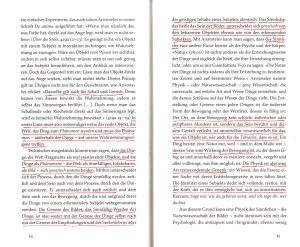 neues Buch von E. Coccia „Sinnenleben“
neues Buch von E. Coccia „Sinnenleben“
(Das Wort „schillernd“ im Umschlagtext finde ich ganz unangebracht. „Glänzend“ wäre angemessener.)
Was bedeutet es, wenn der Höhepunkt fehlt?
Ich meine es ganz naiv: eine Lautstärkesteigerung, die in einem Forteschlag oder einem Akzent kulminieren müsste. Dramatisch aufgefasst: jemand spricht immer heftiger und schreit das letzte Wort heraus, schlägt vielleicht sogar dabei auf den Tisch. So, wenn es mit Wut verbunden ist. Auch wachsende Inbrunst wäre denkbar, gipfelnd in einem Bekenntnis („Fräulein Kunigunde, ich kann nicht länger schweigen, es muss heraus: ICH LIEBE SIE!!!“). Aber wenn nun das entscheidende Wort, der Akzent, die Liebeserklärung, der Wutschrei, der Aufprall der Hand fehlt? Wie nennt man das?
Wenig passend finde ich den Terminus, der von manchen Klavierpädagogen verwendet wird, nämlich „negativer Höhepunkt“, denn alles, was ihm an Lautstärke vorenthalten wird, gewinnt er an innerer Intensität. Man kann es unmöglich mit dem Wort negativ charakterisieren.
Ich wage mal eine Behauptung, die nicht durch lange Recherchen abgesichert ist: bei Chopin gibt es diese Art von „crescendo interrupto“ (kein offizieller Terminus, sondern meine Erfindung) nicht. Ebensowenig wie bei Mozart.
Übrigens hat mir das Phänomen in jungen Jahren widerstrebt, sowohl beim Spielen als auch beim Hören. Ich habe es nicht verstanden; es kam mir affektiert vor (um nicht zu sagen: affig). Bei Mahler habe ich es akzeptieren gelernt, wenn auch zuweilen mit dem Verdacht, es könne als Masche um sich greifen. „Mein Ziel ist so kostbar, dass ich kaum wage, es Klang werden zu lassen.“ Vielleicht wird es deshalb selten intensiv ausgeführt, es wirkt ja auch als „Bremse“. Man höre nur den Anfang des Adagiettos, – nach den Harfenklängen drei Töne Auftakt der Ersten Violinen im Crescendo. Und dann der Zielton – um es respektlos zu sagen – angefasst wie eine heiße Herdplatte. Z.B. hier. (Die Aufnahme ist klanglich defizitär. Sie ist hier nur verlinkt, weil der Notentext beigegeben ist und so der Phantasie auf die Sprünge helfen kann.)
Ich habe den Vorgang sehr verkürzt beschrieben und ziehe die Analyse eines gründlichen Musikwissenschaftlers vor, die vielleicht manchem Leser umständlich oder gar unverständlich erscheint. Aber sie macht kenntlich, dass es sich in Wahrheit um einen komplexen psychologischen Vorgang handelt. Es geht um den Beginn eines unvergleichlichen langsamen Satzes von Beethoven, Lento assai, dritter Satz des Streichquartetts op.135 (Klangbeispiel mit Noten hier Gegenstand der Analyse ist die Zeitspanne 0:00 – 0’14“):
Der Sinn dieses Verfahrens liegt in der Zusammenzwängung von zwei verschiedenen Spielarten von Ruhe, Ruhe als Erreichtem (Ende) und Ruhe als Ausgangsposition (Anfang). Das crescendo vor einem Taktschwerpunkt ist Bewegung, Unruhe auf ein Ziel, eben auf den Schwerpunkt hin. Durch das crescendo erscheint der Schwerpunkt, sowie er eintritt, als etwas Erreichtes (Ende). Indem aber nun im Augenblicke des Eintretens die natürliche Begleiterscheinung des Erreichtseins, die dynamische Unterstreichung, unterbleibt, indem also sozusagen der Triumph des Das-Ziel-Erreicht-habens nicht ausgekostet wird, entsteht so etwas wie eine Verwandlung des Zeitbewußtseins. Der durch crescendo gekennzeichnete zurückgelegte Weg, der zu diesem Ziel führte, wird aus dem Gedächtnis getilgt. Durch die dynamische Zurücknahme gibt das Subjekt sich selbst einen Stoß, tritt es zur Situation, in der es steht, in Distanz, macht es sich frei für neue Aufgaben, wendet es den Blick um, vom Vergangenen weg auf die Zukunft hin. An die Stelle der Ruhe infolge des Ankommens tritt dadurch – und zwar plötzlich, im selben Augenblick – die Ruhe des Anfangens.
(JR) Ich sage vorsichtshalber: das ist nicht leicht zu verstehen, aber es lohnt sich dabei zu verweilen. Es geht tatsächlich nur um ein paar Sekunden klingende Musik, und sie scheint sich durchaus unmittelbar zu erschließen. Wenn ein Spieler sagt: nein, ich brauche diesen Text nicht, ich spiele, wie ich es fühle und wie es dasteht, könnte vielleicht kein Mensch der Welt feststellen, ob er die Essenz ohne jedes Wort erfasst hat oder nicht. Trotzdem würde ich ihn dazu anhalten, dem Text weiterhin Zeit zu widmen und in eigenen Worten wiederzugeben, was er liest. So schulmeisterlich das klingt.
Sehr wesentlich ist es, zu begreifen, daß die Dynamik hier nicht isoliert betrachtet werden kann, nicht ein von den anderen Satzfaktoren unabhängiger ‚Parameter‘ ist. Es handelt sich nicht um den bloßen Effekt, daß nach etwas Lautem plötzlich etwas Leises eintritt. Entscheidend ist vielmehr die Koppelung, die Wechselwirkung mit der Satzstruktur, d.h. daß die plötzliche Zurücknahme ins piano auf einem Taktschwerpunkt erfolgt und daß es eine Konsonanz, ein Ruheklang ist, dessen dynamische Hervorhebung unterbleibt. Kadenzgeschehen und Taktrhythmik bilden für die dynamischen Vorgänge und also auch für deren Verständnis die sinngebende Voraussetzung.
Den plötzlichen Umschlag des musikalischen Zeitbewußtseins wirklich zu vollziehen, also: wenn in diesem Beethoven-Satz nach einem crescendo ein plötzliches piano eintritt, wirklich zu erfahren, was da geschieht, das erfordert Kraft, Entscheidungsfähigkeit. Denn gänzlich Disparates wird in einen einzigen Augenblick gezwängt.
Quelle Rudolf Bockholdt: Über das Klassische der Wiener klassischen Musik. Seite 225 – 259 (Zitat S. 252 f). In: Über das Klassische Herausgegeben von Rudolf Bockholdt / suhrkamp taschenbuch materialien / Frankfurt am Main 1987.
***
Um die andere in diesem Sinne aufschlussreiche Stelle des Beethoven-Satzes mit Rudolf Bockholdt zu betrachten, gehe man zunächst auf 2:32 im angegebenen youtube-Beispiel. Tonartwechsel, Vorzeichenwechsel. Doppelstrich. Es ist der Beginn der dritten, der cis-moll-Variation. (Es versteht sich, dass man den ganzen Satz schon gründlich kennt, als Aufnahme oder im Konzert gehört, günstigstenfalls schon selbst mitgespielt hat!)
In dieser Variation haben wir mehrfach Gelegenheit, das kleine crescendo zu studieren, dessen dynamischer Zielpunkt ‚fehlt‘. Es geht aber letztlich um die Stelle bei 3:35, der 3-Sechzehntel-Auftakt zu Takt 32, die Rückkehr nach Des-dur (Vorzeichenwechsel).
Bockholdt sieht hier „das Nonplusultra der Zusammenzwängung von Disparatem“. (Achtung: man muss wirklich jedes Wort als bloßes Zeichen für etwas nehmen. Wenn jemand sich veranlasst sieht zu sagen: nein, ich höre da keine Zusammenzwängung, so hat er zwar auch irgendwie recht, kommt aber nicht weiter, – und müsste dazu verdonnert werden, den Aufsatz als Ganzes zu studieren, mit Bezug auf ein Haydn- und ein Mozart-Beispiel. Ich will hier niemanden überzeugen, sondern referiere, was ich selbst gerade erst eingesehen habe und dessen Überflüssigkeit ich keinesfalls diskutieren möchte.
***
Nun zu Takt 32, wie schon im letzten youtube-Beispiel betrachtet. Hier Bockholdts Analyse (S.253f):
Es ist der letzte Takt der dritten, der cis-moll-Variation; mit Takt 33 (‚Tempo I‘) beginnt die vierte Variation, wieder in Des-Dur. In jeder Variation erscheint der Tonika-Schlußklang auf der zweiten Hälfte ihres zehnten, letzten Taktes (siehe die Takte 12, 22, 42 und 52). Demgemäß müssen wir auch den Schlußklang der cis-moll-V ariation in der zweiten Hälfte des letzten Taktes suchen. Wir betrachten Takt 32: die mit pianissimo bezeichneten Sechzehntel bilden einen Dominantklang (Gis-Dur), und die Auflösung dieses Klanges in die Tonika erfolgt, nach Vorzeichenwechsel und Achtelpause, mit dem darauffolgenden Klang (siehe Beispiel 10, Pfeil).
Verglichen mit den Schlüssen der übrigen vier Variationen ist diese Auflösung aber in höchstem Grade problematisch. Was soll der Vorzeichenwechsel vor der Auflösung, was die Achtelpause ausgerechnet an der Stelle, an der sonst der Auflösungsakkord steht, warum ist der Auflösungsakkord ein Sextakkord? Um den Vorgang zu erfassen, ist es nötig sich zu vergegenwärtigen, daß der materiell gesehen kleine Tonbestand zum Zerplatzen gefüllt ist mit verschiedenen Sinnmomenten:
(Fortsetzung folgt, – um es kurz zu machen und mich zu entlasten: ich gebe die beiden folgenden Seiten als Foto, sie sind unentbehrlich, und geben Anlass zu Ausblick und Rückblick.)
folgt… vorläufig (?) nur so:

 (und weiter im Text als Zitat:)
(und weiter im Text als Zitat:)
… musikalisch zu vollziehen, bedeutet eine äußerste Anforderung. Die von Beethoven im späten Werk gezogene Summe stellt daher nicht so etwas wie eine knappe, abstrakte Formel, die gelernt werden kann, sondern konzentrierte Substanz, die erfahren werden muß, dar.
Der kritische Akkord in Takt 32 ist nichts als ein simpler Sextakkord, zu Beethovens Zeit schon viele hunderttausendmal verwendet: das Allgemeinverständlichste von der Welt. Aber ihn als das, was er an dieser Stelle ist, begreifen zu können: das stellt an das Auffassungsvermögen den allerhöchsten Anspruch. Das Elementarste paart sich mit der größten Bedeutung. Einem musikalischen Satz, mit dem dies möglich ist, gebührt das Prädikat: höchste Reife.
Quelle (wie oben schon angegeben): Rudolf Bockholdt: Über das Klassische der Wiener klassischen Musik. Seite 225 – 259 (Zitat S. 252 f).
Nachwort
Der wissenschaftliche Text selbst läuft gewissermaßen in einem Crescendo aus, dem ein Schweigen folgt: Habe ich alles verstanden? Geht es nicht einfacher? Muss ich noch einmal von vorn anfangen? Der Satz: das stellt an das Auffassungsvermögen den allerhöchsten Anspruch steht weiter im Raum wie ein Fanal. Hat Beethoven das gewollt? Er hat natürlich nicht mein Fassungsvermögen im Auge gehabt, und ich bin es ja nun, der seinen Quartettsatz gewissermaßen noch weiter verschlüsselt hat, in der Vorschaltung dieses Textes. Als Sisyphus-Arbeit für mich selbst, nicht als Schikane für andere.
Was tun? Hören!
Zunächst (mit allem Vorbehalt, aber mit Rücksicht auf diesen Blog-Artikel) ab 12:20 bis 19:54 – der Wendepunkt zurück nach Des-dur befindet sich hier bei 16:38.
Bockholdts bedeutender Aufsatz wurde hier nur zu einem Bruchteil zitiert, man muss ihn ganz lesen, gerade auch den ersten Teil, der Haydn und Mozart betrifft. Notwendig ist auch die genaue Kenntnis der formalen Anlage dieses Satzes (das gleichbleibende metrisch-harmonische Modell und seine 5 Varianten, deren erste das Thema ist). Und dann darf man mit Bockholdt (Seite 250) sagen:
Die simple äußere Anlage des Stückes und die scheinbare Schlichtheit des ‚Themas‘ täuschen sehr. Den Satz so zu spielen und zu hören, daß er selbst statt eines Schattens zum Vorschein kommt, gehört zu den schwersten Aufgaben.
Darum halte ich es auch für notwendig, die Künstler beim Spiel, bei ihrer ernsten Arbeit, zu beobachten. Ein Glücksfall, wenn sich diese Konzentration auf die zuhörenden Menschen überträgt. Größeres gibt es nicht.
Zum Anfang der Marseillaise
Als ich mir kürzlich die syrische Nationalhymne anhörte, geriet ich ins Grübeln: wie auch viele andere Hymnen ist sie mehr ein Kampflied als eine Hymne, jedenfalls will sie aktivieren, nicht zum Tanzen, sondern zum Marschieren. Erkennbar vor allem an dem „punktierten Rhythmus“, allerdings anhebend nur mit einem bloßen Sechzehntel-Auftakt: trotzdem frage ich mich, ob nicht in all diesen Fällen als Vorbild die „Marseillaise“ mit ihrem erweiterten Auftakt gelten kann (der dann im weiteren Verlauf als punktiertes Achtel plus Sechzehntel fortwirkt). Aber woher kommt er, wann hat man die hinreißende Wirkung dieses Anfangs erkannt? Die energetische Ausstrahlung ist anders als in den Tanz-Auftakten der alten barocken Suiten. Bei Wikipedia steht, dass der Anfang eines Boccherini-Quintetts die melodische Anregung gegeben haben könnte. (Jetzt brauchten wir noch den Hinweis, das Roger de Lisle, der Schöpfer der Marseillaise, Flöte gespielt und mit Vorliebe genau dieses Quintett geübt hat…)
Dem Auftakt fehlt jedoch das entscheidende rhythmische Detail, ansonsten: der Zielton der hohen Oktave auch hier – wenn auch Schritt für Schritt wie in „Ein Männlein steht im Walde“, erst der kühne Sprung gäbe den Charakter -, dann immerhin der fallende Dur-Dreiklang und seine Fortführung im a-moll-Dreiklang samt rhythmischer Komprimierung: die Vergleichbarkeit geht bis zum Anfangston des nächsten Taktes. Ja, selbst der Ton f“ auf der Zählzeit 2 des zweiten Taktes entspräche noch dem in der Marseillaise durch Aufwärtssprung erreichten Ton (siehe oben, Zeile 2, 5.Ton). – Auch die syrische Hymne verlässt sich auf die klare Wirkung des Dur-Dreiklangs (von einem arabischen Flair kann nicht die Rede sein) und auf den punktierten (nicht erweiterten) Rhythmus. Der neue Ansatz auf h-moll in der dritten Zeile zeigt jedoch, dass die Melodie im übrigen ganz anders angelegt ist
Quelle der beiden Hymnen: Reclam Nationalhymnen – Texte und Melodien / Philipp Reclam jun. Stuttgart 2007 (Seite 50 und 188)
Es geht mir aber nicht um einen typologischen Vergleich der Melodien, sondern um den rhythmischen Effekt, den es in dieser Form wohl nicht vor der Französischen Revolution gegeben hat. Vielleicht hat er in der Ausprägung der Marseillaise rein textlichen Ursprung, schwer genug rhythmisch präzise zu artikulieren. Wenn die Trompeten ihn nicht retten, ist der erste Einsatz ist bei Massenaufführungen, z.B. im Fußballstadion, kaum zu erkennen („Allons enfants“), es sind immerhin vier Silben!
Die Märsche seit der Französischen Revolution sind gekennzeichnet durch vorwärtstreibende und punktierte Rhythmen, wie in den Revolutionshymnen und -märschen (Marseillaise) und in der Oper außerhalb Frankreichs, vor allem bei Spontini.
Quelle Riemann-Musiklexikon Sachteil / Schott’s Söhne Mainz 1967 Art. Marsch
Eine Variante, die den Anfang der Marseillaise-Melodie jeden Schwungs beraubt, zitiert Ulrich Schmitt („Revolution im Konzertsaal“ Schott Mainz 1990 Seite 204). Er bezieht sich dabei auf Wilhelm Tappert Wandernde Melodien Berlin 1889 S.59ff. :
Um noch einen historisch bemerkenswerten Auftakt in Erinnerung zu rufen:
 Beethoven VII: Wo beginnt das Thema?
Beethoven VII: Wo beginnt das Thema?
Gewiss, es ist ein anderer Rhythmus, der diesen Satz beherrscht. Doch auch der, von dem oben die Rede war, kann einen ähnlich obsessiven Charakter annehmen und gerade auf dieses Weise den Gestus des Kampfes merkwürdig transzendieren. Aber das ist einfach gesagt: Joachim Kaiser war es, der überzeugend auseinandergesetzt hat, wie schwer der Satz zu interpretieren ist, wie wenig ihm manche Pianisten oder Komponisten (Strawinsky) abgewinnen konnten („Beethovens Klaviersonaten“ Fischer 1979, 1994 Seite 483f). Um so deutlicher setzt Jürgen Uhde ihn in einen größeren Zusammenhang. Es soll hier in der Kopie nur angedeutet sein, das Buch gehört zumindest in jede Musikerbibliothek:
Quelle Jürgen Uhde / Renate Wieland „Denken und Spielen“ Bärenreiter 1988 Seite 56f
An anderer Stelle (in „Beethovens Klaviermusik III“ S. 355) sagt Uhde:
Schon Riezler verglich solche kraftvollen Gebilde mit Gestalten Michelangelos, die eigentlich fest auf dem Boden stehen müßten, sich aber doch schwebend, also gegen die Schwerkraft, verhalten.
Damit bezieht er sich, wie er sagt, u.a. auf die „Flucht durch die Tonarten im 2. Teil, wie die späteren Triolen, die abseitige Welt des ganz und gar marschfernen Trios.“
Walter Riezler (Beethoven 1936 Seite 239) jedoch sprach allgemeiner vom Spätwerk Beethovens und insbesondere davon, dass „diese Musik auch in Momenten gewaltigster Kraft und Wucht des Ausdrucks mit ‚vergeistigenden‘ Elementen durchsetzt ist. Eines der wichtigsten und häufigsten Geschehnisse hierbei ist, daß die Ganzschlüsse, die der frühere monumentale Stil Beethovens als die tragenden Pfeiler des Baus immer besonders betont, nun sehr oft verhüllt werden.“
Ich zitiere das nur als Andeutung der Schwierigkeiten, die sich beim Hören ergeben, und aus denen eine gewisse Ratlosigkeit resultieren kann, – trotz der durchgehend „revolutionären“, entschlossenen Rhythmen. Ich meine dies als Ermutigung, und nur in diesem Sinne zitiere ich ausgerechnet die folgende Passage aus Joachim Kaisers Buch („Beethovens 32 Klaviersonaten und ihre Interpreten“ / Frankfurt am Main 1979, 1994 Seite 487f):
So leicht, so überschaubar in seiner Dreiteiligkeit der B-Dur-Mittelteil des alla Macia auch ist, so zart eingeschlossen in eine rhythmische Sechzehntel-Figur, die am Anfang und am Schluß als „Vorhang“ erscheint, der aufgeht und wieder zugezogen wird: gerade dieses kurze Musikstück läßt eine Grenze erkennen, von deren Vorhandensein auch mal die rede sein muß. Es ist die Grenze des Verbalisierens musikalischer Phänomene. Wie weit reichen Worte? Kurz und grob: viele Jahre lang hielt ich dieses – gar nicht so ungeheuerlich schwierige, manuell oder intellektuell anspruchsvolle – B-Dur-Stück für reizlos, für langweilig, für höchstens bläßlich hübsch. Ich begriff auch, trotz mannigfacher Interpretationen großer Pianisten und kluger Autoren, Beethovens „dolce“-Vorschriften überhaupt nicht. Heute – die Noten haben sich nicht geändert – begreife ich wiederum nicht mehr, was da eigentlich nicht zu begreifen war. Aber hilft es dem Leser, wenn immer dort, wo ich vor fünfzehn Jahren „trocken“ oder „abweisend-abstrakt“ gesagt hätte, nun – in welchen Wendungen auch immer „innig“, „wunderbar-verhalten-exzentrisch“ umschrieben würde?
 Editio Musica Budapest „EMB Study Scores“
Editio Musica Budapest „EMB Study Scores“
Man höre den 2. Satz der Klaviersonate op. 101, im folgenden Video mit Emil Gilels von 4:19 bis 10:22 (das von Kaiser beschriebene und im Notentext wiedergegebene Trio beginnt bei 7:26).
Wenn sich eine unbezwingliche Lust einstellt, das Gesamtwerk zu hören, was fast unvermeidlich ist, – möglichst ohne weitere theoretische „Indoktrination“ -, könnte ein Kurzleitfaden von Jürgen Uhde nicht unnütz sein:
Ein Zustand des Für-Sich-Seins, ebenso stiller, wie leidenschaftlicher Bewegung, der „innigsten Empfindung“ also, wird durch die Fanfaren „Lebhaft. Marschmäßig“ nicht nur unterbrochen, sondern auch zerstört. Wir wissen nicht, wer oder was hier marschiert, jedenfalls ist es eine sehr mächtige Gegenkraft. „Sehnsucht“ prägt den 3. Satz, sie richtet sich deutlich erkennbar rückwärts auf die sanfte Balance der Ausgangslage im 1. Satz, aber auch schon vorwärts auf das Ziel. Dieses indessen ist nur mit größter Anstrengung, mit höchster „Entschlossenheit“ im Finale erreichbar.
Quelle Jürgen Uhde: Beethovens Klaviermusik III / Reclam Stuttgart 1974 / 1991 ISBN 3-15-010151-4 (Seite 336)
Nachtrag 28.06.2016
Wie konnte ich das nur vergessen: der Rhythmus des „Scherzando vivace“, Streichquartett op. 127, dritter Satz. Ganz am Schluss präsentiert er sich sozusagen als Formel:
Aber man kommt nicht auf die Idee zu behaupten, er sei durch den Anfang der Marseillaise inspiriert. – Was ich heute beim Wiederlesen allerdings übersah, war die Tatsache, das in dem oben wiedergegebenen Auszug aus dem Buch „Denken und Spielen“ auch dieser Satz aus op. 127 zitiert ist. Man muss die Doppelseite nur nach dem Anklicken nach links rücken, damit die rechte Seite sichtbar wird, – beginnend mit dem Zitat aus der „Großen Fuge“ – als von Beethoven gestifteter Topos schwerelosen Marschierens, selbst im ungeraden Takt.
Nachtrag 30.06.2016
Beethovens Lied „Der Kuss“ op.128 (!) s.a. hier
(Z.B. am Morgen ratlos erwachend)
Heute war es etwa die Erinnerung an die gestrige Lektüre der FAZ, Donnerstag, 21. Mai, die Sonne schien, ein starker Wind wehte, der Wald – in 20 Metern Entfernung – stand grün und rauschte, der Buchfink schlug „ohn‘ Unterlass“. Nichts Finsteres. Es war die Überschrift – „Der frechste Dichter aller Zeiten“ – und die Tatsache, dass damit DANTE gemeint ist, und die Schlusszeilen – mit der Kenntnis des ganzen Artikels:
Ein Freudenfest der Sprache, ein Triumph der Poesie über Politik, Poesie und, notabene, Theologie. Als wäre die Dichtung, als wäre die Kunst das einzig Konstante in einer taumelnden Welt.
Und dann am nächsten Morgen Schubert hören (mit Kirschnereit), ein Buch von Georgiades aufschlagen und die Zeilen über Beethoven lesen (‚dona nobis pacem‘), warum er diese Überschrift dafür wählte: ‚Bitte um innern und äußern Frieden‘.
Auch dies erscheint als Folge dieser eigentümlichen Haltung, die das Wort als gegenwärtiges Geschehen, als Handeln auffaßt. Denn wir können sagen: Das Wort entsteht bei dieser Einstellung dort, wo das Ich auf die Außenwelt stößt. Innenwelt kann hier nicht ohne Außenwelt existieren. Dies ist das wesentliche Merkmal der Wiener klassischen Musik, ein nur ihr eigenes Merkmal. Dieser Drang nach Vergegenständlichung des Ich, nach Verinnerlichung der Außenwelt prägte auch die Eigenart von Beethovens Komposition und veranlaßte die Überschrift ‚Bitte um innern und äußern Frieden‘.
Da habe ich also den Katalysator, wissend, dass es an dieser Stelle auf Schubert hinausführen soll, den ich gerade gehört habe, zu dem ich eine schöne Einführung des Pianisten gelesen habe (über die Wanderschaft als Prinzip). Und zugleich ist da dieser Zeitungsartikel über „die Attraktivität der ‚Commedia‘ mit ihrem Jenseitskonzept als Spiegel des Diesseits“:
In den Berlusconi-Jahren wurde Dante fast zum Massenautor, vor allem dank Roberto Benigni. Ich kann nur empfehlen, auf Youtube zu schauen und zu hören, wie Benigni in großen Sälen, auf großen Plätzen Dante sprechend lebendig macht.
Und schon habe ich alles zusammen, was ich brauche, um aus eigenem (?!) Antrieb aktiv zu bleiben. Meine Außenwelt (Dante – aufgrund der Empfehlung von Kurt Flasch, der von FCD als Auslöser genannt wird, mir aber voriges Jahr in Bonn in ähnlicher Funktion begegnet ist), Schubert, Georgiades, ein vorläufig unbestimmbares neueres Erinnerungsfragment, das die Erscheinungweisen von Musik betrifft, die geöffnete Tür, den Wald, den Buchfinken, 1 CD, 1 Zeitungsseite. Der Autor: Friedrich Christian Delius. Merkwürdig genug, dass er auf Dante gekommen war wie ich, aber eigentlich gar nicht so merkwürdig, wenn man dies liest:
Ungelesen, angelesen, achtel- oder halbgelesen, wahrscheinlich gibt es kein Buch in den Regalen der Literaturfreunde in aller Welt, das so selten komplett gelesen wurde wie Dantes „Göttliche Komödie“. Auch ich brauchte mehrere Anläufe. Vier Jahrzehnte lang wollte der goldverzierte 100. Band der Fischerbücherei, den mein Vater, hessischer Landpfarrer und Italien-Freund, in den fünfziger Jahren gekauft und nicht gelesen hatte, von mir aufgeschlagen und gewürdigt werden. Hin und wieder fasste ich Mut, jedes Mal auf den ersten Seiten scheiternd. (…)
Es musste erst Kurt Flasch 2011 mit den zwei großformatigen Bänden, mit seiner präzisen Prosafassung und der „Einladung, Dante zu lesen“ kommen, damit ich die 14 233 Verse noch einmal von vorn und dann bis zum Ende las.
In der Tat ging es mir ähnlich, angefangen von dem 100. Fischer-Buch-Band in den 50er Jahren bis hin zum 13.12.2011, als ich erlebte, wie Kurt Flasch seine neue Übersetzung in der Buchhandlung Böttger in Bonn vorstellte und ich „von Stund‘ an“ das Inferno las.
Und folge FCD weiterhin mit Zustimmung und Anteilnahme:
Aber warum? Die Lektüre bleibt ja strapaziös. Bei aller Begeisterung für poetische Raffinesse, bei aller Bewunderung der Phantasiekraft, bei aller Neugier auf den politischen Dante – es gibt genügend öde Passagen, die uns heutige Leser resignieren lassen. Wir verzweifeln an unserer Unbildung, wir ermüden auf den kosmologischen, philosophischen, mystisch-theologischen Etappen am Läuterungsberg und im Paradies. Warum ich durchhielt, kann ich nur erklären, wenn ich ein Betriebsgeheimnis preisgebe.
Ja, bitte – aber welches denn? Warum geht das Zitat nicht weiter? Damit der Leser, die Leserin selbst, sage ich mir, ähnliche Überlegungen anstellt wie ich, – der ich heute morgen gewissermaßen das gleiche Betriebsgeheimnis – wie so oft – in die Praxis umgesetzt habe. Ich höre Schuberts Sonate a-moll D 845, die ich mir schon Mitte der 50er Jahre in den Noten meines Vaters durchgesehen hatte, später war es die andere, frühere Sonate in a-moll, die ich 1959 gründlich studiert habe (als privater Schüler von Hanns-Ulrich Kuntze in Detmold), mühsam fand ich Zugang – mir erschien sie unnötig schwer – , nur der Ernst des Lehrers vermittelte eine leise Vorstellung davon, dass in der Musik etwas ganz anderes passierte (und passieren musste), als ich ahnte. Aber erst Jahre später (durch das Schubert-Buch von Gülke) begriff ich, dass dies auch in Worten angedeutet werden sollte. Dass dies vielleicht sogar die Voraussetzung sei, zu Schubert vorzustoßen und nicht nur im Vordergrund bei 1000 „schönen Stellen“ stehenzubleiben.
Und auch heute noch geht es mir so, dass ich beglückend finde, wenn jemand, der Schubert wunderbar in klingende Musik übersetzt, zugleich (wie Alfred Brendel) imstande ist, eine Ahnung davon verbal zu übermitteln. Die Anwendung des Betriebsgeheimnisses also heute morgen: Die ebenso einfache wie ohrenöffnende Einführung des Pianisten Matthias Kirschnereit in sein Schubert-Programm zu lesen, zu beherzigen und dann die große Sonate in a-moll von ihm zu hören. Er ist kein effektvoller Redner, was ihn auszeichnet, ist Glaubwürdigkeit:
Mein Klavierlehrer in Windhuk, Namibia, gab mir einst das Scherzo in B von Franz Schubert auf – es sollte das erste Werk des Komponisten sein, welches ich spielte. Ich mochte das kleine Stück: pianistisch nicht sonderlich anspruchsvoll, charmant und heiter – und schon damals faszinierte mich der Umstand, dass der launige Hauptgedanke mal wienerisch behaglich, mal frech und kapriziös daher kommt. Das Erzählen von Geschichten auf dem Klavier hat mich von Anbeginn fasziniert und ich lese hinter den Tönen und Harmonien, Phrasen und Perioden, Seelen- und Naturzustände.
Jahre später erlernte ich während des Detmolder Studiums die a-Moll-Sonate op. 42. Hier bekam ich erstmals eine Ahnung von Schuberts Abgründen, Schuberts Sehnsucht und – von Schuberts Wandern. Ich meine, dass in der Musik Franz Schuberts die Idee des Wanderns ein stilbildendes Charakteristikum darstellt. Dabei ist das Wandern gewiss vielschichtig zu verstehen. Zum einen im wörtlichen Sinne als das Wandern durch Stadt und Land, mal beschaulich, mal rastlos. Zum anderen sehe ich in Schuberts Wandern eine Metapher für die mehr oder weniger permanente Sehnsucht nach glücklicheren Umständen, bis hin zum erlösenden Tod. Besonders eindrücklich manifestiert sich dieses Sujet in den Liederzyklen „Schöne Müllerin“, wo das rauschende Bächlein zum engsten Vertrauten des Protagonisten wird, sowie in der „Winterreise“, wo auch die letzten verbliebenen Hoffnungen zu erfrieren scheinen.
So oder ähnlich hat man es vielleicht oft irgendwo gelesen, aber in dieser einfachen Form – ohne intellektuelles Muskelspiel – und im Zusammenhang mit einer vollkommen glaubwürdigen Interpretation bedeutet es mir als Motivation viel mehr als ein paar Seiten Moments musicaux von Adorno, so sehr ich sie schätze, und in anderen Fällen als Betriebsgeheimnis zu Rate ziehe. – Doch dazu Weiteres von FCD, dem Schriftsteller:
Jeden Morgen vor der Arbeit an einem Prosatext pflege ich mich mit einem Klassiker zu dopen. Zwei, drei Seiten inhalieren, wenige Minuten nur, es kann „Dichtung und Wahrheit“, Jean Paul oder Joseph Roth sein, auch die neuen Übersetzungen der „Kartause von Parma“ oder „Tristram Shandy“, derzeit ist es Jaroslav Hašeks „Die Abenteuer des guten Soldaten Svejk im Weltkrieg“. Mit dem Echo solcher Meisterprosa im Ohr wird es leichter, die Kriterien scharf zu halten und die eigene Sprachmelodie zu finden.
Flaschs Dante half mir 2012 bei der Erzählung „Die linke Hand des Papstes“. Ich arbeitete in Rom, jonglierend mit meinen Erfahrungen, Beobachtungen und Entdeckungen aus zwölf und mehr Rom-Jahren. Da tat es gut, jeden Morgen vor der Arbeit einen Gesang, also rund 140 fein rhythmisierte Zeilen aus der „Göttlichen Komödie“ zu lesen, teils im Original, teils im Flasch, teils im Vezin, mit möglichst wenig Kommentar. Schnell war mit klar, dass Dante mein Verbündeter war.
Was für gute Worte! Genau das möchte ich auch: Franz Schubert zum Verbündeten gewinnen. Nicht unbedingt dank Kirschnereits Interpretation, es begann ja viel früher. Und ich will auch die kleine Ernüchterung nicht unerwähnt lassen, die mir das Werbevideo bereitet, das der Verlag oder die Agentur bereitstellt. Nicht die Worte, die in etwa dasselbe wiedergeben, was der CD-Text des Künstlers schon in aller Kürze bot. Mich interessiert nicht, wie der Künstler einherschreitet oder probeweise die Posen einnimmt, die zu einem nachdenklichen Foto führen mögen. Die Musik bedarf dessen nicht, und der Künstler eigentlich auch nicht. Hier Die Kurzweil der fragmentierten Augenblicke ist es kaum, die den Unschlüssigen zu überreden vermag, sondern vor allem die konzentrierte Beobachtung der langen Wanderung von Sonatenanfang bis Sonatenende. Inbegriffen Momente der Ratlosigkeit und des Zweifels. Nonstop 37 Minuten. Man sollte nicht glauben, mit einem Querschnitt auch nur einen Abglanz dessen wahrzunehmen, was den ganzen Schubert ausmacht. Meine Empfehlung: die CD aufzulegen und zuerst die Sonate von Tr. 4 – 7 zu hören. Anschließend – nach einer Bedenkpause – die drei kleineren Stücke Tr. 1, 2 und 3. Und dann könnte wiederum ein Wort aus Kirschnereits Text den Schlüssel liefern, bevor man sich dem „Rest“ der CD überlässt, ein Wort, bei dem allzu feinsinnigen Schubert-Interpreten das Blut in den Adern gerinnt: „eine der triumphalsten Kompositionen Schuberts überhaupt“ – die Wanderer-Fantasie.
Man vergisst, wie oft sich in seinen bedeutendsten Werken „ein dem Leben zugewandter, ausgelassener und gar verwegen draufgängerischer Schubert zeigt“. Das tragische Klischee ist zu einer Wahrnehmungsbehinderung geworden. Denn das Damoklesschwert des Todes hängt über uns allen, – dass wir es wissen, macht uns zu Menschen – aber worauf es ankommt, ist nicht die ziellose Angst und Ratlosigkeit, sondern die erfüllte Zeit, die wir im Zeichen der Kunst verbringen.
Ein letztes Zitat von FCD, damit ich nicht vergesse, weshalb ich mir z.B. eins seiner Bücher besorgen will (gegensätzliche Rezensionen verkraftend, siehe hier):
Ein spezielles Vergnügen also, im skandalsatten und korrupten Rom den Moralisten Dante täglich zehn Minuten bei seinen Gängen und Visionen zu begleiten, bevor ich daran ging, von den Konflikten eines Fremdenführers zu erzählen, vom Geheimnis der linken Hand des Papstes und vom Coup des Augustinus, die Erbsünde zu erfinden und diese Idee dank Bestechung mit achtzig arabischen Zuchthengsten bei Kaiser und Papst durchzupauken. Vergil und Dante mit größtmöglichem Abstand und Respekt in heiterer Bescheidenheit zu folgen, das kann auch im 21. Jahrhundert kein Irrweg sein.
Endlich hatte ich begriffen: Hier schreibt der frechste Dichter aller Zeiten. Und das nicht nur als Gesellschaftskritiker, der seine politischen Gegener und die Schufte seiner Zeit, Päpste und Kaiser inklusive, stracks in die Hölle befördert. Seine größte Frechheit ist keine politische, sondern eine theologische.
Der Dichter schwingt sich zum Weltenrichter auf. Mit der Fiktion seiner Wanderung durch Inferno, Purgatorio und Paradiso nimmt er, natürlich in frömmster Absicht, Gott die schwere Arbeit des millionen- oder milliardenfachen Menschensortierens ab und entthront ihn, zumindest vorläufig, auch wenn er ihm inbrünstig unterworfen bleibt. Das ist der erheiterndste Widerspruch der Commedia, die zu anderen Zeiten als Ketzerei verfolgt wurde.
Quellen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. Mai 2015 Seite 13 Der frechste Dichter aller Zeiten Wer in die Hölle kommt und wer ins Paradies, entscheidet dieser Poet: Vor 750 Jahren wurde der Weltenretter Dante geboren / Von Friedrich Christian Delius
EDEL Kultur 2012 (Berlin Classics) 0300302BC Franz Schubert Wanderer Fantasie / Matthias Kirschnereit, Klavier
Thrasybulos Georgiades: MUSIK UND SPRACHE Das Werden der abendländischen Musik dargestellt an den Vertonungen der Messe. Springer-Verlag Berlin Göttingen Heidelberg 1954
Nachtrag 1
Angefügt seien ein paar Links zu dem von FCD hervorgehobenen Roberto Benigni: Er rezitiert den ersten Gesang aus dem INFERNO, den Anfang der ganzen Divina Commedia von Dante Alighieri: HIER. Text-Synopse (zum Mitlesen) HIER.
Nachtrag 2 (27. Mai 2015)
Ein Gespräch mit Kurt Flasch in DIE WELT: Hölle, Hölle, Hölle!
Dank an Berthold!
***
Nichts Finsteres. (Zu Pfingsten auf Texel)
Der Eintrag in Beethovens Konversationsheft vom Februar 1822 ist oben im Titel nicht ganz vollständig wiedergegeben. Er lautet:
‚Das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns.‘ Kant!!!
Seit ich diesen Satz kennenlernte, störte mich – über viele Jahre hin – der erste Teil. Weil ich keine Ahnung hatte! Ich unterstellte Beethoven (und Kant) eine blinde Begeisterung für das bloß Edle, allzu Rechtschaffene, beschränkt Menschliche, verknüpft mit dem Unermesslichen. Jetzt freue ich mich, die Selbstauslegung Kants von einem Musiker übermittelt zu bekommen: Thrasybulos Georgiades.
Die Stelle, in der Kant lapidar die Welt des Dinglichen und die Welt des ‚Soll-Tun‘ gegenüberstellt, bezieht sich nicht auf den Kunstbereich, sie steht nicht in der Kritik der Urteilskraft, sondern bildet den Schluß der praktischen Vernunft.
Hier dämmert es einem – allein durch die andere Formulierung und Akzentuierung -, dass Kant tatsächlich zwei extreme Phänomene zusammenspannt. Er hat es selbst aufs Genaueste dargestellt, und Georgiades zitiert diesen „Beschluß“ der ganzen Trilogie der „Kritiken“, – und wir sehen mit Erstaunen: die Reihenfolge ändert sich (zuerst kommt der bestirnte Himmel, das große Außen, dann das unendliche Innen, dessen Strukturen er erforscht hat, die reine, die kritische und die praktische Vernunft) und statt „uns“ steht im Original das – in diesem Fall – bescheidenere „mir“:
Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:
Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. Beides darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Überschwenglichen, außer unserem Gesichtskreise, suchen und bloß vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein meiner Existenz.
Das erste fängt von dem Platz an, den ich in der äußeren Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich-Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer.
Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit, an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spürbar ist, und mit welcher (dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren Welten) ich mich, nicht wie dort, in bloß zufälliger, sondern allgemeiner und notwendiger Verknüpfung erkenne.
Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten (einem bloßen Punkt im Weltall) wieder zurückgeben muß, nachdem es eine kurze Zeit (man weiß nicht wie) mit Lebenskraft versehen gewesen.
Das zweite dagegen erhebt meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlich, durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart, wenigstens so viel sich aus der zweckmäßigen Bestimmung meines Daseins durch dieses Gesetz, welche [welches?] nicht auf Bedingungen und Grenzen dieses Lebens eingeschränkt ist, sondern ins Unendliche geht, abnehmen läßt.
Quelle Immanuel Kant „Kritik der praktischen Vernunft“, zitiert nach Thrasybulos Georgiades: „Nennen und Erklingen“ Sammlung Vandenhoeck Göttingen 1983 (Seite 289 f Anmerkung 535).
Die Unterteilung durch Absätze stammt von mir, aus dem Original nachgetragen habe ich die kursive Schrift bei bestimmten Worten: z.B. tierischen Geschöpfs, Intelligenz, die von mir in eckigen Klammern eingefügte Frage [welches?] kann nach dem Blick ins Original gestrichen werden, das Wort bezieht sich also auf „Bestimmung“, – was allerdings von uns selbst klar begründbar sein sollte. Ebenso wie Satz für Satz dieser ganze „Beschluß“ – der übrigens samt wichtigem Nachfolgetext hier mit einem Klick aufzufinden ist. Woraus am Ende sonnenklar hervorgeht, dass mit dem „moralischen Gesetz in mir“ nichts anderes als die Ausübung der Philosophie gemeint ist.
Kein Wort über die zuversichtliche Grundhaltung einer vergangenen Zeit, die man „Idealismus“ nannte, weil sie sich auf Ideen bezog; nicht etwa, weil sie die Materie leugnete. JR.
Nachtrag 29. März 2015
Rechtzeitig kommt die Erinnerung an Rüdiger Safranskis Buch über „Das Böse oder das Drama der Freiheit“. Da kommt er gegen Ende auf das große Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755. Nach wie vor sehr lesenswert: Die gleiche Situation, die seit Menschengedenken immer wiederkehrt (nur mit dem Unterschied, dass man heute über jede einzelne auf jedem Punkt des Globus bis ins Detail unterrichtet wird), und die Menschen wissen keinen anderen Rat, als Kerzen anzuzünden und Schildchen aufzustellen mit der Aufschrift WARUM? Und nach wie vor geht es im Grunde um die Frage der Theodizee.
Damals wie heute kann man nur antworten:
Die Natur ist keine Quelle der Moral, und um die anderen Moralquellen, die im Menschen selbst entspringen, steht es auch nicht gut. (Seite 311)
Nach Voltaires „Candide oder der Optimismus“ hatte Kant 1791 seine Schrift veröffentlicht: ÜBER DAS MISSLINGEN ALLER PHILOSOPHISCHEN VERSUCHE DER THEODIZEE.
Kants Hauptwerke – die großen KRITIKEN – waren zu diesem Zeitpunkt schon erschienen. Und es war klar, wie Kant bei diesem Theodizee-Tribunal eigentlich plädieren müßte: nämlich auf Nichtbefassung. Die menschliche Vernunft ist – das war ja ein Ergebnis der KRITIK DER REINEN VERNUNFT – damit überfordert, sich den Kopf des ‚Welturhebers‘ zu zerbrechen, so wie es Leibniz getan hatte. (S. 311 f)
Und Safranskis Buch über DAS BÖSE endet mit dem seltsamen Hinweis auf Kants „Pflicht zur Zuversicht“, an den ich mich erinnerte, als ich den Schlusssatz oben schrieb (über die zuversichtliche Grundhaltung einer vergangenen Zeit, die man „Idealismus“ nannte):
In prekären Situationen, sagt Kant einmal, gibt es eine Art Pflicht zur Zuversicht. Sie ist der kleine Lichtkegel inmitten der Dunkelheit, aus der man kommt und in die man geht. Eingedenk des Bösen, das man tut und das einem angetan werden kann, kann man immerhin versuchen, so zu handeln, als ob ein Gott oder unsere eigene Natur es gut mit uns gemeint hätten.
Er ist ein Minimum von Ermutigung, – aber besser als nichts.
Quelle Rüdiger Safranski: Das Böse oder Das Drama der Freiheit. Fischer Taschenbuch Verlag Frankfort am Main 4. Auflage 2001 (Carl Hanser 1997)
Und da wir hier beim „Lichtkegel“ der Zuversicht geendet sind, könnten wir gleich in Safranskis späterer Schrift weiterlesen, wo allerdings von einem anderen Licht die Rede ist:
Das Licht am Ende des geschichtlichen Tunnels hat sich als Irrlicht erwiesen Der real existierende Sozialismus war nicht die große Befreiung, sondern ein graues und grausames Völkergefängnis, terrorisiert oder bevormundet von einer ideologischen Elite. (…) Das Vertrauen in die angeblich objektive Dynamik einer Fortschritts-Geschichte ist bitter enttäuscht worden. Soviel zum Vertrauen in die Logik des Außen.
Und was das Innen betrifft – die Vorstellungen Rousseaus also, wonach das wahre Selbst zum Muster der Vergesellschaftung werden sollte -, so hat sich gezeigt, daß dieses Konzept zur Verfeindung mit der Pluralität, mit den vielen Freiheiten, führt. Die Lichtung des einen wird zur Verfinsterung für die anderen. Soviel zum Vertrauen in die Logik des Innen.
Es kommt wohl doch darauf an, daß man eine Lichtung findet, weder ganz innen, wie bei Rousseau, noch ganz außen, wie bei Marx.
Quelle Rüdiger Safranski: Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Fischer Taschenbuch Verlag 2. Auflage März 2006 (Hanser 2003) Zitat Seite 106 f.
Über den Begriff der „Lichtung“ müsste man an Ort und Stelle nachlesen, ebenso über den Stellenwert der Kunst (womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären: Beethoven nach Georgiades) – und schließlich das Umfeld der folgenden Sätze:
Nicht nur der Körper, auch unser Geist braucht einen Immunschutz; man darf nicht alles in sich hineinlassen, sondern nur soviel, wie man sich anverwandeln kann. Die Logik der kommunikativ vernetzten Welt aber ist gegen den kulturellen Immunschutz gerichtet. In der Informationsflut ist man verloren ohne ein wirkungsvolles Filtersystem. (…) Wer sich dem Kommunikationszwang nicht beugt, müßte sich von dem Ehrgeiz befreien, immer auf der Höhe der Zeit und an der Spitze der Bewegung zu sein. Nicht ans Netz gehen zu müssen, ist fast schon ein Privileg, ebenso wie in die Nähe sehen zu können, statt Fernsehen. Wir müssen wieder, sagt Nietzsche, gute Nachbarn der nächsten Dinge werden. (a.a.O. S. 111 f)
Quelle wie vorher
Noch etwas zur „Abwehr des gestirnten Himmels“ findet sich bei Hans Blumenberg:
Alle Formationen des Deutschen Idealismus bis zum Neukantianismus interpretiert Blumenberg als hochmütige Abwehr des gestirnten Himmels der physikalischen Kosmologie: Entweder finde das physische Weltall mit seinen Milliarden Sternen in diesen Philosophien überhaupt keine Beachtung, weil die Gegenstände unserer näheren Umgebung als die Prototypen des Wirklichen gälten, oder aber das Ganze der Wirklichkeit werde rückgebunden an ein weltkonstituierendes Subjekt, das nicht mehr innerhalb des Ganzen stehe, sondern vielmehr dem Ganzen gegenüberstehe. Selbst wo sich der Deutsche Idealismus, wie etwa bei Schelling, dem physischen Weltall öffne, halte er es offenbar für unerträglich, „den Menschen nicht in der Mitte einer konzentrisch auf ihn gerichteten Realität zu sehen“ (GKW, 98). So sei Schelling stets um den Nachweis bemüht gewesen, daß der Mensch das Ziel der Weltentwicklung und in diesem Sinne alles des Menschen wegen entstanden sei. Dabei sei der Weg der Naturentwicklung vom Weiten ins Enge und vom Häufigsten zum Seltensten verlaufen. Solcher Naturdeutung zufolge macht die Übergröße der Welt nicht so sehr die Nichtigkeit des Menschen sichtbar, als daß sie vielmehr umgekehrt dessen Einzigartigkeit hervorhebt (…). Denn ist menschliches Leben auch nicht die herrschende Regel im All, das aus einem Feld unbeseelter, zielloser Kräfte besteht, so ist es doch die Ausnahme, deren Einzigkeit um so mehr hervorleuchtet, je breiter der Hintergrund ist, von dem es sich abhebt. Allerdings wird hierbei vorausgesetzt, daß das Seltene bereits das Kostbare ist. (…)
Quelle Franz Josef Wetz: Hans Blumenberg zur Einführung Junius Verlag Hamburg 2004 (Seite 85) Kapitel „Der Weltraum – ein Alptraum“.
Zwei Einleitungen
Handzettel zum Lesen bitte anklicken!
Es sind die Anfänge der beiden unten angekündigten Vorträge, die ich hier zum Nachlesen hinterlegen möchte, um sie an Ort und Stelle überspringen zu können; es genügt, nachher neugierig darauf zu sein. Der eine hat mehr mit Jerusalem und dem kulturellen Dilemma (oder Trilemma?) im Nahen Osten zu tun, der andere mit der Rolle der Vögel und „indischer“ Rhythmen in Messiaens Werk „Couleurs de la cité céleste“.
I
Man könnte meinen, das Bewusstsein der Alterität entstehe durch Entzweiung, durch Abtrennung des Anderen vom Eigenen, man triff eine Unterscheidung, sieht das Andere als Gegenüber, als Gegner, als Objekt, und schon hat man ein Problem. Simone de Beauvoir schrieb 1949 „Le deuxième sexe“, es wurde nie anders übersetzt als mit den Worten „Das andere Geschlecht“.
Und dann entdeckte man, dass das Andere im Eigenen steckt, selbst das Böse ist nicht außen, sondern in uns. Über Jahrhunderte wollte man lieber Gott allein in uns sehen, oder wenigstens auf der eigenen Oberfläche, auf uns als seinem Ebenbild.
West-östliche Weltgegensätzlichkeit, Denken in Ost und West, – man kam zum Beispiel nicht auf die Idee, den Süden einzubeziehen, ich glaube, Jan-Heinz Jahn war 1949 mit seinem Buch „Muntu – Umrisse einer neoafrikanischen Kultur“ der erste, der auch „die“ afrikanische Kultur als Komplex eigener Art behandelte, zwar auf zwei Komponenten aufbauend, jedoch nicht Ost und West, – der Osten spielt in diesem Buch keine Rolle -, sondern auf der europäischen und der traditionell-afrikanischen.
Ich spare mir an dieser Stelle weitere Ausführungen über theologische Trinität (und ihre Rolle bis in die Philosophie Hegels) oder über die umstrittene Realität der Heiligen Drei Könige, von denen angeblich einer schwarz war. (Die Bibel weiß davon nichts.) Die Rolle der Königin von Saba, – wer ist das weibliche Wesen, das in Monteverdis Marienvesper sagt: „Nigra sum sed formosa“. Oder nehmen wir Monteverdis „Combattimento die Tancredi e Clorinda“, textlich ein Ausschnitt aus Torquato Tassos „La Gerusalemme liberata“. Wenn Sie sich den Gesamtzusammenhang der Geschichte in diesem Epos anschauen, sehen Sie, was für eine Mühe sich der Dichter gegeben hat, aus der Frau, die auf sarazenischer Seite kämpfte (und Tancreds Geliebte war), um jeden Preis – jedenfalls auch um den Preis einer mit unglaubwürdigen Wundern durchsetzten Vorgeschichte – eine Weiße zu machen, obwohl sie aus äthiopischem Königshaus stammte und somit – dank der (schwarzen) koptischen Kirche – gewissermaßen von Geburt aus eine (wenn auch verhinderte) Christin war.
Es ist ein schwieriges philosophisches Umfeld. Mit Blick auf Rousseau, Kleist und Nietzsche sagte Rüdiger Safranski: „Die Verinnerlichung soll die bedrohliche Macht des Äußeren brechen. Das ‚Äußere‘ ist für Rousseau, Kleist und Nietzsche jeweils etwas anderes. Aber für alle drei ist es jene ‚Welt‘ dort draußen, in der sie sich mit ihren innerlichen Selbstverhältnissen gänzlich fremd fühlen.“ („Wieviel Wahrheit braucht der Mensch?“ 1993 Seite 86)
Heute, sagt der Philosoph Byung-Chul Han, gebürtiger Koreaner, in Berlin lebend, heute befinden wir uns in einer ganz anderen gesellschaftlichen Konstellation:
„Sie zeichnet sich durch das Verschwinden der Andersheit und Fremdheit aus. Die Andersheit ist die Grundkategorie der Immunologie. Jede Immunreaktion ist eine Reaktion auf die Andersheit. Heutzutage aber tritt an die Stelle der Andersheit die Differenz, die keine Immunreaktion hervorruft. Die postimmunologische, ja postmoderne Differenz macht nicht mehr krank. Auf der immunologischen Ebene ist sie das Gleiche. Der Differenz fehlt gleichsam der Stachel der Fremdheit, der eine heftige Immunreaktion auslösen würde. Auch die Fremdheit entschärft sich zu einer Konsumformel. Das Fremde weicht dem Exotischen. Der Tourist bereist es. Der Tourist oder der Konsument ist kein immunologisches Subjekt mehr.“ (Müdigkeitsgesellschaft 2010 Seite 9)
Ich glaube aber nicht, dass das Fremde dem Exotischen weicht. Es verlagert seinen Standort und ist nicht mehr deutlich identifizierbar. Es heißt dann Naivität, Banalität, Langeweile, Missverständnis, Schweigen. Und sowieso liegt der Fall ganz anders, wenn es um Musik geht: das Auge können Sie abwenden und wandern lassen, mit deutenden projizierenden Gedanken vermischen, das Ohr können Sie letztlich nur physisch außer Hörweite tragen. 5 – 10 Minuten funktioniert Ihr Exotismus vielleicht einwandfrei, dann aber nervt die reale Präsenz. Schwieriger wäre es vielleicht nur noch, eine Speise zu akzeptieren, die Sie ekelhaft finden. Toleranz genügt nicht: Sie sollen ja – unter dem bedrohlichen Blick der Gastfreundschaft – genießen!
II
Wenn Sie sich an Beethovens Fünfte erinnern und an die Zeiten, als über das Anfangsmotiv noch gesagt wurde, „so schlägt das Schicksal an die Pforte“, – hat es Sie da gestört oder gefreut zu erfahren: es war ein Meisenruf, der ihn inspiriert hat? Er hat nur eine winzige Veränderung vorgenommen: aus zi-zi-bä hat er zi-zi-zi-bä gemacht und eine Portion Pathos dazugegeben.
Angenommen es war so: hat es noch irgendeinen Sinn, an die Meise zu erinnern?
Glauben Sie, dass sich Beethoven an einen Bach setzen musste um zu wissen, wie man das Gemurmel in Töne fasst? Sie kennen die bekannte Zeichnung von Johann Peter Lyser, und die danach mit bunten Details angereicherte Schweizer Lithographie, Phantasiegebilde, Mythenbildung übrigens 30 Jahre nach der Komposition, ebenso wie Anton Schindlers Hinweis auf einen bestimmten Bach zwischen Nussdorf und Grinzing, von dem Beethoven erzählt habe:
„Hier habe ich die Szene am Bach geschrieben, und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert.“ Phantasiegebilde. Dank Händel, Gluck, u.a. wusste damals wohl jeder, welche musikalischen Elemente zu einer friedlichen Landschaft passen.
Wenn Sie beliebige Bemerkungen von Olivier Messiaen zum Vogelgesang lesen, wissen Sie: er meint es ernst, er meint es geradezu ornithologisch. Und letztlich ist es diese Haltung, die ihn im Kontext der Neuen Musik diskutabel machte. Sagen wir: die gründliche Methodik, die hinter die bloß abbildbare Erscheinung zu führen schien. Um das rein Illustrative konnte es nicht gehen. Sagen wir – so wie in Ottorino Respighis „Pini di Roma“, deren dritter Satz überschrieben ist: I Pini del Gianicolo. Ich zitiere: „Ein Zittern geht durch die Luft: in klarer Vollmondnacht wiegen sanft ihre Wipfel die Pinien des Janiculums. In den Zweigen singt eine Nachtigall.“ Und dazu verlangte er die Schallplatte Nr. 6105 der Firma Deutsche Grammophon „Il canto dell‘ usignolo“. Ich vermute, dass den meisten von uns dabei unbehaglich zumute wird; man verlangt nach Kunst oder der reinen unvermischten Natur. Man kann sich auch vorstellen, ein Touristikunternehmen führt Sie im Spätherbst durch die Herrenhäuser Gärten und lässt aus allen Büschen per Lautsprecher Nachtigallen tönen. (Wie Fahrstuhlmusik in Tokioter Hotel-Giganten.) Aber auch wenn die Jahreszeit stimmen würde, wäre es noch längst nicht das, was uns Natur unmittelbar zu sagen hätte. Paul Valéry meinte: „Keine Anschauung ist naiver als diejenige, die alle dreißig Jahre zur Entdeckung der Natur führt. Es gibt keine Natur.“
Es heißt, die literarische Moderne begann in Frankreich mit einer „durch den Siegeszug von Technik und Naturwissenschaft verursachten ‚Abwertung des Natürlichen‘ zugunsten einer ästhetischen Aufwertung des Artifiziellen. Charles Baudelaire hatte seine „Fleurs du Mal“, die ihm ein Gerichtsverfahren wegen Verletzung der öffentlichen Moral einbrachten, noch nicht herausgebracht, als er Ende 1853 einen provokativen Brief an den Schriftsteller und Kunstkritiker Fernand Desnoyers schrieb:
„Mein lieber Desnoyers, Sie erbitten sich Verse für ihren kleinen Band, Verse über die Natur, nicht wahr? Über die Wälder, die großen Eichen, das Grün, die Insekten, – über die Sonne gewiß auch? Aber Sie wissen doch, daß ich unfähig bin, mich an pflanzlichen Gewächsen zu erbauen und daß meine Seele gegen die merkwürdige neue Religion revoltiert, die – wie mir scheint – für jedes spirituelle Wesen immer etwas Schockierendes hat. Ich werde niemals glauben, daß ‚die Seele der Götter in den Pflanzen wohnt‘, und selbst wenn sie dort wohnte, würde mich das nicht sonderlich beeindrucken und würde ich meine eigene Religion als ein höheres Gut schätzen als die der geheiligten Gemüse. Ich habe vielmehr immer gedacht, daß die blühende und sich erneuernde Natur etwas Schamloses und Widerwärtiges an sich habe.“ (Nach Roland Schmenner „Pastorale“ 1998 , dieser nach Hans Robert Jauß “Kunst als Anti-Natur“ 1989 S.133-154 s.a. )
Es ist wahrscheinlich, dass Baudelaire hier gegen eine Haltung polemisiert, – eine „neue Religion“ wie er sagt – , die heute niemand im Ernst proklamieren oder verteidigen will, [vor allem nicht in den Grenzen der Neuen Musik].
Um es ganz genau zu wissen, habe ich seit den 90er Jahren immer wieder versucht, das grundlegende Buch „Eine Ästhetik der Natur“ (1991) von Martin Seel zu Rate zu ziehen, der allerdings auch sofort den Gegenstand an sich in Frage stellt: „die Natur“ – was ist das denn? Oder – anders gefragt: „Die Natur als Gegenstand ästhetischer Wahrnehmung“ – können wir das leichter definieren? Seel: „Ihr Gegenstand ist derjenige sinnlich wahrnehmbare Bereich der lebensweltlichen Wirklichkeit des Menschen, der ohne sein beständiges Zutun entstanden ist und entsteht.“ (Seite 20)
Ich will die grundsätzlichen Erörterungen nicht weiter ausbreiten, nur dies noch: Drei Aspekte hebt Seels Bestimmung hervor: „erstens die dynamische Eigenmächtigkeit, zweitens die sinnliche Wahrnehmbarkeit, drittens die lebensweltliche Anwesenheit der Natur.“ Und nun arbeitet Seel alle Bereiche ab, „Natur als Raum der Kontemplation“, „Natur als korrespondierender Ort“, „Natur als Schauplatz der Imagination“ undsoweiter, – irgendwann frage ich: wo ist die akustische Natur repräsentiert, von der man nicht unbedingt Abstand gewinnen kann, wie von visuellen Gegebenheiten? Ich meine nicht das Rauschen des Meeres oder den Wind in den Zweigen. Seel ist sich natürlich bewusst, dass man die Natur nicht nur wie durch ein Fenster als Bild betrachten kann. „Auch müssen es gar nicht Werke der Malerei sein, deren Kunst die scheinbare Kunst der Seelandschaft zum Vorschein bringt. Erneut kann ich das Fenster öffnen – und diesmal ein aus Naturlauten (und den von den Terrassen der Mensa herklingenden) menschlichen Stimmen komponiertes Hörspiel vernehmen oder aber, bei kühlerem Wetter und anderer Windrichtung, mich in das Außengeräusch versenken als wäre es meditative Musik.“ (Seite 235)
Dies ist fast das einzige Mal, wo diese Laute, die für Messiaen ALLES bedeuten, in Seels Theorie eine Rolle spielen. Zweimal ist von einem Vogellaut die Rede, auf Seite 248 am Beispiel eines Satzes von Peter Handke:
„Für einen Augenblick kann es sein, als sei dieser Himmel sogar das Lebens-feindliche hier, so sehr, daß der winzige Vogel, kaum fingerkuppengroß, der jetzt aus dem Gestrüpp in die Höhe schießt, auf der Stelle, angstquiekend, kopfüber, zurück in sein Obdach taucht.“ (Handke Die Abwesenheit 1987, 129)
Das andere Mal, auf Seite 203 verweist Seel auf die Atmosphäre um eine blühende Hecke bei Marcel Proust: „Inmitten der von leiser Komik durchwirkten, von züngelnder Unfaßlichkeit bedrohten, von melancholischer Erinnerung wachgehaltenen Idylle ertönt plötzlich der Laut eines Vogels, der seine Stimme bei Proust wie bei Handke vergeblich gegen die Leere des Pascalschen Raumes erhebt: ‚In halber Höhe eines nicht zu ermittelnden Baumes war ein unsichtbarer Vogel bemüht, sich den Tag zu verkürzen; mit einem lang angehaltenen Ton versuchte er die Einsamkeit auszuloten, aber er erhielt eine so klare Antwort, eine Resonanz aus nichts als Schweigen und tiefer Ruhe, daß es schien, als hielte er nun für immer den Augenblick fest, den er eben noch versucht hatte, schnell zum Enteilen zu bringen.‘
Die Stimme des unsichtbaren Vogels bringt in der vorwiegend schönen Einheit der Natur jene Raumunsicherheit zur Geltung, die das Kennzeichen einer vorwiegend erhabenen Gesamtnatur ist.“ …konstatiert Martin Seel.
(Seel Seite 203, Proust Combrai 1967,184)
Um es kurz zu machen: das ist zu wenig! Ich finde nur noch eine Fußnote, die in Richtung des Problems weist, das Messiaens Vogelmusik betrifft. Martin Seel spricht über die „Heiterkeit“ einer Seenlandschaft und weiß natürlich, dass die Landschaft kein heiter gestimmtes Subjekt ist, also fügt er hinzu: „Trotzdem können einzelne Naturgegenstände so wahrgenommen werden, als ob sie ‚Charaktere‘ im engeren Sinne wären. Aber diese Wahrnehmung ist nur eine unter anderen Formen der Korrespondenz und keine, die konstitutiv für sie wäre. Ihr Gegebensein ist nicht an die Fiktion einer kommunikativen Beziehung zur Natur gebunden.“
Ich will das gar nicht im Detail interpretieren, bemerkenswert, dass der Einwand, den ich bringen würde, nur in einer Fußnote berührt wird: die Tiere nämlich, – er räumt ein: dass „das kommunikative Verhältnis zu Tieren nicht notwendigerweise eine Fiktion ist. Wir können mit Tieren in einer ganz unmetaphorischen (allerdings der zwischenmenschlichen Verständigung gegenüber abkünftigen) Bedeutung kommunizieren – freilich nur mit denen, die mit uns leben.“ (Seel Anm.37 S.118f)
Ein Satz, der ganz und gar nicht einleuchten muss. Von der Kommunikation mit Tieren ist die Rede – und zwar im nicht metaphorischen Sinn -, sie sei von der zwischenmenschlichen Verständigung ableitbar bzw. rückgeschlossen (das ist offenbar mit dem Wort „abkünftig“ gemeint). Und dann folgt die äußerst merkwürdige Einschränkung: „freilich nur mit denen [also Kommunikation nur mit den Tieren], die mit uns leben“. Sind jetzt nur Haustiere gemeint, mit denen wir kommunikativ abgestimmt sind? Nicht aber die draußen im Baum singende Schwarzdrossel, deren Kommunikation ich zweifelsfrei erkenne, wenn sie auch nicht mir persönlich gilt, sondern Wesen ihresgleichen?
Verschiedene Zeitungen berichteten kürzlich (12.12.2014) über die Ergebnisse eines international koordinierten Forschungsunternehmens. Ich zitiere die Süddeutsche:
Ausgangspunkt für das genetische Riesenprojekt war die Frage, welche Gene Vögel brauchen, um singen zu lernen. Eine der großen Überraschungen ist nun die Erkenntnis, dass sich der Gesang wohl gleich dreimal in den verschiedenen Entwicklungslinien der Singvögel, der Kolibris und der Papageien ausgebildet hat. Die dafür zuständigen Gene sorgen beim Menschen für das Sprachvermögen und könnten auch bei anderen Tieren an unterschiedlichen Lernvorgängen beteiligt sein. Bislang war bereits klar, dass sich auch die Hirnstrukturen, die für das Singen bei Vögeln und das Sprechen beim Menschen zuständig sind, stark ähneln. Eine weitere Studie zeigt zudem, dass das Singen einen steuernden Einfluss auf 10 Prozent der Vogelgene hat – und liefert damit einen Hinweis darauf, wie das Verhalten eines Tieres und seine Erbanlage sich gegenseitig beeinflussen können.
Aber ich will nicht versuchen, die möglichen Folgerungen zu durchdenken, nur soviel, dass der Graben zwischen Mensch und Tier, den die Philosophie und die Theologie zwischen Mensch und Tier sieht, sich zunehmend abflacht, wenn man die moderne Evolutionswissenschaft und – sagen wir – unsere ’natürliche‘ Empathie ernst nimmt. (Marian Stamp Dawkins: Die Entdeckung des tierischen Bewusstseins, 1994).
Ich bin hier nicht zur Verteidigung der Natur und der Tiere angetreten. Sondern im Zeichen des Vogelfreundes und Komponisten Olivier Messiaen.
(Irreführende) Darstellung Beethovens bei der Komposition der Pastorale; Lithographie aus dem Zürcher Almanach der Musikgesellschaft, 1834 (hier nach Wikipedia)
Zu den Abbildungen ganz oben: Titelfoto „Himmlisches Jerusalem“, Kirchenfenster in St. Michael Marl, Entwurf: Trude Dinnendahl-Benning, Foto: Hubert Decker
Vorgespräch mit Prof. Walter Nußbaum

Tragetasche einer unbekannten Zuhörerin
Einstimmung auf Messiaens Vogelstimmen
Fotos: E.Reichow
Aber womit beginnen?
(Natürlich, ich weiß es, schiebe es beiseite, um Ersatzhandlungen auszuführen, „Übersprung“ oder wie heißt es, das Hauptthema kann noch ein paar Stunden warten. Oder Tage?)
Zunächst also die Presse, die für soviel Anregung oder auch Aufregung sorgt. Die Themen müssen knapp sein, wenn Beethoven ins Zentrum der Seite „Wissen“ rückt. Nein, auf die rechte Seite, links pariert der Artikel „Wenn Frauen zur Nixe werden. TREND Wasserliebende Mädchen und Frauen tauschen ihren Badeanzug gegen Bikinioberteil und Fischschwanz.“ Bravo, gut für „Beethovens Werkstatt. Wie das Genie mit den Noten kämpfte“. Links unten: „Schon Ahnen des Menschen konsumierten Alkohol. STUDIE Biologen analysieren Enzym zum Alkoholabbau.“ Gottseidank, der Abbau funktioniert bis heute! Aber wie lange dauert es jeweils? Tage oder Wochen? Tage und Zeilen?
Also, hier muss auf jeden Fall noch der Link zum Beethoven-Haus folgen, damit ich die Original-Skizzen studieren kann. Auch das nimmt Zeit! Es kann dauern!!! Dann die Frage, ob ich die Klassik nicht naiv überbewerte. Oder vielmehr grotesk unterbewerte. Der neue Link liegt mir vor. Aber noch fällt mir dazu nur ein, wie man (ich?) einst über die Liebe dachte: der Gegenstand der Liebe sei so heilig, dass man ihn nie und nimmer berührt. Was für ein unvergessliches Kapitel in der Werk-Einführung zu Robert Musil von Kaiser/Wilkins (1962), ich meine über die „Fernstenliebe“ oder so. Oder Goethes oder Philines „Wenn ich dich liebe, was geht’s dich an.“ Beginne ich einfach mit dem Titel „Aufbruchsstimmung“ und danach endlich weiter in Moritz Eggerts Blog-Folgen. (Fortsetzungen eventuell später hier eruieren.)
Neben diese Symptome einer resignativen Dekadenz trat zeitgleich um die Jahreswende eine Aufbruchstimmung, die für den „neuen Menschen“, wie er in Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ angekündigt worden war, eine geistige und körperliche Befreiung von bisher geltenden Normen bedeutete. Vor allem Künstler suchten nach neuen Lebensformen unabhängig von gesellschaftlichen Zwängen und gruppierten sich in Gemeinschaften, um ein Leben im Einklang mit Natur und Kunst führen zu können. Damit verbunden war häufig ein neues Bewußtsein für den Körper, der nun nicht mehr in Kleidern versteckt und deformiert werden sollte, sondern sich in Licht und Luft bewegen durfte; der menschliche Körper wurde als ausdrucksstarkes Sprachorgan entdeckt. Die Freikörperkultur und der Ausdruckstanz nahmen hier ihren Ursprung. Hinzu kam die Weiterentwicklung der Fotografie sowie die Entstehung des Films um 1999, die eine Fixierung von Bewegungsabläufen ermöglichte und eine neue Wahrnehmungsästhetik einleitete.
Ich halte erschrocken inne: meine Zitattechnik im Neuen Jahr grenzt an Fälschung. Ich vertraue auf meinen Leser, der ich vor allem selbst bin und bleiben werde. Ich habe Zeit, meine Quellen offenzulegen. Monate, Jahre! (Nur nicht warten, bis ich alles vergessen habe.) Die Sache mit der Freikörperkultur gehört natürlich zu dem Artikel über den Bikini „Wenn Frauen zur Nixe werden“. Ich halte meinem Tageblatt die Treue! Schon wegen der blauen Zeile: „Im Wasser ist man geschmeidig, man bleibt unberührbar“. Es lebe die Soziologie! Ein Neujahrsbrief hat mir Neues über Adornos Charakter gebracht, – ich möge bitte Peter Sloterdijk lesen: Zeilen und Tage. Seite 157 f („In der Frankfurter Rundschau findet sich ein Artikel, der an Golo Manns Rückkehr aus dem Exil erinnert. Im Jahr 1963 sollen Horkheimer und Adorno“ usw. usw. vonwegen, – werde ich denn alles vorwegnehmen?)
Ein Autograph der Kreutzer-Sonate studieren? Hier! (Unter „Beethoven-Haus Bonn, NE 86“ oben weiterblättern 1-13 !)
Quellen
Solinger Tageblatt 5. Januar 2015 Seite 22
Stefanie Lieb: Was ist Jugendstil? Eine Analyse der Jugendstilarchitecktur 1890-1910 WBG Darmstadt Sonderausgabe 2010 ISBN 978-3-534-23652-7 Zitat Seite 15 (absichtliche Errata: Jahreswende statt Jahrhundertwende und 1999 statt 1900 JR).