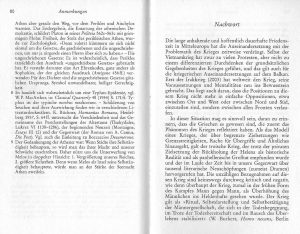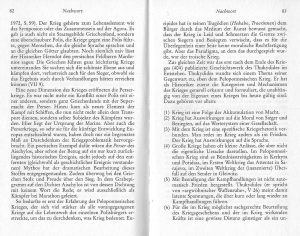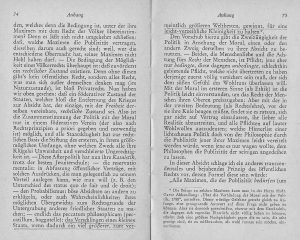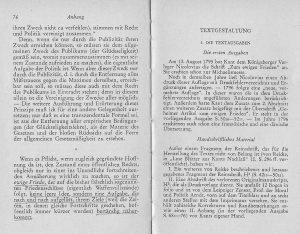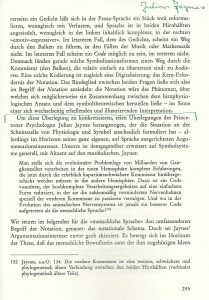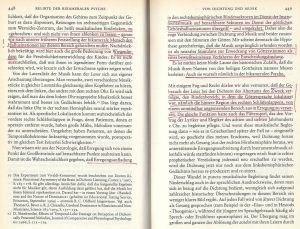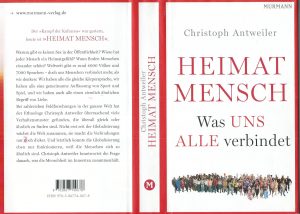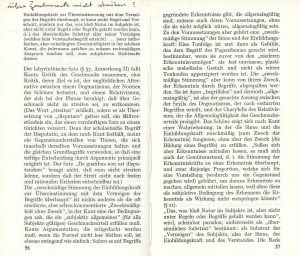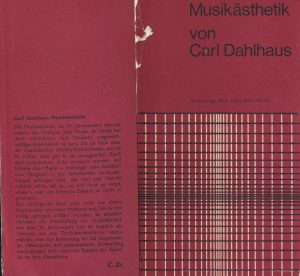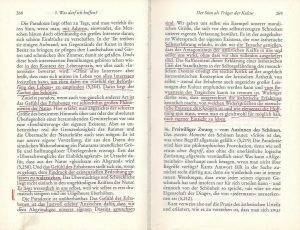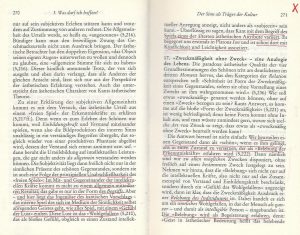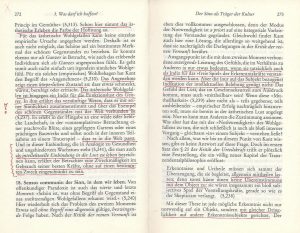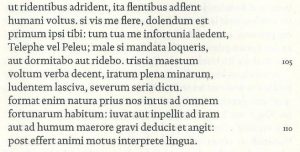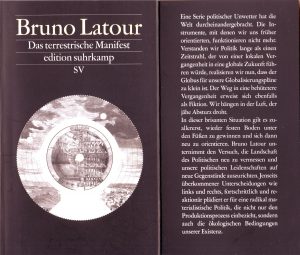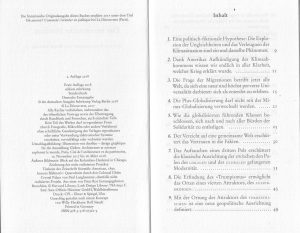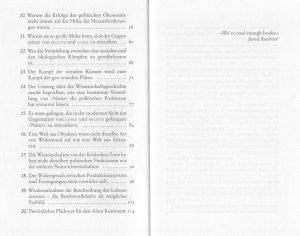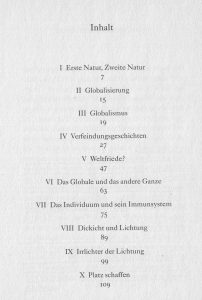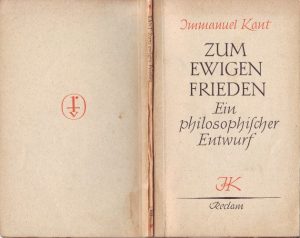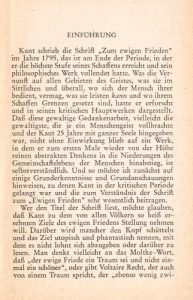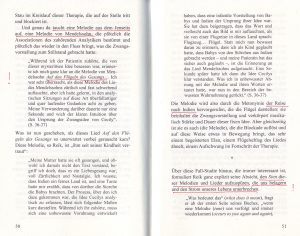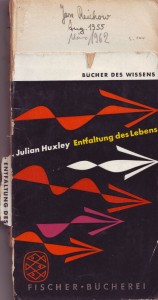Wann ist denn Pfingsten?
Manchmal scheinen die Lösungen greifbar nahe, ja, der Heilige Geist liegt auf der Hand. Während man keinem Artikel Glauben schenkt, der darüber in den Zeitungen steht (wenn überhaupt). Mir ging es so, als ich heute aufwachte: ich habe im Laufe der Jahre 1000 Blogbeiträge nebeneinandergestellt und oft auch aufeinander bezogen, um womöglich eines Tages ein Netz von Beziehungen zu überschauen, während ich gleichzeitig befürchtete, das Wichtigste darüber dann doch noch zu vergessen. Wollte ich in Wirklichkeit vielleicht die Komplexität der Welt für mich (sträflich) vereinfachen? Möglichst in einer Nussschale. Eine sogenannte Welt-Anschauung? Und die Musik, die es so schlagend fertigbringt, könnte sich mit der Philosophie verbinden, verbünden – es wäre zu schön um wahr zu sein. Ich will es mal formelhaft zusammenfassen, nur als Beispiel:
 Kant 1795 / Thukydides 400 v.Chr.
Kant 1795 / Thukydides 400 v.Chr.
 das Buch (1869), der Film (1956), Hondrich
das Buch (1869), der Film (1956), Hondrich
Darin müsste alles enthalten sein. Es genügt nicht, über den Angriffskrieg zu lamentieren und die pazifistische Utopie dagegenzusetzen. Die missglückte Lanz-Sendung kürzlich hat es peinlich vor Augen geführt.
Hondrich prägte sich mir ein, weil er (als einziger) den Krieg – paradoxerweise – als notwendige Geißel beschrieb (er schärfte den Widerspruch).
Zu Tolstoi: Es ist mir rätselhaft, dass ich dieses Buch Mitte der 50er Jahre gelesen haben soll, diese winzige, unattraktive Schrift, Seite für Seite, insgesamt 500, und es enthält doch von Anfang bis Ende Bleistift-Unterstreichungen, deren Sinn mir heute dunkel erscheint. Sie könnten Auskunft geben über meinen damaligen Seelenzustand, der mich vielleicht interessieren sollte. Vielleicht hat mich erst der Film so begeistert, genauer: die Gestalt der Natascha? Ich vermute aber, dass ich den Roman als Aufklärung über das Leben gelesen habe, außerhalb des eigenen engen häuslichen Kreises, da draußen in der wirklich großen, weiten Welt. Mit der gleichen Intensität habe ich (ab April 56) Rudolf Goldschmit-Jentner „Begegnung mit dem Genius“, und (ab Sept.58) weiter mit „Fischer Bücherei“ – Thomas Mann „Leiden und Größe der Meister“ – aufgesogen, über Wagner natürlich, aber als erstes darin „Goethe und Tolstoi“. Mehrere Bände Dostojewski folgten. Und vor allem Hamsun.
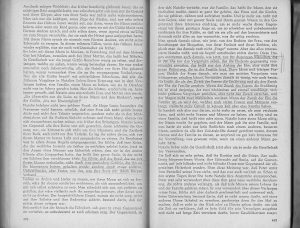 Übersetzung von L.Albert Hauff 1893
Übersetzung von L.Albert Hauff 1893
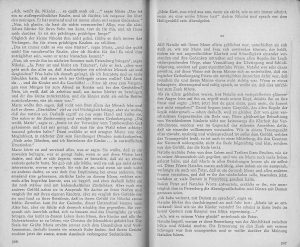 Heute kehrt eine Ahnung zurück…
Heute kehrt eine Ahnung zurück…
In der Unter- oder Oberprima lasen wir Thukydides im Original, aber das war eine rein sprachliche Übung; als Historiker blieb er für uns eine beliebige Erscheinung, ein „alter Grieche“ eben. Für die 400-Jahrfeier des Gymnasiums standen wir im Rezitations-Chor bei der Einstudierung der „Antigone“ auf der Bühne. Das wurde oft geprobt und mehrfach aufgeführt, das Stück begann merkwürdigerweise zu leben.
Aus dem Nachwort zu Thukydides von Hellmut Flashar (2005):
Aus Kants Anhang „Zum Ewigen Frieden“ (1795)
Das Wort „ewig“ könnte man durchaus ironisch auffassen, zumal sich Kant gleich zu Anfang seiner Schrift auf das Reklameschild eines holländischen Gastwirts bezieht, das einen Kirchhof abbildet und darüber den Namen des Hauses nennt: „ZUM EWIGEN FRIEDEN“.
Falsch ist auf jeden Fall die westliche Nada-Brahma-Theorie, die mit Obertönen und einer Sphären-Harmonik daherkommt. Und dieses harmonistische Gefasel als universales Prinzip zu verkaufen sucht.
Ich will aber nicht ausschließen, dass es für mich eine Rolle spielt, wenn sich die Musikästhetik als anschlussfähig erweist im täglichen Leben und in der Physik; dass ihr Geist nicht frei im Raume schwebt, und dass die Volksmusik, die (Gebrauchs-)Musik der Völker und jedweden Alltags nicht ausgeschlossen ist. Wenn ich also lese:
 …um Missverständnisse auszuschließen, auf der nächsten Seite die folgende Bemerkung:
…um Missverständnisse auszuschließen, auf der nächsten Seite die folgende Bemerkung:
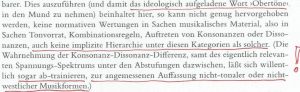 Simone Mahrenholz (Quelle s.u.)
Simone Mahrenholz (Quelle s.u.)
Im Einklang mit der Realität ziehe ich beim Geigeüben das alte Intonationsbuch (1997) zu Rate, höre die entsprechende CD als Offenbarung, während ich den Farbunterschied mit Fassung ertrage.
Inzwischen bin ich aber auch mit dem neuen (alten) Buch, der Dissertation von Simone Mahrenholz weitergekommen, und es sind unerwartete Komplikationen aufgetaucht, die mich zwangsläufig Zeit kosten: ab Seite 245 spielt die Theorie von der bikameralen Psyche eine Rolle, die mich Mitte der 90er Jahre auch sehr beschäftigt hat. Ich hatte das Buch „Der Ursprung des Bewußtseins“ von Julian Jaynes gelesen, war begeistert von der Idee, wie auch die Musik darin in neuem Licht erschien, die „Ilias“, die Propheten des Alten Testaments, die Evolution, – kurz – alles erschien mir revolutionär. Und dann kamen die großen Zweifel an der Wissenschaftlichkeit dieses Unternehmens, vielleicht weil ich wenig später das Riesenwerk entdeckte, das Thomas Metzinger herausgegeben hat: „Bewußtsein / Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie“ (Schöning 1995). Ich erinnere nicht mehr, welche Argumente mich vom Kurs abbrachten. Vielleicht setzte ich inzwischen ganz auf Susanne K. Langer und auf Ernst Cassirers „Philosophie der symbolischen Formen“. Es war eigentlich wieder wie heute, – als müsste ich alles neu und viel gründlicher durchdenken, – andererseits hat ich ja einen Beruf und eine musikalische Profession. Und nebenbei: in der Arbeit von Simone Mahrenholz geht es an dieser Stelle nicht um ein zentrales Kapitel, sondern um einen „Exkurs“ zu hirnphysiologischen Befunden, ungeachtet späterer, möglicher Korrekturen. Die Deutungen von J.Jaynes bleiben für mich schon aufgrund der von ihm zusammengetragenen Literatur-Beispiele faszinierend. Vielleicht nun auch mehr über Nelson Goodman?
Quellen
Julian Jaynes: Der Ursprung des Bewußtseins / Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1993
Simone Mahrenholz: Musik und Erkenntnis / eine Studie im Ausgang von Nelson Goodmans Symboltheorie / Stuttgart; Weimar: Metzler 1998
Simone Mahrenholz: Musik und Begriff How to do things with music / in: Gibt es Musik? Beiträge von Daniel Martin Feige, Christian Grüny, Tobias Janz und Simone Mahrenholz / Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft Heft 66/2/2021 / Verlag Felix Meiner Hamburg
Zurück zum Thema Krieg und Frieden:
Ein Kapitel des Ethnologen Christoph Antweiler in dem Buch „Heimat Mensch“ ist so überschrieben und endet mit Sätzen, die bei Kant stehen könnten:
Frieden ist nicht der Naturzustand glücklicher Gesellschaften. Er fällt nicht vom Himmel. Auch in nichtindustriellen Gesellschaften muss er aktiv hergestellt werden. Dauerhaften Frieden gilt (recte: gibt!) es nur dann, wenn es ausdrücklich friedensstiftende Mechanismen gibt. Die heutigen Länder, in denen es wenig Gewalt gibt, wie etwa Norwegen, haben das nur durch einen ganzen Kranz von Maßnahmen geschafft, der von Gesetzen auf Landesebene bis zum alltäglichen Umgang im Kíndergarten reicht. Die Semai, die Fipa und andere friedliche Gesellschaften geben uns keine Patentrezepte, aber sie können uns motivieren und inspirieren. Sie machen Hoffnung, dass Frieden im wahrsten Sinn des Wortes machbar ist.
Quelle: Christoph Antweiler: HEIMAT MENSCH Was uns ALLE verbindet / Murmann Verlag Hamburg 2009
NB Die Anschläge des rechtsextremistischen Massenmörders Breivik fanden am 22. Juli 2011 statt.
Merksatz zum Thema MACHT (LANZ-Sendung ZDF 29.06.22 hier ab 59:30 Liana Fix)
(Um es erst einmal akademisch zu sagen) Macht an sich hat ja nichts Positives oder Negatives per se, Macht ist einfach da, Macht ist zwischen uns da, Macht ist in meiner Partei da, die Frage ist: wofür setzt man Macht ein, und mit welchen Werten, und mit welchen Werten verbindet man diese Macht. Und gerade in (aufgrund) der deutschen Vergangenheit wird Macht verwechselt mit Gewalt , das ist der Unterschied, und deswegen hat Macht eine so negative Konnotation dazu. Wenn man das begreift, dass Macht nicht gleich Gewalt ist, sondern Macht eben ein Instrument ist, um gewisse Werte zu erreichen, und dazu gehört eben auch militärische Macht – dann kann man damit auch umgehen, in der Politik, und zu dem Zitat von Ralf Stegner [Ukraine]: es ist tatsächlich für die deutsche Gesellschaft schwierig zu akzeptieren, dass dort deutsche Waffen in einem Krieg mit Russland stehen (…).