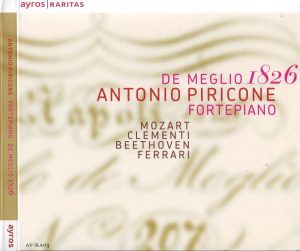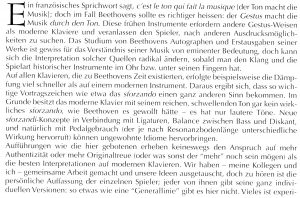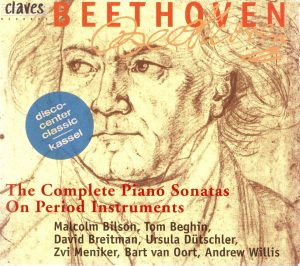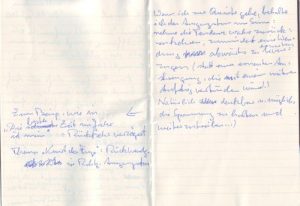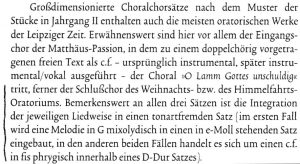Um einmal einiges aufzuzählen…
Vielleicht ist es kein Tag wie jeder andere. Und es hätte auch eine andere Zeitung sein können, die Frankfurter Allgemeine, die Neue Zürcher Zeitung, die ich beide sporadisch im Internet lese, die ZEIT, die ich wöchentlich in Papierform auf dem Tisch ausbreite, beginnend mit dem Feuilleton, fortfahrend mit dem Teil Wissen, und zum vorläufigen Ende die ersten 3-4 Seiten. Heute aber ist es die Süddeutsche Zeitung, die per Ferien-Umleitung dank einer Freundin für zwei Wochen täglich bei uns hereinschaut. (Auch sonst ziemlich regelmäßig, aber immer verbunden mit einer Fahrradfahrt zur Bahnhofskiosk, also nicht „immer“.) Vorübergehend im Wechsel mit Claus Klebers sehr lesenswertem Büchlein „Rettet die Wahrheit“, das in meiner Buchhandlung Jahn an der Kasse lag und bei ZDF-Lanz mit dem Autor durchgesprochen worden war, als ich den neuen Fabiou abholte: „Philosophie des wahren Glücks“, weil mich sein „Versuch, die Jugend zu verderben“ seit Monaten (vor dem Einschlafen) beschäftigt hat.
Also die Süddeutsche heute, Freitag, den 29. September 2017. Endlich eine volle Seite über das Phänomen „Referendum in Katalonien“, und zwar derartig in Schwerpunkte aufgeteilt, dass man keinen auslässt. Und den Leser, der die Problematik aus der Ferne mit Befremden verfolgt hat, merkwürdig verändert daraus hervortauchen lässt.
Seite 13 Hirngespinste! Stierkämpfer und Kolonialherren die einen, Akrobaten und Händler die anderen. Über die historischen Wurzeln des Konflikts zwischen Spaniern und Katalanen. / Referendum in Katalonien 300 Jahre Streit, drei Schriftsteller, ein Abgrund. Von Thomas Urban.
Aber es ist auch die Konfrontation von zwei politischen Kulturen. Der Wohlstand der Katalanen beruhte auf Handwerk und Seehandel. In den Städten entwickelt sich ein selbstbewusstes Bürgertum, vergleichbar den Hansestädten und italienischen Stadtrepubliken. Eine Tradition des politischen Kompromisses und ein ausbalanciertes Machtsystem entstanden.
Spanien hingegen war eine Monarchie mit klarer Machthierarchie: König, Adel, Klerus und Bauern, die Frondienste leisten mussten. Nach der Entdeckung Amerikas beruhte die spanische Wirtschaft nicht auf Handel und Erfindergeist, so stellen es mit Vorliebe katalanische Historiker dar, sondern auf der Ausplünderung der Reiche der Azteken und Inkas. Die Gestaltung der Politik blieb bis in die Neuzeit einer kleinen Elite vorbehalten. Nach Meinung links-liberaler Politologen lebt dieses hierarchische Politikmodell in der PP fort.Dort sei, so sagen sie, die innerparteiliche Demokratie rudimentär ausgebildet. Auch gelte für sie die Devise: „Der Gewinner nimmt sich alles.“ Vor allem wenn es um die Verteilung von Posten und Haushaltsmitteln geht. Es ist kein Zufall, dass PP-Politiker in Korruptionsaffären verwickelt sind.
Nach katalanischer Ansicht verstehn die Spanier in Madrid Politik nur als Konfrontation. Symbolisch dafür stehe der Stierkampf. In Katalonien ist das Spektakel verboten, zum Ärger des Traditionalismus in Madrid. Stolz verweisen die Katalanen auf ihre (Gegen-) Tradition: die Castells. Türme aus Menschen, mehrere Etagen hoch, Ergebnis eines Höchstmaßes an Konzentration und Koordination. In Spanien aber amüsiert man sich über diesen „komischen“ Sport, bei dem es nicht um das unmittelbare Kräftemessen geht.
Lügen und Rechtsbruch Das Referendum ist illegal. Von Juan Cruz.
Spanien ist tot Wir müssen wählen dürfen. Von Albert Sanchez Pinol.
Ihr spinnt alle beide! Der Hass vergiftet uns. Von Almudena Grandes.
Seite 14 Rastlose Flucht nach vorn Vorbei? Seid euch da bloß nicht so sicher: Gerd Koenen erzählt die Geschichte der kommunistischen Weltbewegung. „Die Farbe Rot“ ist ein unvollkommenes Meisterwerk der historischen Analyse. Von Jens Bisky.
ZITAT
Was war der Kommunismus? Laut Brecht das Einfache, das schwer zu machen ist. Gangchanzhuyi – die chinesische Umschreibung des höchsten Ideals und endgültigen Ziels der Partei, bedeutet etwa „die gemeinsame Wiedergeburt der Herrschaft der Gerechtigkeit“. Der Ökonom John Maynard Keynes vermutete, „die subtile, beinahe unwiderstehliche Verlockung des Kommunismus“ bestehe darin, „dass er verspreche, die Dinge schlimmer zu machen“. Es handele sich um einen „Protest gegen die Hohlheit des Wohlergehens“, also einen „Appell an den Asketen in uns“. Kommunisten in vielen Ländern sahen in ihrer Bewegung die Avantgarde einer „menschheitlichen Selbstbeauftragung“ zur vernünftigen Neuordnung aller Verhältnisse im Handstreich.
In Gerd Koenens monumentaler Studie über die „Ursprünge und die Geschichte des Kommunismus“ findet man all diese Bestimmungen, Aphorismen, Selbstbeschreibungen – und noch viele mehr. Ein Charakteristikum des Kommunismus sieht Koenen, angeregt vom Roman „Der stille Don“, für den Michael Scholochow den Literaturnobelpreis erhielt, in der „extremen Spannung zwischen dem Höchsten und dem Niedrigsten, zwischen Humanismus und Terror“. Aber auch das bleibt nicht das letzte Wort der analytischen Erzählung. Koenen misstraut der wohlfeilen, allzu oft mit liberaler Selbstzufriedenheit verbundenen Formel vom „Ende des Kommunismus“. Er schreibt im kritischen Handgemenge, widerspricht beliebten Deutungen, etwa denen von Ernst Nolte oder Eric Hobsbawm. Von der ersten Seite an enttäuscht er alle Erwartungen an ein Handbuch, einer konventionellen Darstellung in antiquarischer Absicht. (…)
Was war der Kommunismus?
Gewiss war er weder eine bizarre Idee deutscher Stubengelehrter noch eine große Utopie, die leider falsch umgesetzt wurde. Er lebte und lebt von kulturell tief verwurzelten Sehnsüchten. Religiöse und philosophische Erzählungen schildern das Heraustreten der Menschheit aus einem mythischen Urzustand als Schrecken eigener Art. „Schuld- und fluchbeladen“ erscheint der Verlust ursprünglicher Einheit, gleichviel ob man in deren Beschwörung Erinnerungen oder Fiktionen sehen will.
Koenen rekapituliert die Erzählungen von Gilgamesch, die biblische Schöpfungsgeschichte, Hesiods „Werke und Taten“, asiatische Lebenslehren, christliche Reichtumskritik. Er gewinnt der eindrücklichen Revue eine wichtige, Max-Weber-Lesern plausible Pointe ab: die Herkunft des modernen Sozialismus und Kommunismus aus der christlich-abendländischen Gedankenwelt sei leichter zu verstehen, als die Frage zu beantworten, warum in diesem neuzeitlichen Europa eine Wirtschafts- und Lebensweise entstand, die sich um Ursprünge, Gemeinschaft, Herkommen wenig schert, tradierte Bindungen sprengt und heute summarisch „Kapitalismus“ genannt wird.
Nachdem ich fleißig abgeschrieben habe, was mir persönlich behaltenswert erschien, entdecke ich beim Recherchieren des Wortes „Gangchanzhuyi“, dass dieser ganze Artikel im Internet auffindbar ist: Hier. Bitteschön, doppelte Empfehlung!
Seite 14 Wer sind eigentlich diese Deutschen? Seine Geschichte des Dritten Reiches ist ein Standardwerk. Ein Treffen mit dem britischen Historiker J. Evans, der an diesem Freitag siebzig wird. Von Alexander Menden.
Als er in den Sechzigerjahren begann, in Oxford Geschichte zu studieren, hatte der deutsche Historiker Fritz Fischer gerade eine Debatte über die Gründe für den Ersten Weltkrieg eröffnet. „Fischer war ein Held für mich“, sagte Evans. (…) Wie viele gleichaltrige Geschichtsstudenten fand Evans Fischers These aufregend, der Weltkrieg und auch der Nationalsozialismus seien ein Folge der gesellschaftlichen Entwicklung im deutschen Kaiserreich gewesen – zumal 1968 gerade eine Wiederbelebung neonazistischer Ideen in ganz Europa stattfand. (…)
Evans selbst studierte eingehend die Hamburger Archive, publizierte unter anderem über feministische Bewegung in Deutschland und über die „völlig in Vergessenheit geratene“ Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung: „Deutschland war ja bis zum Wirtschaftswunder, das die berühmte nivellierte Mittelstandsgesellschaft hervorbrachte, eine zutiefst gespaltene Klassengesellschaft“ sagt er. Deshalb finde er die Generalisierung deprimierend, die immer wieder gerade von britischen Historikern vorgenommen werde, wo einfach von „den Deutschen“ die Rede sei: „Es gibt keine Differenzierung, die auf diese klassenbedingte Spaltung, auf den Dissens mit den Nazis eingeht.“ Er bezog auch Stellung gegen Daniel Goldhagen, der die nach Evans‘ Einschätzung unzulässig vereinfachende Behauptung aufstellte, „eliminatorischer“ Antisemitismus sei der deutschen Kultur eingeschrieben.
Seite 16 Im Wellnesstempel der Könige Deutsche Archäologen restaurieren die Stätten von Meroe – einst Herz eines riesigen Reiches im Sudan. Von Hubert Filser.
(…) Die antike Stadt Meroe war mehr als 1000 Jahre die Hauptstdt eines großen Reichs im Mittleren Niltal, das sich von der Südgrenze des mächtigen Ägypten bei Assuan bis ins Herz Afrikas erstreckte. Die Könige von Meroe waren die Nachfolger der legendären „Schwarzen Pharaonen“, die im 7. Jahrhundert vor Christus in Ägypten geherrscht hatten. Am Königshaus herrschte offenbar ein ziemlich weltoffenes Klima, denn viel der Bauten vereinen verschiedene Kulturen der damaligen Zeit. Die Bilder im Bad zeigen ägyptische und einheimische Götter, der Flötenspieler belegt den griechischen Einfluss, er ist dem Kult um den griechischen Weingott Dionysos zugeordnet. „Auch die sprudelnde Säule ist ein Beleg für den Kulturtransfer“, sagt DAI-Forscherin Simone Wolf. „Solche Säulen standen zur gleichen Zeit auch in Pompeji“.
Sudan Meroe Pyramiden, nummeriert (Foto: Francis Geius – Mission SFDAS 2001 Photographer: B N Chagny, hier nach Wikipedia).
Über nubische Pyramiden hier.
(Fortsetzung folgt)