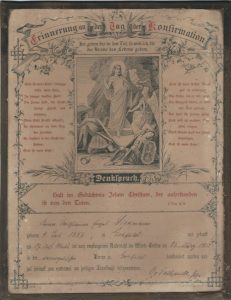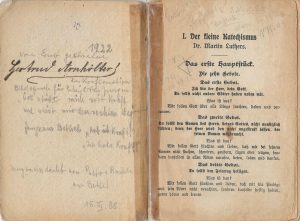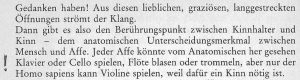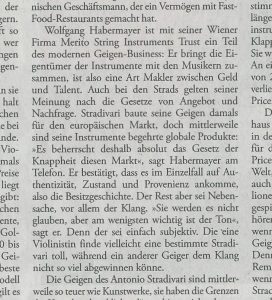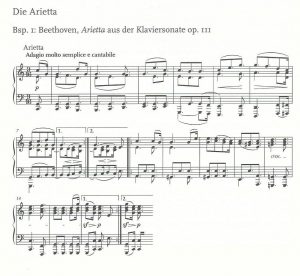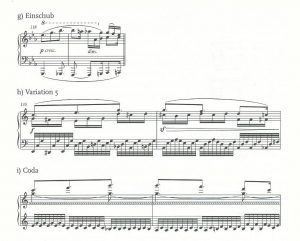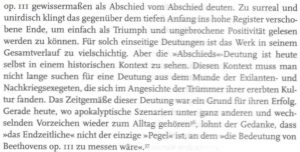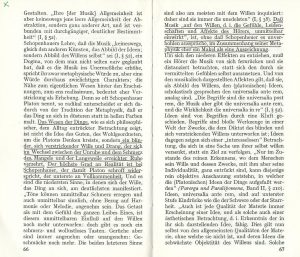Vorläufige Notizen zu Fernsehsendungen (keine Rezension)
1) scobel – Die Macht der Musik
Musik ist tief in der Evolutionsgeschichte der Menschheit verankert. Das Geheimnis der Rhythmen und Melodien beschäftigt nicht nur Forschende aus Neuro- und Musikwissenschaften.
Der Film, auf den Scobel gleich zu Anfang rückverweist ist der hier im Artikel als zweiter verlinkte. Ab 1:06 die Aufreihung der Inhalte: Musik als elementarer Bestandteil der menschlichen Kultur. Ihre Kraft: begleitet uns durchs Leben von Geburt bis Tod. Überwindet ethnische Grenzen. Wer ein Instrument spielt, lernt sich zu konzentrieren, zu improvisieren, im Team, allein oder in einer großen Gemeinschaft. Musik beeinflusst unsere kognitiven und sozialen Fähigkeiten, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Hat eine gewaltige positive gemeinschaftsfördernde Kraft. Kann aber auch für zerstörerischen Zwecke missbraucht werden. Als politisches Instrument, als Foltermethode. Wie wird sich Musikpartizipation in Zukunft verändern? KI-Modelle sind in der Lage, im Stil bestimmter Komponisten neue Musik zu kreieren. Bericht Ramona Sirch. Brauchen wir noch Musiker aus Fleisch u Blut? Ab 3:06 Gäste: Melanie Wald-Fuhrmann, Eckart Altenmüller, Till Brönner (über die dramatische aktuelle Lage) bis 7:16, dann M W-F., E.A. ab 9:18 (Präsenzunterricht etc), Wirkung von Musik auf Gehirn: ab 11:23 Stefan Kölsch: „Good Vibrations“ Evolutionsforschung zu Musik u Sprache, Experiment Musik im Film, Wirkung von Musik: durch 4 Affektsysteme: 1 das Vitalisierungssystem im Hirnstamm, 2 im Zwischenhirn: Schmerz- und Belohnungszentrum, Dopaminausschüttung, Gehirne von Musikern jünger als dem biologischen Alter entsprechend,14:40, 3 Glücksystem im Hippocampus, entstehen bindungsbezogene Emotionen, mit andern, gemeinsames… Musik wird in Glück u Freude umgewandelt, 4 das Unterbewusste, wo Intuitionen entstehen, auch das Immunsystem stärkende, auch irrationale Ängste, positive Effekte nach Erkrankungen. Rätselhaft, dass Musik so universal wahrgenommen wird. Stimme, Kölsch dazu,15:50, Musiktherapie, aber keine Pille, individuelle Prägung, Hassmusik? Melancholie u Musik: das Sich-draufeinlassen ist eine Form der Verarbeitung (Melanie Wald-Fuhrmann) 18:30 Was wissen wir neurophysiologisch Neues? Altenmüller ab 18:35 Gehirne von Musiker/innen unterscheiden sich, Netzwerke größer, weil sie beansprucht werden, klar, aber wie individuell? Jedes Musikergehirn anders! Jazzmusiker anders als Klassiker! Frauen anders: individualistischer ausgeprägt. 20:20. Östrogen oder Testosteron, Gehirnkorrelate…Heute bessere Methoden als vor 15 Jahren. 21:00 an Brönner: Trompete, Lippen, Stimmung: viel Erfahrung mit Aufregung (Adrenalin), keine Belächelung, Trompete mit Sprache? 23:25 „Klang findet im Kopf statt“ SPRACHE Wald-Fuhrmann: unterschiedliche Konzepte versch. Kulturen, Ursprungsmythen, „bei Kindern ist das, was wir Sprache u Musik nennen, noch nicht getrennt“. Erwachsene singen mehr beim Sprechen mit Kindern. Genetisch. Nur scheinbar distinkte Kategorien. Bei Kindern Sprachstörungen mit Musik behandeln? 25:00 E.A. Auditive Mustererkennung, musikalische Gestalten besser klassifizieren können, b und p, t und d, Aufmerksamkeitslenkung. „Olivo-kochleäres Bündel“ = Nervenbahn, die vom Gehirn aus das Innenohr angesteuert, Haarzellen für bestimmte Klänge, Kinder musikalisch therapieren, 27:07. W.-F.: „Es ist nicht die Musik mit ihrer Wundermacht, sondern ein spezifisches Element, was zu diesen Effekten führt… und drumrum ist dann eben noch Musik. Wahrscheinlich machts den Kindern auch noch Spaß…“ 27:30 Religion und Musik – dieselben Wurzeln? Zugang zu einer Wirklichkeit, die wir nicht sehen können. – Gemeinschaft – SINGEN. 28:00 unerklärliche Wirkungen – Knochenflöte 40.000 Jahre alt. Der Homo Sapiens musizierte. Musik muss also evolutionär bedeutsam sein! Für eine bessere Kooperation, für stärkeren Zusammenhalt, fördert die Gesundheit, reguliert Emotionen und kann Konflikte mindern. Weltweit eine Vielzahl musikalischer Systeme. Ziel ist der Aufbau von gemeinschaftlichen Beziehungen. Ist Musik also eine universelle Sprache, über die sich die Menschen weltweit verstehen? Feldstudien in Nord-Kamerun. Thomas Fritz (über Universalien siehe hier) 29:25 bei den Mafas mit Klavierstücken (!). Universalsprache. Aber auch kritische Stimmen, die eher das betonen, was trennt. Melanie Wald-Fuhrmann will mit Klischees aufräumen. Wird Musik missbraucht, lassen sich die positiven Merkmale ins Gegenteil verkehren, machen Menschen unter bestimmten Bedingungen sogar krank. 32:00 Es wäre natürlich schön, aber es stimmt einfach nicht. 18. Jahrhundert, und immer an europäischer Musik nachgewiesen, die übliche Argumentation. Kritisch auf T.Fritz bezogen. Kolonialismus. Fröhlich u traurig wird verwechselt. Es gibt z.B. kein Moll in Kamerun. „Musik ist eine Sprache, die wir genau so lernen müssen wie eine Wortsprache“. 35:20 „Das heißt jetzt nicht, dass nicht Menschen über Länder und Kulturen hinweg erfolgreich miteinander musizieren können, also beim Musizieren in der Form der Interaktion, da scheint mir vieles eher möglich zu sein. Aber Musik verstehen in ihrer Bedeutung, das funktioniert nicht.“ Scobel-These, dass Jazz alle Stile miteinander verbindet. Alles möglich. Ideologie? Brönner: Viel unterwegs gewesen. Musik ist in erster Linie eine Haltung, eine Bereitschaft, nicht abhängig von einer Sprache, die wir vorher im Labor, über einen Lehrer oder ein Lexikon lernen müssen. Instrumente! Ähnliche Ausbildung überall. Funktion des Jazz immer eine verbindende. Scobel: universale Grammatik? Esperanto? Wo alle sich irgendwie einklinken können. Altenmüller: Widerspruch! In Musik Häufigkeitsabfolgen, Kadenzschemata, das ist ja eben gelernt. Es ist nicht, wie z.B. Chomsky sagt, dass wir feste Strukturen im Gehirn haben, diese hochkomplexen Verknüpfungen zwischen den Anteilen der verschiedenen Elemente in der Sprache, das haben wir in der Musik sicher nicht. Aber es gibt schon universale Anteile in vielen musikalischen Werken, die Affektsprache, wie Seufzen, Lachen, Stöhnen, was ja schon lange vor der Erfindung der Sprache da war, wir hatten mal einen Forschungsbereich: „the evolution of emotion and communication in animal and man“ – was können Tiere und Menschen in gleichem Maße kommunizieren? seufzen, knurren (drohen), als Affektgestaltung. Also auch Barockmusik, Renaissancemusik… Scobel: heute Filmmusik. Töne für Angst, der weiße Hai. In gewisser Weise universell, aber: aus dem Brotkorb der Universalienen einige Universalien herausgepickt und die dann künstlerisch gestaltet. 40:15 Wald-Fuhrmann über indische (arabische) Gesangsästhetik („supertraurig“), Scobel an Brönner: China-Oper u über arabische Vierteltonabweichungen, Ibrahim Mallouf, Jazzfestival in den Emiraten schwierig, – Japaner kennen fast jedes Volkslied aus Deutschland – 42:20 Globalisierung Vielfalt gleichzeitig existierender Formen Musikbeispiel beginnend mit Lohengrin, „Musik ist Sprache der Leidenschaft“, Streaming Spotify, Lukas Linek, Künstliche Intelligenz, Juke Box Mix, 45:00 Beethovens 10. Sinfonie mit KI vollendet, klingt (demnach) vielversprechend – was übrigens Quatsch ist (JR). Matthias Röder: „eine neue Tür geöffnet“. Augmented Reality… Online-Spiele-Welt… Henrik Opperman 3D-Audio-Spezialist, 48:00 „sich aus der Sitzposition im Publikum befreien“, Bericht: Ralph Benz, Scobel: „wenn Musik rel. schematisch ist, kontrapunktisch, kann ich mir vorstellen, dass ne KI das macht…“ Wald-Fuhrmann: „da verspricht man mehr, als man halten kann“ – „hinterm Kunstwerk steht ein Mensch, der ein Problem lösen will oder der etwas kommunizieren will darüber hinaus – und eine KI hat keine Probleme und will mir nichts sagen, also warum…“ – Musikrezeption Musiker verdienen überhaupt nichts durch Streaming Dienste – Till Brönner über Spotify u.a. … nicht adäquat bezahlt. Es muss eine Vergütung gemäß den Abrufen geben! Altenmüller zur 10. Sinf. Beethoven KI-Komposition:. „schrecklich. Ich fand die stink-langweilig! „Kunst muss irritieren, muss Regeln brechen, KI kann nur Regeln erfüllen!“ 54:30 (!!) Scobel: „Der nächste Schritt ist natürlich: untersuchen, wann ich denn als erfahrener Musikhörer/in jetzt einen Bruch erwarte, statistisch, nach wieviel Minuten muss der kommen, die Melodie irgendwie transponiert werden oder was auch immer, und das baue ich dann in meine KI ein“. Altenmüller: Nehmen Sie den einfachsten Bach-Choral – Bach verletzt die Regeln! … nicht vorhersagbar! Und das ist der Punkt: dass Sie nämlich im richtigen Moment Nicht-Vorhersagbares produzieren… (Brönner nickt) Scobel nochmal zu 3D im Wohnzimmer… Brönner: früher: das einzige, was nicht bestechlich war: der Arsch auf der Bühne. Der eigene nämlich. In Pandemie-Zeiten ist das offenbar anders. Und die Menschen konsumieren weiter Musik… Ende bei 57:00
https://idw-online.de/de/news752530 (Frühgeborene Kinder: Musiktherapie fördert die Gehirnentwicklung Nathalie Plüss) hier
* * *
2 Die Kraft der Klänge – Musik als Medizin
https://amiamusica.ch/author/friederike/ (Haslbeck) hier
* * *
3 Die Kraft der Musik
Planet Wissen. 25.04.2017. 58:29 Min. UT. Verfügbar bis 25.04.2022. WDR.
Sie rührt zu Tränen, tröstet und weckt Erinnerungen: „Musik ist das Faszinierendste, was die Menschheit je hervorgebracht hat“, sagt der Musikneurologe Stefan Koelsch.
[ https://www1.wdr.de/mediathek/video-die-kraft-der-musik-100.html hier ]
https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/7704 hier
https://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Schellenberg hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Urs_Nater hier
https://klinische-gesundheit-psy.univie.ac.at/ueber-uns/urs-nater/ hier
https://www.planet-wissen.de/kultur/musik/index.html hier (darin: „Macht der Musik“)
https://www.mdr.de/wissen/warum-gemeinsames-singen-gluecklich-macht-100.html hier
https://www.buecher.de/shop/musikpsychologie/warum-singen-gluecklich-macht/kreutz-gunter/products_products/detail/prod_id/40838219/ hier
* * *
Und von all diesen Sendungen abgesehen: was ist denn nun eigentlich MUSIK?
Ich würde noch einmal bei Schopenhauer beginnen. Es geht zunächst einmal um den „Willen“ als Kern der Sache. Aber nicht ohne fremde Hilfe, – es gibt ja hervorragende Interpretationen, die einem helfen, den Philosophen nicht misszuverstehen. Neuerdings sah ich eine plausible Einführung bei Andreas Luckner:
Das Phänomen, dass die Musik zu uns spricht, dass sich in ihr etwas uns mit�teilt, was wir zudem in größter Klarheit verstehen könnten, was sich aber eben
nicht in Worte fassen lässt, war für den schon zitierten Schopenhauer Grund,
in seiner Metaphysik der Musik zu behaupten, dass wir mit der Musik einen
direkten Zugang zur Welt besäßen, wie sie »an sich« ist, also jenseits unserer
Vorstellungen bzw. Repräsentationen von ihr. Bekanntlich nannte Schopen�hauer das, was die Welt an sich, in ihrem Innersten, ausmacht, »Wille«. Dies
hat viele Irrtümer produziert; bei »Wille« handelt es sich zunächst einmal um
einen Namen für das, von dem wir aus notwendigen Gründen keinen Grund
mehr angeben können, weil es als der Grund von allem gedacht werden muss,
ein Name des Absoluten also (Anmerkung). Das Absolute, der Grund von allem, den Wil�len darf man sich natürlich nicht als einen Gegenstand vorstellen, man kann
und sollte das Absolute eben überhaupt nicht vorstellen, weil eine jede Vor�stellung schon in diesem Absoluten gründet.
Die Anmerkung dazu:
Wir können hier freilich nicht in Tiefen und Untiefen der Schopenhauer’schen Willensmetaphysik einsteigen, nur so viel: Die Welt als Vorstellung, also im Prinzip alles das, was wir von ihr systematisch wissen können, steht nicht für sich, sondern hat einen Sitz im Leben, von dem aus diese Welt als Vorstellung zuallererst ihren Sinn bezieht. Dieses Leben, das »An sich« der Welt, ist uns an einer Stelle zugänglich, wo wir nicht nur eine vermittelte Vorstellung von einem Weltgegenstand haben, sondern selbst dieser Gegenstand (und dann eben nicht mehr als Gegenstand, sondern als Subjekt) sind: unsere leibliche Existenz. Unsere jeweils eigene leibliche Existenz kön�nen wir gleichsam von zwei Seiten erfahren: einerseits vergegenständlicht als Weltding in der Vor�stellung bzw. Repräsentation des Körpers, andererseits als gefühlter Leib, sozusagen »von innen«.
Daher kommt es, dass Schopenhauer die Welt, wie sie jenseits oder vor jeder Vorstellung ist, »Wil�len« nennt. Dies ist nicht der Wille im Sinne einer Intention qua Gerichtetheit auf einen Zweck; denn insofern Zwecke schon identifizierte (und gewünschte sowie für realisierbar erachtete) Sach�verhalte sind, handelt es sich hierbei schon um Vorstellungen. Der »Wille« darf also nicht mit dem Willen in der Vorstellungswelt verwechselt werden; was Schopenhauer mit »Wille« meint, ist vielmehr ein ungerichteter, intentionsloser, blinder Lebensdrang, eine Art vitales Energiefeld, die Quelle möglicher Bewegung. »Wille« ist aber hier genauso der Name des Absoluten wie in anderen Philosophien »das Sein« oder »die Lebensform«.
Ich überspringe einiges im Text, um auf das zu kommen, was mich überhaupt WAS IST MUSIK fragen lässt, z.B. dort, wo niemand mich auf irgendwelche Emotionen verweisen kann. Sagen wir in einer Bach-Fuge, die ich durchaus mit der Emotion „Begeisterung“ spiele, ohne dies als Argument anführen zu wollen… (sie bedeutet etwas – aber was???).
Musik als »Sprache der Gefühle« darf also nicht in dem Sinne verstanden
werden, dass Musik Gefühle darstellen würde, so dass der Inhalt der Musik
Gefühle seien. Das ist offensichtlich nicht der Fall, denn es gibt unzählige Bei�spiele hochstehender Musik, die mit bestimmten »Gefühlen« gar nicht in
Zusammenhang zu bringen ist, nehmen wir etwa eine Fuge von Bach oder ein
serielles Stück des frühen Stockhausen. In solchen Stücken stellt die Musik
nichts dar außer sich selbst. Ihr Inhalt ist nichts anderes als die Form, freilich
die tönend-bewegte Form, wie Eduard Hanslick gegen die Gefühlsästhetiker
und Programmmusiker seiner Zeit völlig zu Recht einwandte, d.h. die sich
immer erst bildende Form. Wer den Inhalt einer Musik jemandem darstellen
wollte, müsste ihm die Musik vorspielen. Komponieren ist daher auch nicht
die Übersetzung eines Stoffs in Töne; vielmehr sind die Töne selbst die »unübersetzbare Ursprache«.
Quelle Andreas Luckner: Musik – Sprache – Rhythmus / Bemerkungen zu Grundfragen der Musikphilosophie / in: Musik-Konzepte Sonderband Musikphilosophie 2007 ISBN 978-3-88377-889-1 (Zitate Seite 38f)
Zur Erinnerung: das ist noch lange nicht alles. Zu reden wäre – scheinbar im Widerspruch – auch davon, dass wir Musik eigentlich immer „als spezial bedeutsame Präsenz einer anderen Person hören“ , die eine „virtuelle Person“ ist. Und damit zitiere ich aus der Arbeit eines anderen Musikphilosophen, der wiederum an andere Philosophen oder Psychologen anknüpft, und da kann ich die Emotionen nicht ausklammern:
Musikalische Gesten werden wie Gesten der Körpersprache als Verkörperung affektiver, emotionaler und kognitiver Inhalte (etwa in Bezug auf soziale Zugehörigkeitsformen) verstanden. Im Falle eines kontemplativen Zuhörens ist diese Interaktion normalerweise offline: Sie ist imaginär und interpretativ. Da Zuhörer jedoch emotional auf Handlungen und Emotionen reagieren, die durch Musik akustisch dargestellt werden, ist das Musikhören eine Ausübung von Geselligkeit, etwa eine Simulation unserer Sozialisierungsfähigkeit. Die dynamischen Eigenschaften von Musik spezifizieren Prozesse, die wir normalerweise Lebewesen zuschreiben, mit denen wir interagieren. Es ist also plausibel, dass wir Musik als expressiv und bedeutungsvoll hören, wenn wir in der Dynamik der Musik persönliche Merkmale erkennen, d.h. wenn wir Musik als akustisches Zeigen von Lebewesen hören, die sich bewegen, handeln, interagieren, sich ausdrücken und sowohl miteinander als auch mit den Zuhörern kommunizieren.
Quelle Allessandro Bertinetto: Musikalische Bedeutung / Eine pragmatische Perspektive / in: Musik & Ästhetik Heft 99 Juli 2021 Klett-Cotta Stuttgart (Zitat Seite 29f)
Nachwort (noch einmal zu Schopenhauers „Wille“, jedoch nach Dahlhaus)
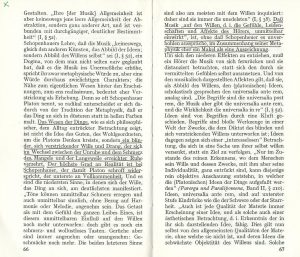
Quelle Carl Dahlhaus: Musikästhetik / Musikverlag Hans Gerig Köln 1967
Zu Universalien der Musikwahrnehmung etwas Grundlegendes in Wikipedia HIER
Vorschau

Noch etwas für den Merkzettel, herausgegriffen aus dem obigen Wiki-Artikel:
- Frühkindliche Einflüsse. Um Sprache verstehen zu können, muss ein Kleinkind lernen, die Fülle von Nervenimpulsen, die das Innenohr und die dahinter liegenden Gehirnareale liefern, zu analysieren, um auf diese Weise die Muster von sprachrelevanten Lauten zu erkennen. Die dazu gelernten Analysetechniken bilden die Grundlage des Hörens und werden für die Musikwahrnehmung genutzt. Einige grundlegende Sprachkomponenten werden von den meisten Kulturen verwendet (stimmhafte und stimmlose Laute, Tonhöhen- und Lautstärkeveränderungen), sodass einige Grundzüge des Hörens sicherlich kulturübergreifend sind. Kulturelle Unterschiede kann es in Details geben.
- Erkennendes Hören. Später werden Hörerfahrungen gesammelt, die zur Einordnung und Bewertung des Gehörten dienen. Dazu zählen z. B. die Herausbildung des persönlichen Geschmacks oder die Verknüpfung von Hörereignissen mit persönlichen Erfahrungen. Diese Einflüsse sind hochgradig individuell, bestenfalls noch gruppenspezifisch. Die dadurch geprägten Wahrnehmungen können nicht ohne Weiteres verallgemeinert werden. Individuen-übergreifende Aussagen lassen sich in diesem Bereich nur über statistische Verfahren erzielen. Für allgemeingültige Aussagen müssten möglichst heterogene Gruppen befragt werden.
Als „universell“ können nur die Aussagen gelten, die in physikalischen Gegebenheiten, der menschlichen Anatomie, grundlegenden Signalverarbeitungmethoden des menschlichen Gehörs/Gehirns, sowie gruppen- und kulturübergreifenden Aspekten begründet sind.
(Quelle: Wikipedia)