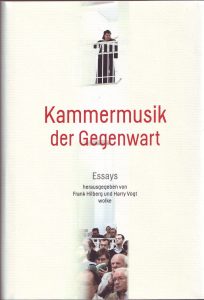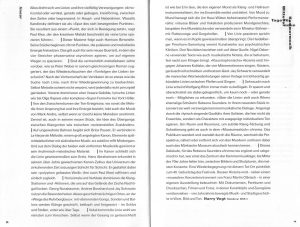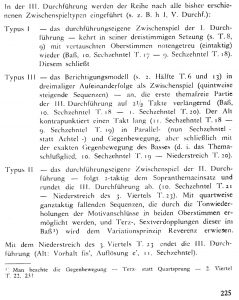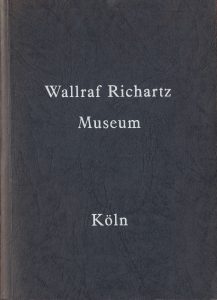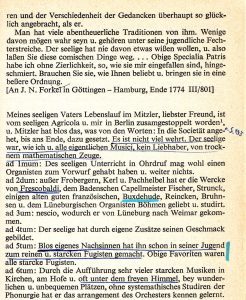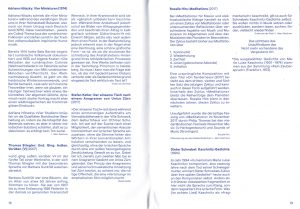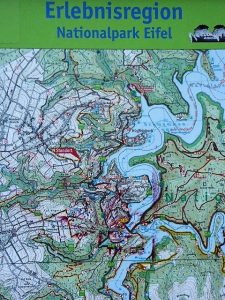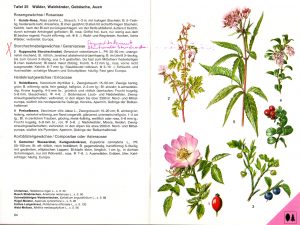Eine vorsorgliche Betrachtung
Im STERN las ich (nicht beim Friseur, wie viele behaupten, aber auch nicht beim Urologen, was hätte sein können), wie Christian Thielemann zu Wagner steht.
Denken Sie zum Zeitvertreib an der Supermarktkasse ein bisschen Johann Strauss?
Manchmal kommt mir etwas in den Sinn, aber ich schalte das weg. Ich muss weg von der Musik.
Warum?
Weil sie mich kaputt machen würde. Sie zerfrisst mich. Weil ich sie so intensiv erlebe.
Was ist denn an Wagners „Tristan und Isolde“ so gefährlich?
Wagners „Tristan“ ist lebensgefährlich. Der gehört in den Giftschrank. meine Mutter ist Apothekerin. Die hat mir erzählt, dass man mit kleinen Mengen bestimmter Substanzen eine ganze Stadt vergiften kann. Das ist bei Musik auch so. Bei Wagner muss ich genau wissen, was ich mit der Blausäure, der Schwefelsäure und dem Königswasser mache. Sonst kippen alle um.
Klingt hochdramatisch.
Ich habe vorhin in Placido Domingos „Walküre“-Probe gesessen und gedacht: „Dieser Wagner bringt dich um.“ Und das willst du aber, dass der dich umbringt. Deswegen kommst du immer wieder. Man quält sich selber und findet es schön. Deswegen muss ich hin und wieder weg von der Musik.
Quelle STERN Nr.30 19.7.2018 Seite 73 „Ein PEGIDA-versteher? das weise ich weg von mir“ Christian Thielemann, einer der größten Dirigenten der Gegenwart, eröffnet bald die Festspiele von Bayreuth. Doch er gilt auch als deutschtümelnd. Ein Gespräch über künstlerische Verantwortung in politisch bewegten Zeiten. Von Stephan Maus.
Vorsicht! kann man nur sagen. Thielemann weiß, wie Wagner wirkt, gerade im Tristan, Wagner selbst hat es gewissermaßen verbindlich beschrieben. Und zwei große Dirigenten sind bei ihrer eigenen Tristan-Aufführung am Pult verstorben. Ja, es gibt authentisches Orchestermaterial, in dem die Zeitpunkte vermerkt sind. Man lese bei Wikipedia hier nach, Stichwort Wirkung. Am Anfang steht dort sinnvollerweise Wagners Selbst-Diagnose, die er Mathilde Wesendonck zumutete, da sie ja mitschuldig war:
Kind! Dieser Tristan wird was furchtbares! Dieser letzte Akt!!! – – – – – – –
Ich fürchte die Oper wird verboten – falls durch schlechte Aufführung nicht das Ganze parodirt wird –: nur mittelmässige Aufführungen können mich retten! Vollständig gute müssen die Leute verrückt machen, – ich kann mir’s nicht anders denken. So weit hat’s noch mit mir kommen müssen!!…
Wenn ich mich recht erinnere (man kann es nachprüfen, siehe hier), hat Wagners Urenkelin die Idee mit der Parodie vor drei Jahren ernster genommen, als sie gemeint war; tatsächlich ist auch niemand gestorben und wohl auch nicht verrückt geworden. Ich – am Computer sitzend, mit bestem Blick auf die Bühne – habe mich nur geärgert, als König Marke seine Isolde nach ihrem (vorgetäuschten?) Liebestod abführte. Wer weiß, warum sie noch lebte, man munkelte etwas von ehelichen Pflichten.
* * *
Peter Gülke denkt auf ganz andere Weise – nämlich ernsthaft – über das Ende der Tristan-Handlung nach, ausgehend von Peter Wapnewskis Satz: „Die Logik der Oper ist nicht die Logik des Lebens“:
Ganz ohne diese jedoch kommt sie nicht aus, weshalb man zuspitzen könnte: Die Logik der Musik ist nicht die Logik der Bühne. Das Aufbrechen der Differenz, finale Überwältigung durch eine „vor unserem Gefühle als notwendig gerechtfertigte Handlung“, das heißt: von sich aus handelnde Musik, gehört zu den großen Aktivposten in Wagners Dramaturgie. Fast immer läuft die Szenerie auf Situationen zu, die sich auf der bislang gültigen Realitätsebene nicht lösen lassen; ein Deus ex machina muss her, Erlösung. „Wagner hat über nichts so tief wie über Erlösung nachgedacht“, so Nietzsche, „irgendwer will bei ihm immer erlöst sein“. Eben dort scheitert die Folgerichtigkeit bisher verfolgter Handlungsstränge – zugunsten einer anderen: Die Musik wird zum alles einsaugenden schwarzen Loch, beansprucht alle Rechte eines transzendierenden Mediums, worin auf- und untergeht, was anders nicht aufging.
Besonders im „Tristan“, der sich in den nächstliegenden Plausibilitäten des Bühnengeschehens zunehmend selbst widerlegt. So kommt man, weil Isolde übrig bleibt und sich in den Tod singen muss, um die Frage nicht herum, ob der dritte Akt nicht auch als Ermöglichung des sogenannten Liebestodes, als Vehikel für das „gleichsam transportierbar eingefügte Orchesterstück“ (Bloch) vonnöten war. Immerhin wollte Wagner sich, da der Traum vom praktikablen „Operchen“ schnell ausgeträumt war, „symphonisch ausrasen“. Hierfür schuf er freie Bahn, am deutlichsten am Ende.
Auf genauere Bestimmung der Todesart – irgendwo zwischen Selbstmord und Transsubstantiation, mit Anteilen von beidem – kommt es nicht an. Entsprechend vage die szenische Anweisung: „Isolde sinkt, wie verklärt, in Brangänes Armen sanft auf Tristans Leiche.“ „Verklärt“ bedeutet nicht unbedingt schon „tot“; dieses bestätigt erst der nächste Satz: „Große Rührung und Entrücktheit unter den Umstehenden. Marke segnet die Leichen.“ Dem Anspruch vom „Ertrinken, Versinken, unbewusst“ gemäß stirbt Isolde nicht real wie Tristan – im Prosaentwurf stürzte sie sich ins Meer! Dergestalt öffnet Wagner auch jenseits der Musik den Horizont des im zweiten Akt besungenen Liebestodes und macht das „transportierbare Orchesterstück“ für die auf Aufhebung ihrer selbst angewiesene Handlung zur Mündung des Ganzen. Welch symbolschwere Subtilität – ähnlich der, die dem konnotativ belasteten Englischhorn die Teilhabe am finalen H-Dur verwehrt (wobei es auch darum ging, den „Erlösungs“-Aufstieg h-cis-dis den bis dahin parallel geführten Oboen allein zu überlassen und das als Durterz empfindliche dis ausgewogen und diskret über die Oktavlagen zu verteilen).
Quelle Peter Gülke: Musik und Abschied / Bärenreiter Kassel Basel London New York Praha 2015 ISBN 978-3-7618-2401-6 (Seite 264)
(Fortsetzung folgt)
Wer die Geduld verliert, könnte sie am LOHENGRIN live üben. Die gestrige Aufführung 25. Juli 2018 ist per Video-Livestream abrufbar: HIER.
* * * * *
Mein Eindruck: die Oper ist inhaltlich eine Zumutung, da hilft kein Bühnenbild und keine Regie. Trotz sanftester Farben, und immerhin ohne Schwan. Aber leider auch musikalisch von Langeweile geprägt. Unendlich oft die gleichen Wendungen, – liegt es an Wagner oder an der Interpretation, am Tempo? Alles ist voraussehbar und behäbig, auch der „Luftkampf“ (Mein Gott: kenne ich das nicht von David Garrett? Mit Geige statt Schwert?) Und der lange Chor-Jubel am Schluss, ein durchgehendes vielstimmig-dumpfes Vibratogewirr, nicht-enden-wollend. Wer hält das in der Realität aus!? Es genügt eigentlich, das halluzinogene Vorspiel und die 2. Szene verinnerlicht zu haben (die ich 1956 auf LP kennenlernte und unzählige Male hörte). Die schrecklich gefügigen Männerstimmen angesichts der fiebrigen Frau. Damals liebte ich das Auskosten der phrygischen Kadenz, – so kannte ich sie nicht von Bach -, jetzt finde ich sie völlig überstrapaziert. (Merken: die Stelle mit dem Ausrufer vor dem Kampf, die Bruckner im Adagio seiner Siebten zum Ausgangspunkt nimmt.)
Pause nach I. Akt ab 1:02:17 bis 01:10:56 Gespräch mit Waltraud Meier + Gang durch Festspielhaus, Keller und Probenraum (Kantine)
(Sehr interessant, das Publikum hinter den plaudernden Protagonisten zu beobachten. Was für ein Glanz! Ich denke an die große deutsche Fernsehshow, an Hochzeit in Königshäusern, ja, ein Moderator namens Maier steht fast im Zentrum der Macht und spricht mindestens wie ein Adelsexperte oder sogar ein Bachelorkandidat.)
 Musik & Ästhetik Heft 87 Juli 2018
Musik & Ästhetik Heft 87 Juli 2018