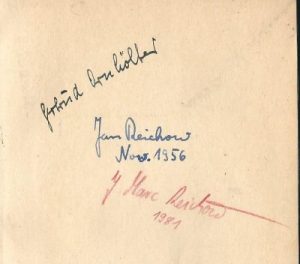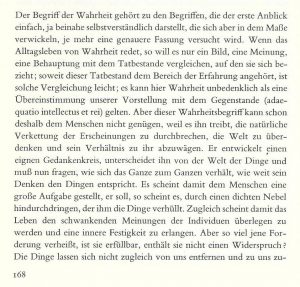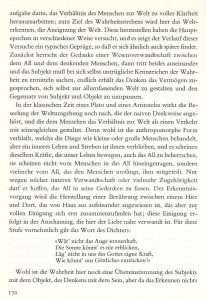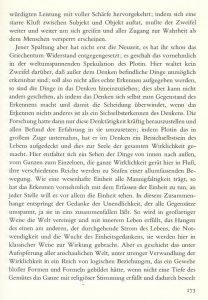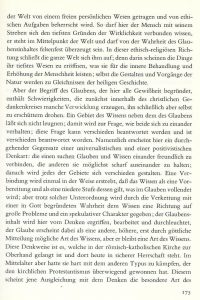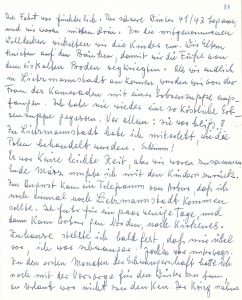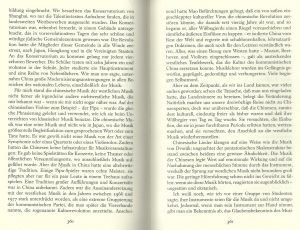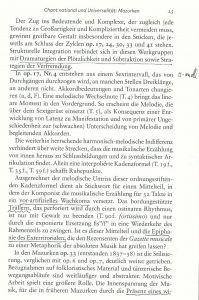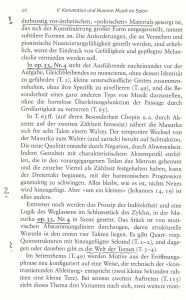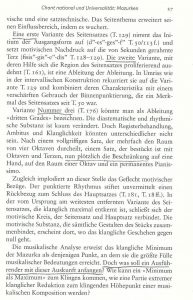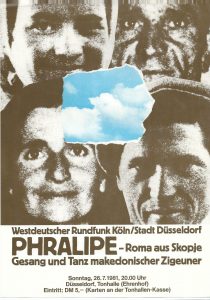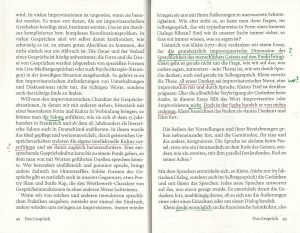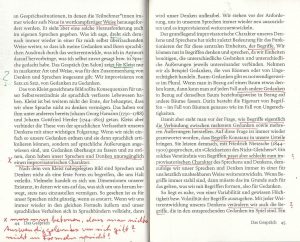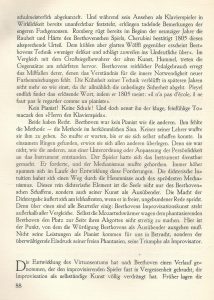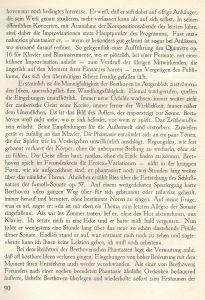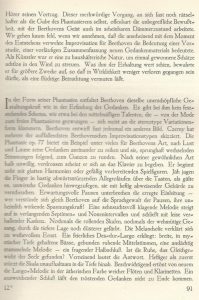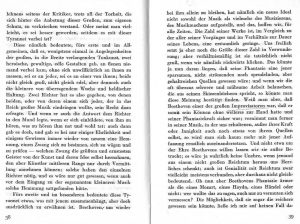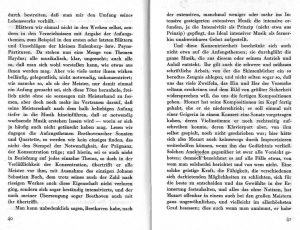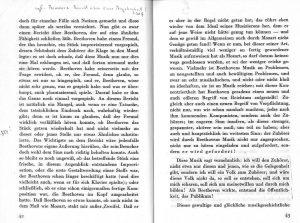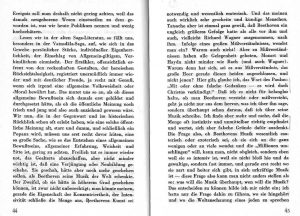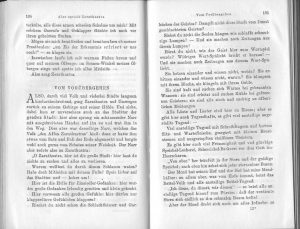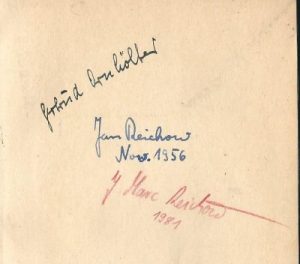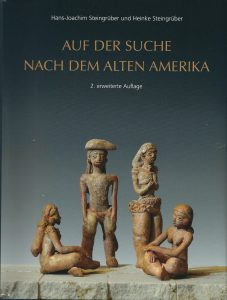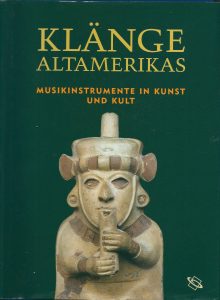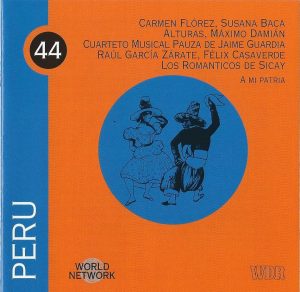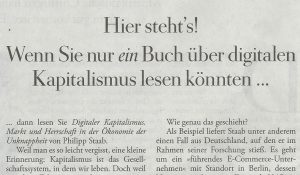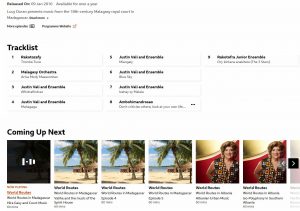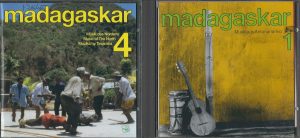Wie improvisiert kann die freie Rede sein?
In der klassischen Redekunst geht es offenbar um den freien Vortrag eines – in der Gedankenführung – detailliert vorbereiteten Textes (Quintilian). Das berühmte Beispiel des imaginierten Gebäudes, das man gemächlich durchschreiten kann, nachdem man in jedem Raum gedanklich bestimmte Themen bildhaft deponiert hat: man ruft sie der Reihe nach ab. Es ist eine effektive Gedächtnishilfe.
 Cicero gegen Catilina (Wiki hier)
Cicero gegen Catilina (Wiki hier)
Der scheinbar neue Gedanke, den Kleist einem Freund per Brief entwickelt, wird bei Wikipedia folgendermaßen wiedergegeben, nämlich:
Probleme, denen er durch Meditation nicht beikommen kann, zu lösen, indem er mit anderen darüber spricht. Dabei ist nicht wichtig, dass dem Gegenüber die Materie bekannt ist, sondern der ausschlaggebende Punkt ist das eigene Reden über den Sachverhalt. Mit dieser Methode könne man sich selbst am besten belehren: „Die Idee kommt beim Sprechen“. Kleist selbst habe diese Idee gehabt, als er beim Brüten über eine algebraische Aufgabe nicht weiter kam, aber im Gespräch mit seiner Schwester darüber eine Lösung fand. Die bereits vorhandene „dunkle Vorstellung“ wird durch das Gespräch präzisiert, da man sich durch das Reden zwingt, dem Anfang auch ein Ende hinzuzufügen (also die Gedanken zu strukturieren). Zwar kann man einen Sachverhalt auch sich selbst vortragen, doch ist das Gegenüber insofern wichtig, als es dazu zwingt, strukturiert zu reden. Zudem kann es förderlich sein, wenn der Gesprächspartner zu erkennen gibt, dass er einen „halb ausgedrückten Gedanken schon […] begriffen“ habe – Kleist geht es also nicht um die Mäeutik im Sinne Sokrates’.
Sehr einleuchtend. So ähnlich hatte ich es auch in Erinnerung, als ich dem Essay jetzt in einem Reclambändchen wiederbegegnete und den Vorgang falsch gedeutet fand: als handle es sich um eine Art Improvisation. Schon der Ansatz schien mir verfehlt, da es doch insgesamt um die Praxis des Gespräches gehen soll. Jeder weiß, dass zumindest ein gutes Gespräch unter Freunden nicht nach einem geschriebenen Leitfaden abläuft, es sei denn, das Gespräch findet vor Publikum statt und soll dicht an der vorgegebenen (!) Thematik bleiben. Aber auch ohne einen solchen Leitfaden wird man nicht von „Improvisation“ sprechen, wenn etwa Freunde einander erzählen, was ihnen so einfällt – in Rede und Gegenrede. Sprechend und zuhörend. Es ist dabei ganz selbstverständlich, dass sie reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, einander zuhören, emotionale Interjektionen einfügen („Ach!“ und „Oh!“), sich sogar ins Wort fallen („eh ichs vergesse“), unterbrechen, das Thema wechseln, assoziieren, ausschweifen, lachend zur Rückkehr mahnen („komm bitte zur Sache!“): es handelt sich keineswegs um eine Reihe von (Solo-) Improvisationen, sondern eben um ein normales Gespräch, und das sollte kein Theater sein, natürlich auch keine Talkshow. Erst wenn einer sich produziert, sich vorführt, in den Vordergrund drängt, könnte man von einer (unerbetenen) Improvisation reden. Aber weshalb diese Unschärfe der Begriffe, wenn am Text ausdrücklich ein Philosoph beteiligt ist? Er sollte dafür sorgen, dass der Begriff „Begriff“ nicht nach Belieben seinen Bedeutungsumfang verändert. Selbstverständich gibt es verschiedene Typen und „Stilhöhen“ des Gesprächs, das Telefonat, das Dienstgespräch, die Diskussion, das Steitgespräch usw. (siehe Wikipedia hier). – Kurz: das Wort Improvisation, das letztlich sein Prestige aus der Musik erhalten hat, ist in seiner Allgemeinheit relativ ungeeignet, menschliches Normalverhalten zu nobilitieren. Und bei Kleist handelt es sich offensichtlich um eine „Idee“, die jederzeit auftreten kann, auch beim Spazierengehen im Wald; sie kann beim Zwiegespräch vielleicht eher stimuliert werden und besonders willkommen sein. Der wesentliche Vorgang besteht aber darin, dass man durch das Gegenüber veranlasst wird, „die Gedanken zu strukturieren“, ein Kontinuum zu schaffen, in dem gewiss auch ein punktueller Einfall inszeniert werden kann oder beiläufig eingeflochten wird, was gerade den Charme ausmacht. Aber nicht der Geistesblitz, sondern das weiter“plätschernde“ Gespräch ist atmosphärisch die Hauptsache, was nicht despektierlich gemeint ist: Es ist nicht konfus, sondern hat – bei aller Leichtfüßigkeit – Hand und Fuß.
 Fachgespräch: Seymour Bernstein – Ben Laude
Fachgespräch: Seymour Bernstein – Ben Laude Fachgespräch: Rubinstein – Neuhaus
Fachgespräch: Rubinstein – Neuhaus
Fotos: Screenshot JR Youtube Bernstein/Laude „Chopin & Pedagogy“ / Astrid Schmidt-Neuhaus: Heinrich Neuhaus, Die Kunst des Klavierspiels, edition gerig Köln 1967 (Seite 6c)
Der Hauptfaktor, der das vielbeschworene „Köln Concert“ zu einem Paradigma gemacht hat, ist nicht dieses oder jenes Thema oder Motiv, sondern die Tatsache, dass ein sinnvolles großes Kontinuum geschaffen wurde, wie es im Jazz bis dahin vielleicht noch nicht existierte. Es war ja auch kein Gespräch, sondern allenfalls eine freie Rede am Klavier.
Berühmt wurde das Paradigma vom Streichquartett als Gespräch unter vernünftigen Leuten (Goethe). Sie reden nicht durcheinander, sondern in wechselnden Rollen, wobei das Zuhören eben auch tönt. Selbst das Durcheinanderreden könnte eine dramatisierende musikalische Funktion haben. Andererseits gibt es auch die Erfahrung, dass dem einzelnen Spaziergänger gar keine vernünftige Gedankenfolge durch den Kopf geht, sondern ein kopfloses Gewirr wiederkehrender Bilder und Phrasen, ein obstinates Mühlrad. Und erst das Gegenüber schafft den grundierenden Ernst, der verhindert, dass man nur herumalbert, eine Improvisation könnte von A bis Z aus Spiel bestehen, und das Publikum hätte seinen Spaß. Aber im Gespräch zu zweit muss man sich – bei aller Unterhaltung – gegenseitig ernst nehmen.
Man lese nach dieser improvisierten Vorbereitung die Zusammenfassung des Kleistschen Gedankengangs in Wikipedia HIER . Danach die folgenden, von mir etwas ratlos mit dem Stift durchpflügten Buchseiten:
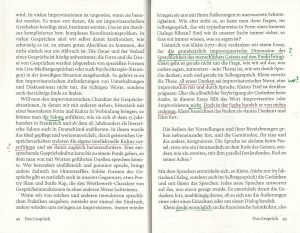
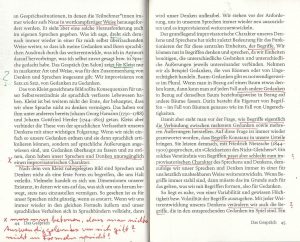
Den Originaltext von Kleist findet man im „Projekt Gutenberg“ , nämlich hier
Tatsächlich steht nirgendwo ein Wort oder ein Vorgang, aus dem sinngleich ein „Improvisieren“ oder „aus dem Stegreif reden“ abzuleiten wäre – vielleicht am ehesten der Ratschlag, einfach mal „draufloszureden“. Man könnte auch sagen: den erstbesten Einfall, der sich aus der unvorhergesehenen Situation ergibt, beim Schopf zu fassen. Wenn man Glück hat, kann man daraus etwas machen. Der quasi öffentliche Druck, der zur sofortigen Reaktion zwingt, sorgt für ein Gewicht in der Aussage. Jeder weiß, dass es danebengehen kann, man kann ins Stottern kommen, sich verhaspeln und blamieren. Man erinnert sich aber nur, wenn es gelingt. Anders als geplant, aber man muss ja mit den Folgen leben. Unter Umständen kann man den vielleicht in der Not gewählten unverschämten (?) Ausdruck nachträglich überzeugend als bewusst und gezielt gewählt interpretieren.
Wenn man sich einmal geärgert hat, wie bei einem einsamen Spaziergang die Gedanken sich im Kreise drehen, „als gehe ein Mühlrad im Kopf herum“, und man sehnt sich danach, mit einer anderen Person ein Gespräch zu führen, das aus Reden und Reagieren besteht: man hält sich schon aus Respekt an einen Gesprächsfaden. Dann versteht man auch, weshalb die indischen Weisheitslehren uns raten, Konzentration zu üben, indem wir die Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache, ein Ding, ein Wort richten und nichts anderes hereinlassen. Das berühmte „OM“ zum Beispiel. Oder einen Krug, eine Blume, eine Ganesha-Figur. Das wäre in Ordnung, zumal ich vielleicht nicht zum Beten aufgelegt bin: Konzentration hat Wert.
Zu den Menschen aber, von denen ich am wenigsten einen persönlichen Rat annehmen würde, so sehr ich sie aus anderen Gründen schätze, gehören Rousseau und Kleist. (Der eine hat den schärfsten Denker der Geschichte zutiefst beeindruckt, ich meine Kant, den der andere so gründlich missverstand, dass er – wie behauptet wurde – nur noch im Freitod eine Lösung sah.)
Jedenfalls war es nicht Kleist, der sich durch die Klarheit des philosophischen Gedankens profilierte, wie etwa Schiller. Sondern durch geschriebene Texte. Und dieser eine Text über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden ist kein Teil einer kontinuierlichen lebenslangen philosophischen Arbeit, ebensowenig wie der Text über das Marionettentheater. Es sind halt gute Einfälle, Gesprächsthemen. . . Ein Lieblingsthema war für Kleist auch das rechte Deklamieren seiner Texte, er war selten zufrieden und
„fand es unverzeihlich, daß man so wenig tue und jeder, der die Buchstaben kenne, sich einbilde, auch lesen zu können, da es doch ebenso viel Kunst erfordere, ein Gedicht zu lesen, als zu singen, und erhegte daher den Gedanken, ob man nicht, wie bei der Musik, durch Zeichen auch einem Gedichte den Vortrag andeuten könne. Er machte sogar selbst den Versuch, schrieb einzelne Strophen eines Gedichtes auf, unter welche er die Zeichen setzte, die das Heben, Tragen, Sinkenlasse der Stimme usw. andeuteten, und ließ es von den Damen lesen.“
Vonwegen: Improvisation! Der Vortrag war auch sein eigenes Problem, des öfteren ist sogar von Stottern die Rede…
Gern las er seine Werke den Freunden vor, und Frau [Hedwig] von Olfers, die Tochter Staegemanns, erinnert sich noch, »Penthesilea« und den »Prinzen von Homburg« von ihm gehört zu haben: er begann meist zaghaft, fast stotternd, und erst allmählich ward sein Vortrag freier und feuriger.
Quelle Dichter lesen / Von Gellert bis Liliencron / Marbach am Neckar 1984 / ISBN 3-7681-9978-9 / Seite 144 u. 147
Was las ich doch da oben noch? Kleist und die französische Salonkultur? Das ist wohl nur so improvisiert, belegt ist dagegen etwa folgendes:
Aus Paris schreibt Kleist am 28./29. Juli 1801, überfordert und enttäuscht von der riesigen, unpersönlichen Stadt, den so genannten Bekenntnisbrief an Adolphine von Werdeck, eine Freundin der Familie. Er ist entsetzt über die empfundene Kälte in den Beziehungen der Menschen und beklagt die Jagd nach Genuss und Vergnügen. Die Pariser Großstadtwelt mit ihren hohen Häusern, stinkenden Straßen und verschmutzen Gassen ekelt ihn an. Die Einwohner erscheinen ihm als ein Haufen von lauten, hastenden und rücksichtslosen Individuen. Die Entfremdung droht in eine persönliche Krise zu münden. Nur an der ausgestellten Kunst und dem Marmor des Louvre kann er sich „erwärmen“.
Quelle Anke Klare: Kleist in Paris hier
Über die Salonkultur in Berlin gibt es eine fabelhafte Dissertation, aus der man schon in der Internet-Vorschau soviel Wissenswertes entnehmen kann, dass man äußerst vorsichtig wird mit abwertenden oder verkürzenden Urteilen: siehe Petra Wilhelmy Der Berliner Salon im 19. Jahhundert: 1780 -1914 hier.
Bevor wir den Blick auf die Musik richten, noch einmal der Kleist-Text: hier Max-Planck-Gesellschaft hier
Manche Deutungen des Textes beziehen ihre Faszination aus den vagen Vorstellungen, die man beim Musikhören gesammelt hat: da blieb es nie bei einer 5-Sekunden-Formel, sondern man erlebte etwas durch deren Fortspinnung, Wiederkehr, erneute Fortspinnung, veränderte Wiederkehr usw., diese Dauer ist wesentlich, und die unleugbare Wirkung von Bagatellen hängt damit zusammen, dass ihnen eine übertriebene „Sprengkraft“ zugeschrieben wird. Niemals würde man nach einem Konzert von 10 Minuten zufrieden nach Hause gehen, mit der Versicherung, dass der Komponist oder der Improvisator bekannt dafür sei, dass er mit einem Tonhauch die Welt aus den Angeln zu heben vermag. Trotz Schönbergs Vorrede zu Anton Webern. Wer improvisieren kann, muss es durch eine gewisse Dauer der Vorführung beweisen, nicht gleich sein Pulver verschießen. Es hat seinen guten Grund gehabt, dass Bach – ein Wundermann der Improvisation – sich weigerte, ein kompliziertes Thema aus dem Stegreif für den preußischen König in eine 6-stimmige Fuge umzusetzen. Das Ansinnen war peinlich dilettantisch.
Man kann davon ausgehen, dass Beethoven große sonatenhafte Sätze bei guter Laune auch öffentlich improvisiert hat. Es gibt Beispiele, die er Fantasie genannt hat, er hat bekanntlich auch schriftlich ausgearbeitete Sätze „quasi una fantasia“ überschrieben. Dilettantisch war die Annahme, dass eine solche Improvisation für immer verloren war. Beethoven war ja nicht in Trance, er wusste, was er tat und konnte es zweimal nacheinander, in quasi identischer Form. Es wird auch einiges Formelwesen darin gewesen sein, geübte Techniken, samt Überschreitung jedes formelhaften Wesens. Man hat über dieses Vermögen nachgedacht, z.B. Paul Bekker (1911) und August Halm (1927), die hier beide zitiert seien. Und dem ist nichts hinzuzufügen.
Beethoven als Improvisator:
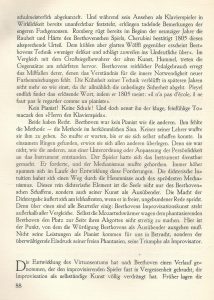

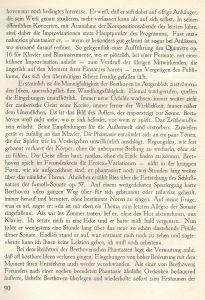
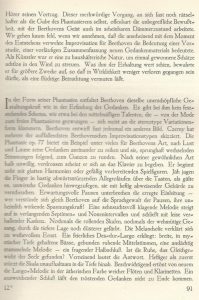
Quelle Paul Bekker: Beethoven / Verlag Schuster & Loeffler Berlin 1911
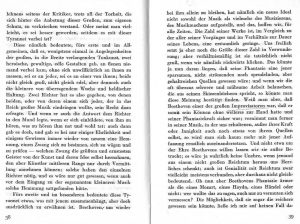
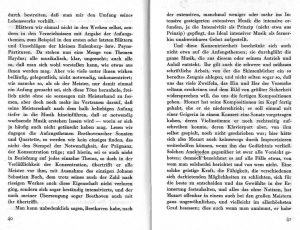
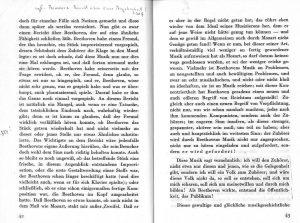
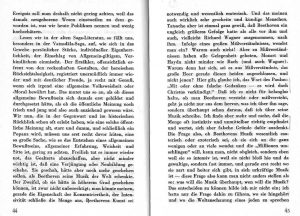
Quelle August Halm: Beethoven / Berlin 1927 / Reprint: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976
Die folgende Karikatur hat Überleitungsfunktion und soll nicht etwa Beethoven in Frage stellen:
 mehr über Cham hier
mehr über Cham hier
Wer war eigentlich Anton Kuh? Ich habe von ihm zum ersten Mal durch den Kollegen Rainer Peters erfahren, der über den ganzen Wiener Umkreis der frühen Moderne schier alles wusste. Aber damals war es noch nicht so, dass man nach Hause kam und alles am PC recherchieren konnte, was einen neugierig gemacht hatte. So wusste ich über Jahrzehnte über diesen großen Improvisator eigentlich nur, dass seine Kunst irgendwas mit Karl Kraus zu tun hatte, dessen Buch über „Die Sprache“ ich seit August 1966 besaß und im Gespräch mit meinem kleinen Sohn nicht aus den Händen legte.
(Foto)
https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Kuh hier
Ich erwähnte schon die „Bagatellen“ in der Musik, man könnte sie vielleicht in die Nähe der Aphorismen bringen, über deren Sammlung Anton Kuh 1922 anmerkte:
Die vorliegenden Aphorismen haben den Vorzug, keine zu sein. Da sie sich gegen die Sprache als Formschutz der Lüge und Kristallschliff der Eitelkeit richten, ist die Ungeschliffenheit ihre halbe Parole. Man betrachte sie im übrigen als Anfangs-, End- oder Mittelsätze von Essays, die der geneigte Leser nach Intelligenz und Neigung hiemit zu schreiben aufgefordert wird. Entstammen sie doch entgegen dem Brauch weder der Aufpeitschung des Gehirns zum Zweck ihrer Abfassung, noch intensiver Schreibtischfeilung, sondern der jahrelangen, konsequenten Faulheit ihres Autors, Bücher zu schreiben.
Quelle Anton Kuh: Von Goethe abwärts. Essays in Aussprüchen, Leipzig-Wien-Zürich, E.P.Tal & Co. 1922 / online siehe hier
Gegen Ende der Sammlung steht ein Ausspruch, der besonders gut zum Verfahren des Autors Anton Kuh selbst passt:
Die Wenigsten wissen, daß auch das Nichtschreiben die Frucht langer und mühseliger Arbeit ist.
Die Stegreif-Rede vom 25. Oktober 1925 „Der Affe Zarathustras“ hier einfacher (als pdf): hier
Vielleicht fragen Sie am Ende: was ist denn das für eine Rede, ist sie wirklich von Nietzsche? Oder ist es eine Parodie? Erfunden von Anton Kuh, Nietzsche in den Mund gelegt? Seite 49, da beginnt es mit den Worten:
Friedrich Nietzsche nämlich hat einst in einer Nacht eine
Vision gehabt: Kraus ist ihm erschienen. Nicht bloß als Person.
– Kraus mit seinem „Fackel“-Deutsch, wie er leibt, ohne zu
leben! Und nun hören Sie zu und versuchen Sie, nicht davon
erschüttert zu sein, was Nietzsche, Krausens Nietzsche-Angriff
ahnend, über Kraus und Wien schrieb. Die große Stadt, die
hier vorkommt, ist Wien. Wer Kraus ist, werden Sie erraten.
Jetzt geben Sie genau acht (liest):
(liest) steht da… er hat sich Geschriebenes mitgebracht. Und er liest es vor:
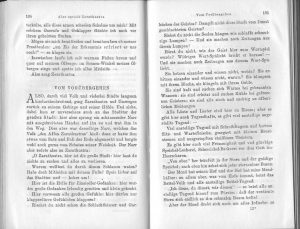
Man kennt es heute nicht mehr. Die Ausgabe von 1930. Meine Mutter (*1913) hat es wohl als Schülerin erstanden, sie schenkte es mir, und dann hat es sich jemand angeeignet, mit dem ich noch nicht gerechnet hatte.