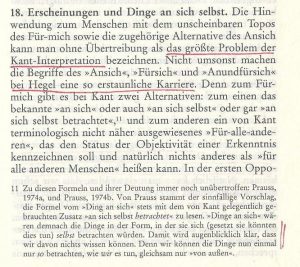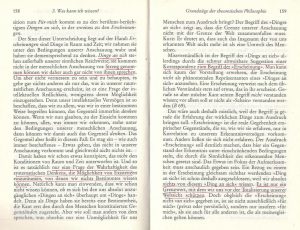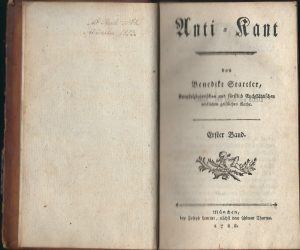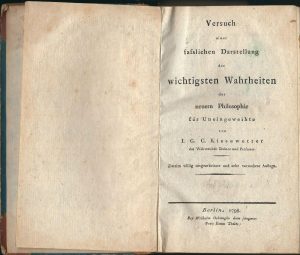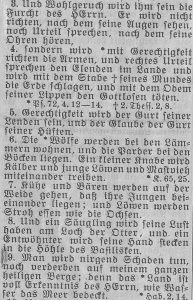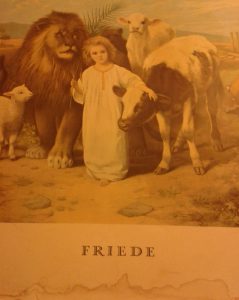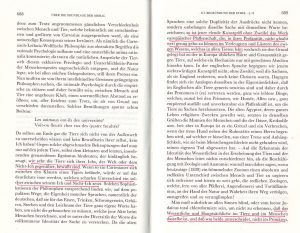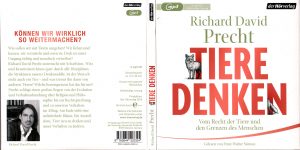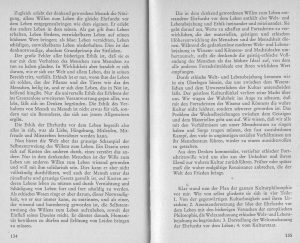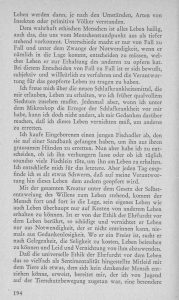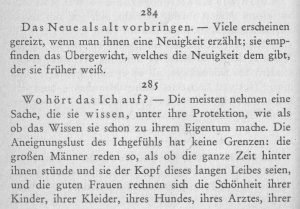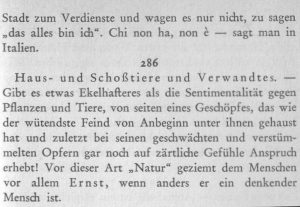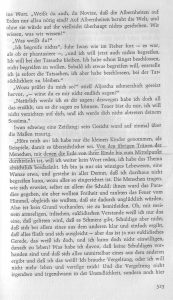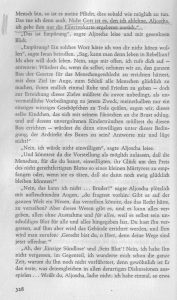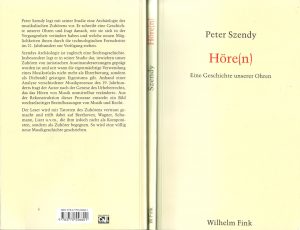Notizen aus laufender Lektüre
Zum einen beeindruckte mich bis gestern (Stunden sinnloser Wartezeit im Klinikum) das letzte Kapitel aus „Was ist Macht?“ von Byung-Chul Han, aber der gute Eindruck von neulich ist getrübt. Es geht um die „Ethik der Macht“, und schon dieser Titel erschien mir im Rückblick immer weniger einleuchtend. Wie jedes Mal geht er seine Philosophen durch: Heidegger, Foucault und Nietzsche, letzterer offenbar mit Zarathustra als effektvollem Ausklang des Buches, wenn es darum gehen soll, in machtvoller Freundlichkeit sich selbst wegzuschenken, – „wegschenken deinen Überfluss, aber du selber bis der Überflüssigste“. Das beginnt auf Seite 132 (bis Endseite 143), wo Han – ohne zu erwähnen, dass er sich wiederholt – wo er genau das hervorhebt, was er schon auf Seite 66 ausgeführt hat (mich besonders beeindruckend):
Die Macht reserviert Nietzsche nicht fürs menschliche Verhalten allein. Vielmehr wird sie zum Prinzip des Lebendigen überhaupt erhoben. So streben schon Einzeller nach Macht: »Nehmen wir den einfachsten Fall, den der primitiven Ernährung: das Protoplasma streckt sein Pseudopodien aus, um nach etwas zu suchen, was ihm widersteht – nicht aus Hunger, sondern aus Willen zur Macht.« Auch die Wahrheit wird als ein Machtgeschehen gedeutet.
Han sagt nicht, dass er aufs neue davon anhebt, um es auf eine andere Ebene zu führen, es klingt, als habe er vergessen, was er schon gesagt hat, und wirkt am Ende schwächer mitsamt dem ganzen Gerede von Freundlichkeit und Wegschenken. Zuviel Zen? Dann lieber – an dieser Stelle jedenfalls – mehr von Einzellern und Pseudopodien…
Es fiel mir alles wieder ein, als ich die neue ZEIT las, als sei es kein Zufall in meiner Situation (womöglich in der unleugbaren Spätphase des individuellen Lebens). Insbesondere der Artikel Frisch erforscht Neues vom Beginn des Lebens / von Ulrich Bahnsen. (siehe unbedingt auch hier).
Ja !!! Und dazu die ganze Seite 34: Ist Sport die beste Medizin, Herr Froböse? Zitate s.u.
Ich sehe, dass aus der neuen Wissenschaft vom Menschen ein neues Bild der Physis und der medizinisch fassbaren Vorgänge nahegelegt wird, das an die Stelle dessen getreten ist, was ich im Laufe der 50er Jahre und weit darüber hinaus für unumstößlich gehalten habe. Es sei mir also ein kritischer Exkurs in die eigene Erinnerung gestattet, gestützt auf das „Kursbuch“ meiner Mutter. Sie erwähnt nicht, in welchem Maße diese Körpermaßnahmen von ihr und ihrem Vater, meinem Großvater, beeinflusst waren (Dr.Brauchle, Dr. Malten, Dr. Becker, Are Waerland usw.); sie beanspruchten zeitlebens eine Machtposition, auch gegen meinen Vater, der 1959 starb. Ich begann eigene Wege mit Pfarrer Kneipp, über den ich in der HörZu gelesen hatte, bezog dann aber alles ziemlich naiv auf Nietzsches positivistisch verstandene Theorie vom allseitig ausgebildeten „starken Menschen“. Wir befinden uns in der Zeit gegen Ende 1956:
Manches hat sie gewusst von meiner Entwicklung, das Wesentliche aber gerade nicht (z.B. von der psychischen Wirkung der Pubertät und – von der Ausübung ihrer eigenen Machtpraxis, die einst in direkterer Form ihr Vater angewendet hatte, der erst den Enkeln gegenüber recht milde geworden war.) Ich erwähne das, weil viele Menschen unter den Prämissen der Kindheit und Jugend ein Leben lang leiden, aber später die genossene „Erziehung“ (mitsamt allen Erinnerungen) glorifizieren, weil sie nicht nicht mehr in der Lage sind, die verinnerlichten Schäden von den sicherlich vorhandenen Erfahrungen elterlicher Liebe zu trennen. Insofern behandle ich die gelegentliche Aufarbeitung an dieser Stelle nicht als streng privat.
Meine teilweise dramatische Loslösung ging von der Schule aus (AG „Moderne Lyrik“) und wurde gewissermaßen geleitet von Gottfried Benn („Provoziertes Leben)“. Auch von seinem Nietzsche-Bild. Zugleich auch jede Menge Tolstoi, mehr noch Dostojewski. Tolstois „Der Tod des Iwan Iljitsch“ – die letze große und schreckliche Geschichte, die mein Vater zufällig auch in jener Zeit zu hören bekam, bevor er starb: „das bin doch ich!“ sagte er.
All das sind nur Stichworte, aber es sind diese ausgebreiteteten Jahre, die mich als Last und Inspiration bis heute beschäftigen. Damals schwor ich mir, das Erinnerungsbuch meiner Mutter eines Tages zu korrigieren. Jetzt bin ich zugleich dankbar, dass dieser einseitige Kommentar existiert. Das genau war die damalige Zeit! Meine Erinnerung richtet sich daran auf und belebt (irritiert) mein heutiges Leben.
Die Ablösung vom Weltbild der 50er Jahre (mit dem Negativ-Narrativ über die „Schulmedizin“) habe ich mehrfach beschrieben: einmal z.B. im Versuch, das neuere Denken mit dem alten zu verbinden, etwa in Gestalt von Adolf Portmann (Wissenschaft) und Maurice Maeterlinck (Dichtung) hier. Auch hier . Der Rückblick auf meine Mutter hatte auch mit ihrem unseligen Hang zur anthroposophischen Mystifikation der Naturwissenschaft zu tun, den ich irgendwie zu retten trachtete. Es ging nicht. Siehe auch hier.
Meine Mutter ergänzte ihr mystisch angereichertes medizinisches Wissen auf die Krebserkrankung meines Vaters, als sei ihr mit Ernährung und einer Misteltherapie beizukommen. Genug davon, auch von ihrer Ansicht, dass Krankheit „Schicksal“ sei, – so hatte sie eigenen Krankheiten der Kriegsjahre (TBC, „nasse Rippenfellentzündung“) höhere Bedeutung verliehen. Das beschwerte noch meine Studienjahre, die eher der durchaus erträglichen „Leichtigkeit das Seins“ zugeneigt und zumindest theoretisch von der Balance des Geigenspiels beflügelt waren. Wobei ich nicht wahrhaben wollte, dass eine Rückgratverkrümmung für Schmerzen sorgte, die sich nicht ausbalancieren ließen. Erst die Röntgenbilder des Alters förderten die wahren Ursachen zutage. Früher, vor meinem Abitur hatte ich kurzzeitig an eine Sportkarriere gedacht, und warum nicht gleich in Fünfkampf. (Dabei hatte ich nachweisbare Erfolgserlebnisse nur im Tausendmeterlauf.) Die Idolisierung des Körperlichen kannte keine Grenzen. Man staunt über das eigene Muskelwachstum, mich konnte selbst die Ferienarbeit im Tiefbau nicht schrecken, frei nach Nietzsche: Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ich entlieh aus der Stadtbücherei neben Musikliteratur verschiedenste Trainingsanleitungen. Wir wohnten am Waldrand, und naturnah verliefen meine ausgedehnten Übungsstrecken…
Irgendwie kehrt dieses physizistische Denken heute in völlig veränderter Gestalt wieder:
 Einige Zitate aus derselben Quelle:
Einige Zitate aus derselben Quelle:
… Massage, Physiotherapie, Eisbad. Die Unsportlichen dagegen schauen zur Regeneration Netflix.
Nutzen Sie den Körper, um den Geist zu entlasten.
Die Muskulatur lebt unsere Emotionen aus. Meine Sorgen bin ich nach 20 Minuten ruhigem Laufen los. Der Grund: Meine Motorik beansprucht 50 Prozent der geistigen Kapazität. (…) es ist aber gerade Teil des Wirkmechanismus, dass Sport ein wenig anstrengend ist.
Denn Motorik und Kraft sind Garanten für Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Es geht hir um das Phänomen der Sarkopenie. Übersetzt: Verlust des Fleisches. Diese Erkrankung – zu wenig Muskelmasse, zu wenig Kraft – betrifft drei Viertel der Menschen ab dem 6o. Lebensjahr.
Unterforderung macht Arthrose, weil die Strukturen des Gelenks nicht mehr ausreichend versorgt werden. Gelenke hänge am Tropf der Bewegung! (….) der Kochenstoffwechsel wird durch Schonung reduziert.
Je älter wir werden, umso größer sollte die Belastung zum Erhalt der Muskulatur sein.
Quelle: DIE ZEIT 23. Mai 2024 Seite 34 Wem es schlecht geht, der soll sich mal schonen? Bloß nicht! Das sagt der Sportwissenschaftler Ingo Froböse. Denn der Körper brauche die Bewegung – und den guten Stress TITEL: Ist Sport die beste Medizin, Herr Froböse?
* * *
Anderes Thema
P.S. Eben halb gehört und notiert – um es aufzubewahren (bis 2099): KAFKA https://www1.wdr.de/mediathek/audio/feature-depot/index.html
Kafka-Kult. Das erstaunliche Nachleben des Franz K.
WDR 3 Kulturfeature. 01.06.2024. 54:13 Min.. Verfügbar bis 31.05.2099. WDR 3. Von Thomas von Steinaecker. (HIER)
Kafka, das ist irgendwie tiefgründig, liebenswürdig, melancholisch und abgefahren. Kurz: Kafka ist Kult. Wie aber kam es zu diesem einzigartigen Phänomen? Und was macht Kafkas Texte bis heute so herausragend? // Von Thomas von Steinaecker/ SWR 2024/ Übernahme in WDR 3