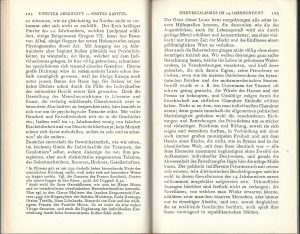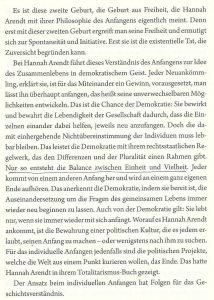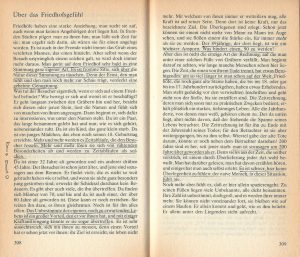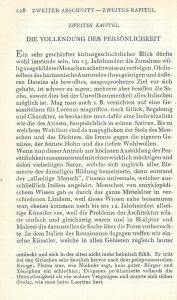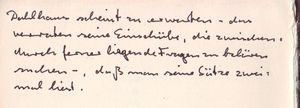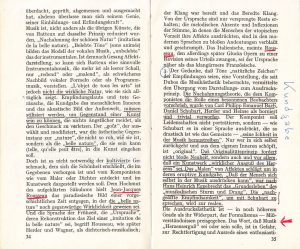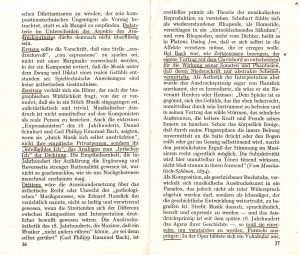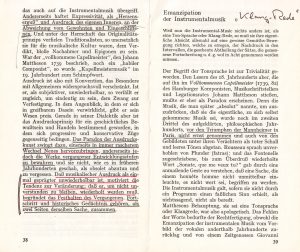Das Dossier der ZEIT umfasst 4 volle Seiten, und einige Fotos von tüchtigen alten Leuten animieren uns, ihnen nachzueifern.
Und wir sind gespannt, mit welcher Einsicht wohl der Abschluss des Artikels aufwartet. Gibt es eine allgemeine Schlussfolgerung, vielleicht ein zwar spätes, aber immer noch gültiges Lebensprogramm? Für alle?
Unter den nicht mehr ganz jungen, abgebildeten und beschriebenen muskulösen Glückspilzen fällt uns ganz besonders ein gewisser Friedhelm Adorf (83) aus Heupelzen ins Auge. Kann er es mit den neuesten Studien zur Glücksforschung aufnehmen? Lesen Sie selbst (doppelt):
Quelle DIE ZEIT 13. Juni 2024 Seite 11 ff Der Sprung ins hohe Alter von Philipp Daum
Die Kehrseite
Falsch sei es, von nur einem Elixier des Lebens zu sprechen, – könnte man denken. Man brauche mindestens soviel Medikamente, wie man Organe hat, und noch viel mehr, wenn man sehr viel Geld hat. Einer der diese Haltung vorlebt, wird in Wikipedia folgendermaßen beschrieben (im Zitat habe ich alle weiterleitenden Links eliminiert):
Anti-Aging Vorhaben
Am 13. Oktober 2021 kündigte Johnson einen Anti-Aging-Versuch an, den er „Project Blueprint“ nennt. Johnson hält sich an ein strenges Diät- und Trainingsregime, um sein Leben zu verlängern. Er gibt dabei jährlich über zwei Millionen US-Dollar für seine Gesundheit aus und soll über 100 Pillen täglich schlucken. Für seine Verjüngungskur beschäftigt er über 30 persönliche Mitarbeiter. Sein biologisches Alter soll er so um fünf Jahre verringert haben. Johnson unterzog sich auch einer Reihe Bluttranfusionen, wobei sein Sohn als Spender für eine der Transfusionen fungierte, aber verkündete später, dass er die Transfusionen aufgrund des fehlenden Nutzens nicht wiederholen wird. Er gilt auch als ein Anhänger der Nutzung von statistischer Datenauswertung und künstlicher Intelligenz, um seine Lebensführung zu optimieren und seine Gesundheit zu überwachen. Den Tod bezeichnete er in einem Interview als ein „technisches Problem, das sich lösen lässt“ und verkündete seinen Plan, ewig leben zu wollen.
Einige Experten haben den Nutzen von Johnsons Anti-Aging Kuren angezweifelt, da die Lebenserwartung zum größten Teil genetisch bedingt sei. Auf X (Twitter) lieferte sich Johnson eine Auseinandersetzung mit Elon Musk, nachdem dieser einem Post zugestimmt hatte, der behauptete, dass Johnson „viel besser aussah, bevor er anfing, 2 Millionen Dollar pro Jahr für seinen Körper auszugeben“.
Quelle: Wikipedia hier
Der Mann ist Jahrgang 1977. Da kann einer das Blaue vom Himmel herunter beschwören, der Nachweis wird nicht möglich/nötig sein, weil die eventuell interessierten Zeugen nicht mehr leben.
Ich frage mich, wieso eigentlich ein Mensch davon überzeugt sein kann, dass ausgerechnet er als Individuum von dem allgemeinen Prozess des Lebens (und Sterbens) abgekoppelt werden sollte. Vielleicht ist die Religion schuld. Meine Oma hat mir eingehämmert: „144.000 jetzt lebender Menschen werden nie sterben“, buchstäblich, und sie betete dafür, dass sie selbst und ihre beiden Enkel dazugehören. Tatsächlich: zumindest wir zwei leben noch, mein Bruder und ich!
Aber – aus welchen Gründen auch immer – hat mich das Stichwort „Individuum“ bei der Lektüre in der Klinik bewegt, zumal das passende Büchlein spielend in meine Jeanshose gepasst hatte und – dank mangelnden Neuwertes – auch rigoroses Unterstreichen zu dulden schien. Davon später mehr. (Es könnte eine lange Geschichte werden.)
Wessen ich – ebenso wie möglicherweise dieser Mann namens Bryan Johnson – vor allem bedarf, ist eine klare Anthropologie, eine Handreichung zu der Frage: Was ist der Mensch? was meine Oma? Oder auch: was überhaupt bin ich ? Vielleicht auch: Wo stehe ich in der Welt? in unserem Universum?
 Also: kein kurzer Prozess mit dem Christentum!? Bleibt es Grundlage der „Humanität“? So dass dadurch wirklich jeder zählt, und wirklich ALLE gemeint sind? Hier sind erstmalig auch die Sklaven und die Rechtlosen nicht mehr ausgeschlossen. Geht es also um das ganz große WIR, das etwa … mit den kleineren Wir-Gefühlen nur anfängt? Wir lernen in diesem Punkt ja offenbar täglich etwas dazu:
Also: kein kurzer Prozess mit dem Christentum!? Bleibt es Grundlage der „Humanität“? So dass dadurch wirklich jeder zählt, und wirklich ALLE gemeint sind? Hier sind erstmalig auch die Sklaven und die Rechtlosen nicht mehr ausgeschlossen. Geht es also um das ganz große WIR, das etwa … mit den kleineren Wir-Gefühlen nur anfängt? Wir lernen in diesem Punkt ja offenbar täglich etwas dazu:
Oder handelt es sich nur um eine Ich-Erweiterung? Sie sagen (mit Recht): das hat nichts miteinander zu tun. Auch die Christen haben genau hingeschaut, wer dazugehört und wer nicht. Egal, was es in der Theorie, etwa bei Thomas von Aquin, darüber zu lernen gab. Als kleine Warnung zitiere ich Adorno, wie schon früher einmal, als ich den Sport zu problematisieren trachtete, – möglicherweise zum Schein:
Denn zum Sport gehört nicht nur der Drang Gewalt anzutun, sondern auch der, selber zu parieren und zu leiden … Es prägt den Sportgeist nicht bloß als Relikt einer vergangenen Gesellschaftsform, sondern mehr noch vielleicht als beginnende Anpassung an die drohende neue … (ADORNO 1997, 43)
Während ich mich in den Gedankensprüngen dieses Blogs zu zügeln suche, erinnere ich mich der neuesten ZEIT-Lektüre, einem Gespräch mit Peter Sloterdijk, als er gefragt wird:
Sie haben Gesellschaften einmal als »Stressgemeinschaften« bezeichnet. Steht Europa vor der Zerreißprobe, weil der Stress – siehe Ukraine, Gaza, Klima – zu groß ist?
Sloterdijk: Das Konzept, auf das ich mich beziehe, geht auf den Kulturtheoretiker Heiner Mühlmann zurück, der in seinem Buch Die Natur der Kulturen von »Maximalstresskooperationen« spricht. Erfolgreiche Gesellschaften, so die These, sind diejenigen, die es gelernt haben, unter äußerem Druck nicht zu zerfallen, sondern zusammenzurücken. Man kann sich das gemeinsame Agieren wie die berühmte mazedonische Phalanx vorstellen. In ihr musste jeder Einzelne über seine Todesangst hinauswachsen und sich auf die Kooperation mit dem Nebenmann verlassen. Heute erwarten wir diesen Geist nur noch von unseren Fußballern. Wir wollen, dass wenigstens elf aus 80 Millionen wie eine Phalanx zusammenstehen.
Quelle DIE ZEIT 20. Juni 2024 Seite 48 Erklären Sie’s uns, Herr Sloterdijk Ist der Traum von Europa ausgeträumt? Ein Gespräch mit dem Philosophen Peter Sloterdijk in Paris (Peter Neumann)
Nebenbei: wie berühmt ist denn die mir völlig unbekannte „mazedonische Phalanx“? Siehe Wikipedia hier
Ich muss mich an dieser Stelle hüten wiedergeben zu wollen, was dieses ausgezeichnete Anthropologie-Büchlein zu Immanuel Kants Analysen der „Person“ (in ihrem großen Zusammenhang) erläutert. Oder zu dem weithin verkannten Max Stirner (und seinen „Einzelnen“ ohne jeglichen Zusammenhang). Dass er hier überraschenderweise auftaucht, erinnert mich an einige ihm gewidmete Seiten in Safranskis tollem Buch „Einzeln Sein“ (123-134). Alles zurückstellend, fahre ich fort mit dem Blick auf Adorno, dessen Gespräch mit Arnold Gehlen hier in Zitaten exemplifiziert wird. Der Autor und Herausgeber dieser „Philosophischen Anthropologie“ betont, dass Adorno die beiden Möglichkeiten (Kant und Stirner) in paradoxer Synthese zu einem emphatischen Begriff von „Subjektivität“ zusammenzudenken versucht hat, „dessen Verwirklichung die Fortschrittsgeschichte der Menschheit zwar versprochen, aber nie realisiert habe. Verheißen worden sei die Befreiung des Ich von allem Zwang, sowohl von seiten der Natur wie eines anderen Menschen. Verwirklicht worden aber sei das gerade Gegenteil.“ Die Rede ist vom „Projekt der Moderne“: – – – da es die logisch-begriffliche wie die technisch-wirkliche Unterdrückung der Natur zur Voraussetzung gehabt habe – – – (lesen Sie bitte weiter:)
Haben wir eigentlich zu Anfang dieses Blog-Artikels von Einzelnen gesprochen, die hervorragen aus der Menge der Alten, oder stillschweigend von Allen, da ja jeder Mensch die Chance haben soll, alt zu werden, ohne zu verkümmern? Wir haben schon dort darauf aufmerksam gemacht, wie die Anthropologie aus methodischen Gründen die Rubrik IV. „Der Mensch als Gesellschaftswesen“ der Rubrik V. „Der Mensch als Einzelwesen“ vorangestellt hat. Die Anthropologie oder die Soziologie? Im Büchlein folgen Auszüge aus einem Gespräch zweier Individualisten, wie sie im Buch stehen, Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen. In den 60er Jahren habe ich Adornos Radio-Vorträge auf Tonband aufgenommen und in Einzelfällen – um sie nicht zu verlieren – verschriftlicht, ein mühsames Unterfangen, siehe im Blog hier. Im folgenden Gespräch – das Stichwort „der Mensch“ ab 5:23 (als geschichtliches Wesen, von Gesellschaft geformt, „Industriekultur“, Tauschverhältnisse, Max Weber, Fortschritt „von selbst“, Mündigkeit, „Entformung“, Nivellierung durch Tausch, Produzierung der Bedürfnisse, zu den Institutionen 32:00 siehe im Büchlein wörtlich S.124, Familie, Eigentum, Sicherheit, „Institutionen schützen den Menschen vor ihm selber“, technische Begabung, neurotisch, Überflüssigkeit des Menschen ).1965.
Quelle (das „Büchlein“): Arbeitstexte für den Unterricht / Philosophische Anthropologie / Reclam 5012 [2] Für die Sekundarstufe II Herausgegeben von Hans Dierkes Stuttgart 1989
Wollen Sie wissen, ob Adornos Diagnose von der Nivellierung durch Tausch, der Entwertung der Qualität durch den Markt, der „Entformung“ – heute noch so akut ist wie damals? Aber natürlich, mehr denn je, – jedoch: was hilft’s? – ein Blick in die Familienzeitschrift Hörzu oder bestimmte Fernsehsendungen würde genügen. Nur vergessen wir längst, uns wenigstens zu empören. Und ich denke an die Tomaten, die im Garten meiner Oma wuchsen und einen spezifischen Geschmack hatten…
Man kann es keinesfalls damit bewenden lassen, dass man sich heute auf den intellektuellen Stand von vor 30 oder gar vor 60 Jahren zurückversetzt. Womit schon auf dem besten Wege wäre. Ich muss nur die Krisen der ganzen Welt beschwören, das sich verbreitende latente oder flagrante Katastrophengefühl, die Wut über die Zerstörung. Das alles ist greifbar nah! Ich wähle einen weniger lähmenden Ansatzpunkt, der mir – so hoffe ich – ein kontinuierliches Weiterdenken erlaubt. Ein Blick in das oben schon genannte Buch von Rüdiger Safranski scheint mir geeignet:
Gegen Ende des Buches kommt Safranski nochmal auf das Thema der neuen Medien:
 und nachdem er Kafkas Parabel „Vor dem Gesetz“ hinzugezogen hat – die vergebliche Frage nach dem richtigen Eingang – , schließt er mit einem Satz, der wohl auch diesem Blog-Beitrag eine vorläufig tröstliche Abrundung verleihen kann:
und nachdem er Kafkas Parabel „Vor dem Gesetz“ hinzugezogen hat – die vergebliche Frage nach dem richtigen Eingang – , schließt er mit einem Satz, der wohl auch diesem Blog-Beitrag eine vorläufig tröstliche Abrundung verleihen kann:
Doch wenigstens solange man lebt, ist es nie zu spät für den eigenen Eingang, dafür, ein Einzelner zu sein.