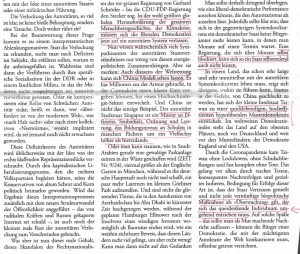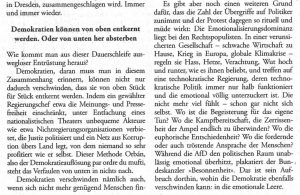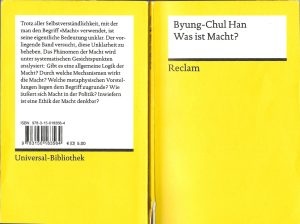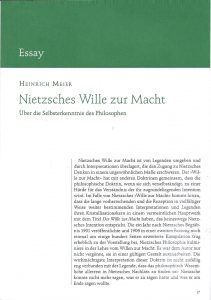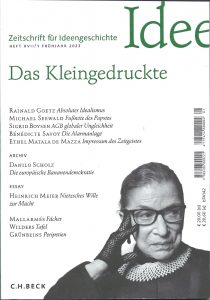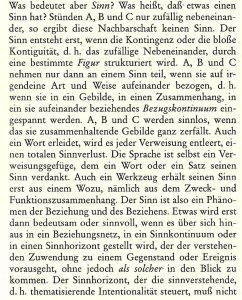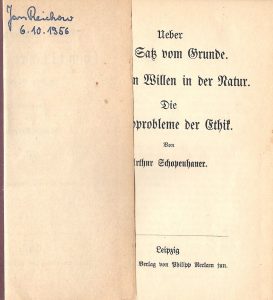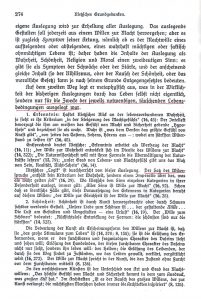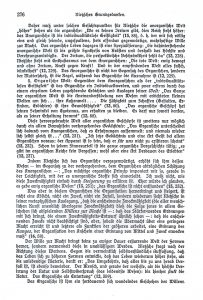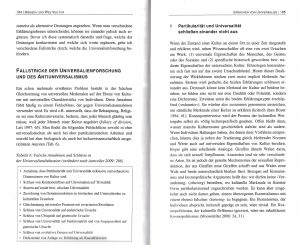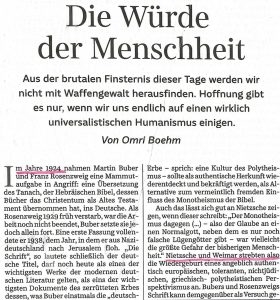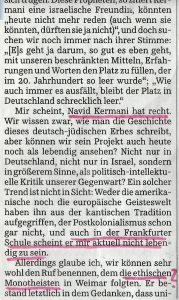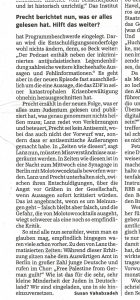Wöchentliche Orientierung, ein Irrweg?

Begleitet von der imaginierten Kritik derer, die sich auf schnelle Intuitionen verlassen, lese ich an jedem Donnerstagmorgen die ZEIT, von vorne natürlich – also zuerst die Titelseite, dann die Rückseite dieses Teils, die Inhaltsangabe Seite 14, gehe von dort meist zuerst ins Feuilleton, dann in Wissen. Ich will heute protokollieren, was für mich lebenswichtig (?) war, – weshalb ich die möglichen antibürgerlichen Kritiker ignoriere, ohne sie zwischen den Zeilen zu übersehen. Sie schauen durchs Gitterwerk. (Könnte etwa eine Täuschungsmaschinerie am Werk sein?) Ich notiere allerdings die Zeilen, die ich markiert habe. Nicht meine Gedanken, die ich vielleicht bei Gesprächen ins Offene schicke. Manche stammen von Adorno (nach seiner Rückkehr in den 50er Jahren). Aber am späten Vormittag will ich im Garten tätig gewesen sein, zumal ich Jan Schweitzer gelesen habe, Seite 41 mit „Dreieinhalb Minuten Schwitzen“.
Die Terroristen hatten es auf Juden abgesehen, aber auch auf das, wofür Juden in ihren Augen stehen: die westliche, liberale Welt, in der es möglich ist, dass junge Menschen auf einem Trance-Festival unter dem Motto »Freunde, Liebe und unendliche Freiheit« halb nackt in der Wüste tanzen. Es ging nicht nur um den Freiheitskampf der Palästinenser. Die Hamas will einen Staat nach islamischen Regeln errichten. Ihre Mitglieder würden die säkularen arabischstämmigen Jugendlichen auf der Berliner Sonnenallee verachten, die vor wenigen Tagen gemeinsam mit der antiimperialistischen Szene »Free, free Palestine« riefen.
QUELLE Sascha Chaimowicz: Dieses Schweigen / Seite 1
Dieser Sieg der Opposition ist weit über Polen hinaus bedeutsam. Das Bündnis unter Führung des ehemaligen Premiers und EU-Ratspräsidenten Donald Tusk hat bewiesen, dass der Vormarsch des Rechtspopulismus kein unabwendbares Schicksal ist – nicht einmal unter extrem schwierigen und unfairen Bedingungen.
QUELLE Jörg Lau: Willkommen zurück / Seite 1
Zu Isoldes Liebestod, am Ende der Oper, standen sie an der Rampe, und hinter ihnen ging ein goldenes Quadrat auf, leuchtete heller und heller – wie das Tor zu einer anderen Welt. Diese Idee des Bühnenbildners Erich Wonder hat mich zusammen mit Wagners Musik schwer ergriffen. (Lemke-Matwey)
… und es musste etwas passieren zwischen diesen beiden Menschen, die von ihrer Leidenschaft noch gar nichts wissen. Auf so engem Raum! Und es passierte! Mit aller Entschiedenheit. Die Wonder-Räume duldeten keine Verlegenheit, keine Schleichgänge. Nein! Jede Aktion musste groß sein, jede Aktion musste etwas bedeuten! (Waltraud Meier)
QUELLE »Der Mensch hat so viel zu sagen!« Doch jetzt ist Schluss, die Sängerin Waltraud Meier gibt ihren Abschied. Ein Gespräch über das Leben im Rampenlicht / Seite 54
Viele wollen nicht verstehen, dass wir den Mord an 1400 Israelis nicht dulden können. Ich frage die Deutschen: Würden sie so etwas hinnehmen? Gemessen an der Bevölkerungszahl wären das 10.000 ermordete und 1000 entführte Deutsche. Mich stört die Doppelmoral: Unsere Kritiker setzen Israel und Palästina gleich, fragen nicht, wer den Krieg begonnen hat. Wir kämpfen aber nicht gegen Palästinenser, sondern gegen die Hamas und den Islamischen Dschihad. Wir kämpfen nicht gegen die Iraner, sondern gegen das Mullah-Regime. Nicht gegen den Libanon, sondern gegen die Hisbollah. Am meisten ärgert mich die Forderung nach »verhältnismäßiger« Gegenwehr. (Wieso?) Was wäre denn verhältnismäßig? Sollen wir es machen wie die Hamas? Sollen wir ein Musikfestival im Gazastreifen stürmen, Frauen vergewaltigen und Kinder enthaupten? Vielleicht am Ramadan? Ohne Vorwarnung?
QUELLE »Sie lachen, während sie uns töten« Arye Sharuz Shalicar ist Sprecher der israelischen Armee. Hier berichtet er über die Gräueltaten der Hamas, warum ihm die Bilder nicht aus dem Kopf gehen – und wie es ist, sich für die militärische Gegenwehr rechtfertigen zu müssen / Seite 62
Analyse eine neuen Welt in Aufruhr, mit Hilfe der alten Theoretiker
(Thukydides, Machiavelli, Clausewitz, Herfried Münkler)
Auf die Frage – nachdem es Hoffnung gab, den nahöstlichen Raum weiter zu befrieden – woher dieses Interesse kommt an CHAOS und UNORDNUNG…
Einige haben die Annäherung zwischen Israel, Saudi-Arabien sowie den Golfstaaten in Gestalt der sogenannten Abraham-Abkommen als Befriedung des Raumes angesehen und dabei den Iran und die Palästinenser außer Acht gelassen. Die aber wären die Verlierer der Befriedung des Raumes gewesen; also haben sie nach Möglichkeiten gesucht, diese Entwicklung zu stören, zu zerstören und dabei sind sie wohl erfolgreich gewesen. Dass auch der russische Präsident Putin ein Interesse an der Eröffnung eines zweiten »Kriegsschauplatzes« hat, weil der den Westen zusätzlich in Anspruch nimmt, spielt sicherlich auch eine Rolle. Politische Akteure, die mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden sind, profitieren von Chaos und Unordnung – also befeuern sie diese.
Zur Prognose, dass es künftig fünf Machtzentren geben werde…
Die Kandidaten auf der demokratischen Bank werden die USA und die EU sein, auf der autoritären Bank Russland und China – und Indien als »Zünglein an der Waage«. Warum fünf? Sie müssen Ordnungsaufgaben übernehmen, die für sie nicht bequem sind und Anstrengung bedeuten – etwa dafür zu sorgen, dass eine Organisation wie Hamas nicht ganze Regionen in Brand setzen kann. Dafür bekommen sie etwas zurück: Einfluss. Die fünf wollen unter sich bleiben und keine anderen dabei haben, mit denen sie Macht teilen müssen. Historisch haben solche Fünferkonstellationen eine gewisse Stabilität, in der Regel zwei gegen zwei, und einer ist das Zünglein an der Waage. (…)
Die Kategorien, mit denen Sie die Lage bedenken, sind die ganz alten: Macht, Polarität, Einflusszone (…).
Vermutlich besitzen Kategorien, die sich über Jahrhunderte bewährt haben, eine höhere Erklärungskraft, auch angesichts einer sich schnell wandelnden Welt, als Theorien, die in gerade stattfindende Entwicklungen hineingeschrieben werden, von denen man aber annehmen kann, dass sie nur intellektuelle Widerspiegelungen einer augenblicklichen Lage sind. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich mit Thukydides oder Machiavelli Theoretiker nehme, die als Politiker gescheitert sind und die unter dem Gesichtspunkt ihres Scheiterns schrieben. Sie treten nicht mit dem Gestus der Selbstverliebtheit in ihre eigenen Ideen auf, wie so mancher, der zuletzt hoch im Kurs stand und angesichts der jüngsten Entwicklungen – Russland, Türkei, Hamas – jetzt vor einem Scherbenhaufen steht. (…)
Man hat den Raum vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer, von der ukrainischen Nordgrenze bis über die türkische Südgrenze hinaus bis nach Israel nicht als einen postimperialen Raum betrachtet, sondern gedacht, man könne ihn gut in Ordnung halten. Aber postimperiale Räume bringen revisionistische Akteure hervor. (…)
Ich schätze die Klassiker einer Theorie, die stark mit geschichtlichen Erfahrungen argumentiert – bei Thukydides, vor allen Dingen bei Machiavelli, aber auch bei Clausewitz, der sich mit den Hoffnungen der Aufklärung über das Verschwinden der Kriege auseinandersetzt. Bei diesen Autoren spüre ich eine Weigerung, sich täuschen zu lassen durch Wunschdenken. Denn indem man sich der Geschichte vergewissert, tritt sie als tatsächliches Geschehen an die Stelle des Gewünschten. Ich sage nicht, alles wiederhole sich eins zu eins, aber Grundkonstellationen sind bereits in der Vergangenheit immer wieder aufgetreten und werden das wohl auch in Zukunft tun. Ansonsten müsste man plausibel nachweisen, warum sich das, was sich in zweieinhalbtausend Jahren wiederholt hat, nicht mehr wiederholen wird. Für diese Erwartung gibt es keinen Grund. Mit Schopenhauer kann man sie als »ruchlosen Optimismus« bezeichnen.
Quelle: alle wörtlichen Zitate stammen aus einem Gespräch mit dem Historiker Herfried Münkler, DIE ZEIT 12. Oktober 2023 Seite 58 »Der Worst Case war nicht vorgesehen« / Gespräch Thomas E. Schmidt mit dem Politologen H.M. über Israel, Russland und das Chaos in der Welt. Wie es zwischen den großen Mächtigen ohne Kriege weitergehen könnte, beschreibt er in seinem Buch »Welt in Aufruhr«.
Eine philosophische Antwort auf die Situation in Palästina / Israel:
HIER
Für die Philosophin Susan Neiman steht fest, dass das Festhalten an der Würde aller Menschen die einzig richtige Antwort auf die Situation in Israel ist. Das bedeute, das Leid aller ernst zu nehmen. Zugleich dürfe erfahrenes Leid nicht zur Richtschnur eines politischen Handelns werden, das von Rachewünschen getrieben ist.