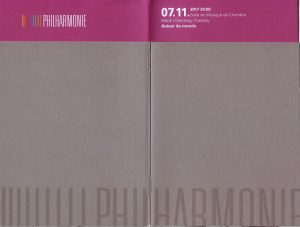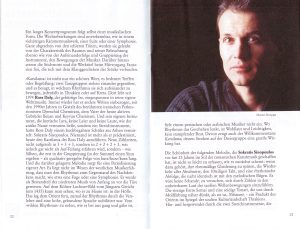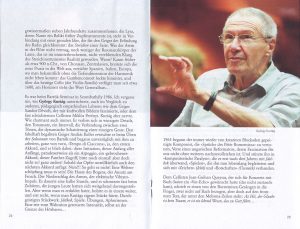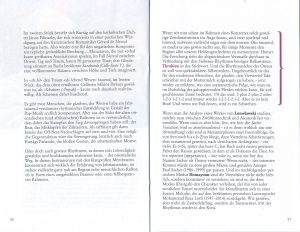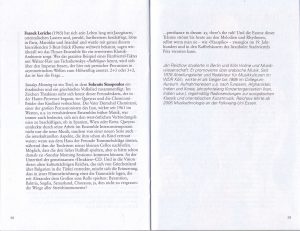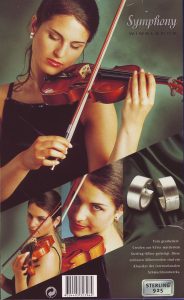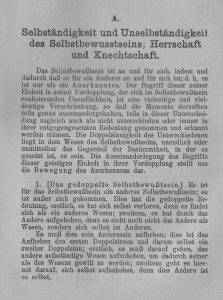Die Süddeutsche Zeitung macht’s möglich bzw. nötig oder sogar notwendig: das dort besprochene Buch muss man (?) besitzen. Autor Laurenz Lütteken. Ich bin kein Mozartforscher, aber wenn ich die wichtigsten Menschen in meinem Leben aufzählen sollte, würde dieser Komponist zu den ersten fünf gehören. (Gewiss, darin folge ich Hildesheimer, der mir die Sinne dafür geöffnet hat und der selbst Shakespeare und Mozart an erster Stelle genannt hat.) Und ich habe nicht vergessen, wie mich Così fan tutte im Jahr 2004 begleitet hat, – angeleitet, über „Lug und Trug“ nachzudenken.
ZITAT Radiosendung 2002 WDR 3 (Skript)
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich gleich mit der Tür ins Haus fallen: das schönste, innigste und hintergründigste Drei-Minuten-Stück, das je geschrieben wurde, stammt von Mozart: ein Abschiedslied – man wird den Ruf „Addio“ hören, zwei Frauen und zwei Männer verabschieden sich voneinander, ein dritter ist Zeuge, die Frauen weinen und stammeln: „Ich sterbe. Schwöre, mir jeden Tag zu schreiben!“
1) Così fan tutte / Jacobs CD I Tr. 11 Di scrivermi 2’57“ [oben – weil auf youtube leichter erreichbar – in einer anderen Aufnahme als in der Radio-Sendung damals; enthält leider auch Werbung]
Das Traurige ist eigentlich nicht, dass diese Menschen, die sich lieben, Abschied voneinander nehmen müssen, – die Männer hier täuschen die Frauen, der Zeuge, der alles eingefädelt hat, meint: „ich platze gleich, wenn ich nicht lache“, und die nichtsahnend betrogenen Frauen werden sich bald trösten lassen. Wie ehrlich aber meint es die Musik in all ihrer Schönheit???
Wäre es nicht schöner, alles stimmte überein? Der Text, das Gefühl, der Mann, die Frau, die Situation, die Musik?
Es ist spät, das Dorf liegt im Dunkel und die Welt schweigt; der Bursche gibt der Geliebten das Geleit nach Haus und redet von seiner Liebe. „Solltest du meinetwegen Schwierigkeiten bekommen, dann ist es mir recht, wenn wir uns sofort trennen.“ So etwa spricht der Bursche. Aber nun das Mädchen — wie das schon angekündigt wird: „Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht“! Josef Wenzig ist der Dichter, Johannes Brahms der Komponist. Ja, und was sagt sie nun? Marmor, Stein und Eisen…NEIN! das nun grade nicht! Aber es ist wie ein Traum, – vergessen wir nur nicht: geträumt von den Herren Wenzig und Brahms!
2) 5046 920 1 Tr. 14 „Von ewiger Liebe“ Brigitte Fassbaender 4’25“
Brigitte Fassbaender sang, am Klavier Irwin Gage.
Was für ein Aufschwung! Kann man sich ewig, ewig auf dieser Höhe halten? Der junge Mann, so kleingläubig kann er nicht gewesen sein, wie er vorgab; er hat nur dies hören wollen! „Unsere Liebe muss ewig bestehn!“
Dann ist das Lied zuende. Und der Bursche geht überglücklich ins Dorf zurück. Oder? Was meinen Sie? Kommt ihm nicht irgendwann der Gedanke: Sie hat „muss“ gesagt, sie wünscht es sich und zwar mit aller Energie, – aber warum hat sie nicht „wird“ gesagt? „Unsere Liebe wird ewig, ewig bestehn!“ Sie ist sich also nicht ganz sicher? Eines Tages könnte sie sagen: ich habe es gewollt, habe es gehofft, aber das Leben hat es nicht zugelassen. Ich kannte dich ja kaum, – usw., was dann eben alles so gesagt wird.
Nein, das wollen wir nicht weiterspinnen. Gönnen wir uns diesen schönen Traum noch einmal. Aus paritätischen Gründen singt jetzt ein Mann.
3) Brahms op.43 Nr.1 (1864) „Von ewiger Liebe“ Dietrich Fischer-Dieskau 4’39“
Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld, Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch, Ja, und die Lerche, sie schweiget nun auch.
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus, Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,
Führt sie am Weidengebüsche vorbei, Redet so viel und so mancherlei:
„Leidest du Schmach und betrübest du dich, Leidest du Schmach von andern um mich,
Werde die Liebe getrennt so geschwind, Schnell wie wir früher vereiniget sind.“
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht: „Unsere Liebe, sie trennet sich nicht!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr, Unsre Liebe ist fester noch mehr.
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um, Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Eisen und Stahl, sie können zergehn, Unsere Liebe muß ewig bestehn!“
*** *** ***
Die WDR-Sendung von damals kann man im nachfolgenden Link weiterlesen, aber ich vergesse nicht: das war in meinem anderen Leben. 24.04.2002 – WDR 3 Musikpassagen 15.05 – 17.00 Uhr
Gespaltene Gefühle: Von Lug und Trug (und ewiger Liebe) / Lieder von Johannes Brahms und Hugo Wolf / Ausschnitte aus Così fan tutte von Wolfgang Amadeus Mozart / Aufnahmen des indischen Ragas Lalita mit dem Flötisten Hariprasad Chaurasia und dem Sänger Bhimsen Joshi / Moderation: Jan Reichow / Skript der Sendung HIER.
In der SZ-Besprechung des neuen Mozartbuches schrieb Helmut Mauró u.a. über die Situation Mozarts, auch – und das ist ein sehr wichtiger Aspekt! – in steter Auseinandersetzung mit den Ideen seines Vaters:
Wie die Musik so aus ihrer untergeordneten Kunstrolle als unvollkommene Naturnachahmerin herausfand und sich über die bis dahin führende Malerei erhob, wie sie schließlich zur Leitkunst des 19. Jahrhunderts wurde, auch diesen Aspekt diskutiert Lütteken im Zusammenhang mit Mozart oder „den Mozarts“, wie man nach der Lektüre des Buches sagen muss.
Natürlich ging der Sohn dann viel weiter, richtete seine ganze Existenz auf ein neues Künstlerbild aus, riskierte viel und zwar nicht nur im Bezug auf die eigene materielle Existenz, sondern, und das ist vielleicht doch neu, auch im Bezug auf sein Werk selber. Auch Mozarts menschenfreundlicher und so lebensnaher Musik – selbst für die als Türken verkleideten Ehemänner in seiner „Così fan tutte“ gibt es einen realen Hintergrund – wurde in der Opera buffa auf einmal der schaurige Abgrund einer pragmatischen Realität. So mutig er in seinen Opern die Bedingungen des menschlichen Daseins und die soziopolitischen Bedingungen vorführt, indem er die Labilität moralischer Kategorien aufzeigt, so zielsicher demontiert er auch die eigenen Überzeugungen. Lütteken verweist auf die Schriften des Materialisten Julien Offray de La Mettrie, die in Wien damals kursierten – und verboten waren. Für Mettrie war die Seele keine göttliche Inspiration, sondern das Resultat komplexer Körperfunktionen.
Diese Haltung scheint in Mozarts Opere buffe nicht nur durch, er erweitert, etwa in „Così fan tutte“, das Spiel um Affekte und Erotik gegenüber dem Drama, das schon die Anlage eines radikalen Gesellschaftsexperiments aufweist, um eine entscheidende Komponente: Er stellt nun auch die von ihm geschaffene Musik selber auf die Probe. Er unterläuft die kalkulierte Wirkung auf das Publikum, vor allem durch eine neue harmonische Doppelbödigkeit, die eine einzige musikalische Wahrheit unmöglich macht. Im Moment der größten Wirkung seiner Komposition muss Mozart erkennen, dass seine Musik „keine wahre Seele mehr hat“. Da ist auch die aufklärerische Vernunft bestenfalls nur ein Notanker. Lütteken zitiert einen Brief Mozarts an seine Frau aus dieser Zeit: „Es ist alles kalt für mich – eiskalt. Ja wenn du bei mir wärest, da würde ich vielleicht an dem artigen Betragen der Leute gegen mich mehr Vergnügen finden, – so ist es aber so leer.“
Quelle Süddeutsche Zeitung 27. Dezember 2017 Seite 12 So kalt, so leer Leopolds Meisterschüler – Laurenz Lütteken zeigt Mozarts aufklärerischen Ehrgeiz und sein tragisch-logisches Ende / Von Helmut Mauró
Zu Julien Offray de La Mettrie siehe auch den ZEIT-Artikel von Rudolf Walther: Weder Gott noch Zufall / Das wilde Denken des Julien Offray de La Mettrie / aufzufinden Hier
Die abschließenden Sätze des SZ-Artikels geben wohl eher die Assoziationen des Journalisten als die des Mozartforschers wieder, sind aber durchaus nachzuvollziehen:
Man kann nicht umhin, zu denken, Mozart habe durch sein eigenes Werk psychisch-metaphysischen Selbstmord begangen; der körperliche Zerfall und frühe Tod wären dann nur logische Folge, also Symptome. Lütteken sagt das nicht, aber seine Darstellung erklärt so viel von der tiefen Traurigkeit, die den Komponisten Mozart in einer kalten Dezembernacht aus der Welt hinaustrieb.
Das heißt auch: es gibt in Sachen Mozart nur den Weg, sich auf denselben Wissensstand zu bringen, der durch das neue Buch umrissen ist.
Vielleicht handelt es sich um eine ähnliche Aporie, wie sie sich am Ende des Bachschen Lebensweges einstellte. Man findet sie in dem Buch von Peter Schleuning über die „Kunst der Fuge“ zumindest angedeutet: selbst der vollkommenste Komponist muss gerade an dem Denkrahmen scheitern, dessen Belastungsfähigkeit er bis zum äußersten ausgetestet hatte. Darüberhinaus gibt es nichts. NICHTS.
P.S.
Zweifellos bin ich gestern am Ende übers Ziel hinausgeschossen. Ein Grund mehr, das Buch selbst zu studieren. Oder einstweilen noch die Rezension von Peter Gülke einzubeziehen und zu überdenken: Hier.
Zumal, wenn man sich hier befindet: