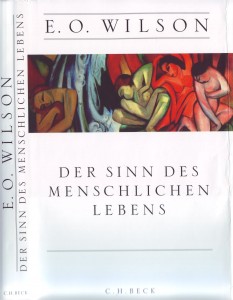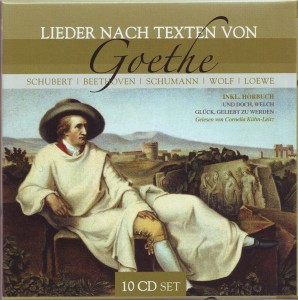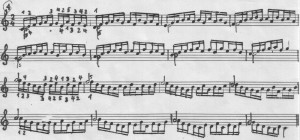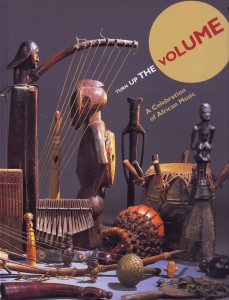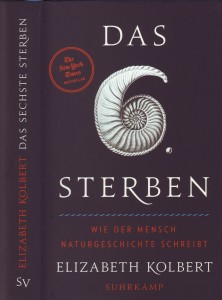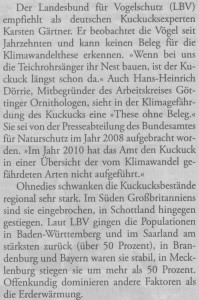Was ist das?
Das Wort „absolut“ wird heute inflationär gebraucht (so häufig wie „genau“ oder „definitiv“, als Antwort genau dort, wo ein schlichtes „ja“ definitiv genügen würde), daher meint man häufig, ein absolutes Gehör sei ein besonders gutes Gehör, eine hervorragende Hörfähigkeit im musikalischen Sinn. In Wahrheit bezeichnet es nur die Fähigkeit, einen Ton auf Anhieb mit dem richtigen Namen zu benennen. Oder ihn ohne Überlegung mit der richtigen Klaviertaste zu assoziieren.
Wenn ich eine Weile keine Musik gehört habe und den Ton einer Kirchenglocke benennen möchte, stell ich mir kurz vor, wie ich die Geige anspiele, höre innerlich die beiden Saiten d‘ und a‘ als Quinte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Oboist den Ton a‘ angibt, also den Kammerton, mit dem das Ensemble einstimmt. Und dann kann ich sagen: die Kirchenglocke hat den Ton G oder E. Ich vergewissere mich aber gern mit einer Stimmgabel, – unfehlbar bin ich durchaus nicht. Wenn ich am Schreibtisch sitze, überprüfe ich mich, indem ich den Telefonhörer abnehme und den Freiton höre, – es ist das eingestrichene a‘.
Ich habe also ein relatives Gehör; ich bestimme also bei Bedarf die Töne relativ zu einem mir bekannten Ton. Wenn ich weiß, dass ich Schuberts „Unvollendete“ aufgelegt habe, sehe ich natürlich die Töne im Notenbild vor meinem geistigen Auge: den Anfangston H, ich weiß ja, dass sie in h-moll steht und so beginnt. Ich weiß auch im voraus, dass der zweite Satz in E-dur steht und höre ihn so im voraus. Aber die Tonarten (die Bezugstöne) wechseln während des Ablaufs der Musik, und ich konzentriere mich keinesfalls darauf, den Wechsel fortwährend benennen zu können. Musik ist kein Quiz. Vieles geht allerdings intuitiv „von selbst“, ich weiß z.B. wie die leeren Saiten der Streichinstrumente klingen und nehme sie wahr, ohne das wichtig zu finden.
Absolutes Gehör ist anders. Ich habe in einem Interview einmal die Violaspielerin Tabea Zimmermann gefragt, was sie als erstes denkt, wenn sie sich die „Concertante“ von Mozart vorstellt. Da sang sie, ohne eine Sekunde zu überlegen, sehr bestimmt den Ton es‘, – „diesen Ton, bzw. den Es-dur-Akkord, mit dem das Orchester einsetzt“, sagte sie. Das ist absolutes Gehör.
Es kann ein Problem beim Hören und Benennen geben, wenn der Kammerton in der alten Musik einen halben Ton tiefer gesetzt ist. Oder sagen wir, man würde von einer historischen Orgel begleitet, die einen dreiviertel Ton tiefer eingestimmt ist: man müsste diese Stimmung natürlich genau übernehmen und hätte möglicherweise fortwährend mit einer gravierenden Irritation zu kämpfen.
In den „Wissenschaftsgesprächen“ des ZEIT-Magazins sprach Stefan Klein mit der Psychologin Diana Deutsch über das Phänomen des absoluten Gehörs, das nur ein Mensch unter 10 000 besitze. Und sie relativierte, das sei nur in unserer Kultur so:
Aber wo die Menschen eine tonale Sprache wie Mandarin sprechen, ist das anders. Ich bemerkte das zufällig, als ich versuchte, chinesische Wörter nachzusprechen. Mein Gegenüber wusste nicht, was ich meine. Da versuchte ich es in einer anderen Tonlage. Plötzlich verstand er mich. So kam ich auf die Idee, zu untersuchen, wie häufig das absolute Gehör unter chinesischen und amerikanischen Musikern ist. Zwei Jahre lang fragte ich bei Konservatorien an, ob sie an der Studie teilnehmen wollten. Aber es war zum Verzweifeln: Hier in Amerika sagte man mir, dass die Erhebung unmöglich sei, weil selbst unter hochbegabten Studenten so gut wie niemand Tonhöhen auf Anhieb erkenne. Die Chinesen fanden mein Vorhaben unsinnig: Man wisse doch, dass Musiker diese Fähigkeit hätten! Schließlich fanden sich zwei Hochschulen. Heraus kam, was die Leute an den Konservatorien mir vorausgesagt hatten: In den USA hatte fast niemand das absolute Gehör, in China hatten es sehr viele.
(Stefan Klein: Man könnte genetische Gründe vermuten.)
Wir haben uns chinesischstämmige Amerikaner angesehen. Nur diejenigen, in deren Elternhaus Chinesisch gesprochen wurde, schnitten gut ab in unserem Test.
(Stefan Klein: Dann wäre das absolute Gehör also nicht angeboren, sondern erlernt.)
Es ist auch angeboren – und zwar jedem Menschen, wie mir scheint. Nur müssen Sie rechtzeitig im Leben Gebrauch davon machen, sonst geht es verloren. Und das heißt während der Sprachentwicklung. Je früher in Ihrer Kindheit die Chinesen übrigens mit dem Musikunterricht angefangen hatten, um so genauer hörten sie auch.
Quelle ZEIT MAGAZIN Nr. 50, 10. Dezember 2015 Stefan Kleins Wissenschaftsgespräche (27) Mit der Psychologin Diana Deutsch über die Geheimnisse der Musik (Seite 20)
Sehr interessant auch der Rest des Gespräches z.B. über Links-Rechts-Vertauschung, akustische Täuschungen etc. siehe auch im 2 Zeilen höher gegebenen Link zu Wikipedia. Auch über frühe Sprachen und Gesang. Vögel, die Duett singen, siehe auch xxx, aber neu: wenn einer der beiden Vögel stirbt, kann der Überlebende sogar den Part des anderen übernehmen.
(Fortsetzung folgt)