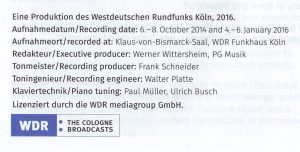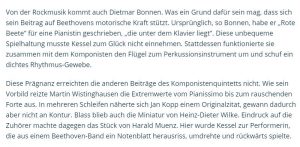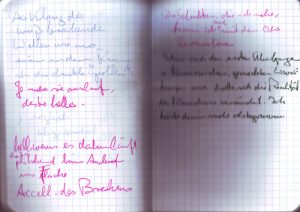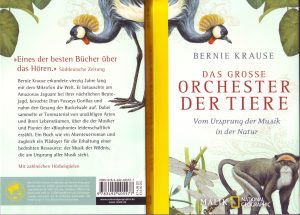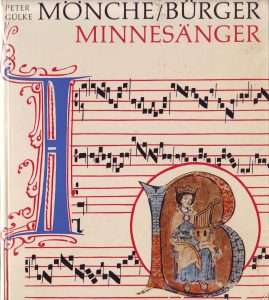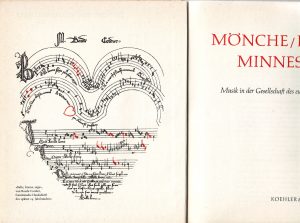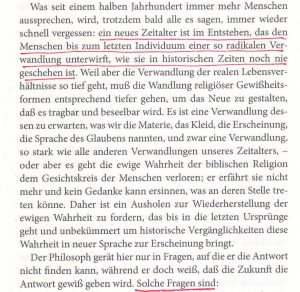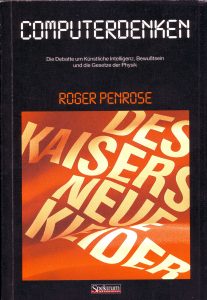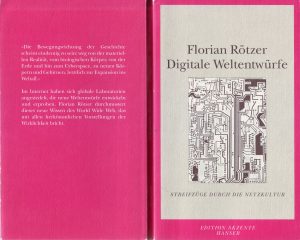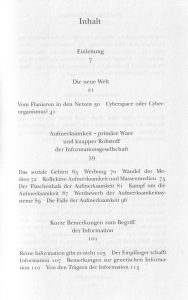…lassen sich kaum „aus dem Bauch heraus“ treffen
Es sei denn, man hat es oft geübt oder einiges dazu gelesen. Das kann die Einschätzung des Kopftuchtragens ebenso betreffen wie die Fan-Proteste beim Fußball oder die Angst vor dem Corona-Virus. Und wenn man in der Presse etwas gelesen hat, wodurch das eigene Für und Wider umgeschwenkt ist (und wieder zurück), neigt man dazu, der Presse die Schuld zu geben. Am besten, so scheint es dann, greift man das vielgebrauchte (und ungewollt eingeübte) Schimpfwort Lügenpresse auf… Falsch! Nichts ist falscher als das: nicht die andere (von meiner vorgefassten abweichende) Meinung ist schuld, sondern die komplexe Sachlage, die fast immer mehrere Sichten gestattet, und dann wäre es einfach eine davon, auf welche ich mich festlege, ohne noch weitere Argumente hinnehmen zu wollen.
Wenn ich es aber offen lasse, bedeutet das nicht, dass es mir egal wird, ich beobachte die Sache mit hoffentlich klarem Sinn für Ambivalenz und entscheide in dem Augenblick, wo es akut wird, und zwar, als geschehe es „aus dem Bauch heraus“. Aber nur dann.
Auch heute ging es mir so – natürlich auf Grundlage der Presselektüre: sie gibt mir nicht nur Argumente, sondern auch die Zeit, – einfach so als Muße oder auch zum Strukturieren eigener Gedankengänge, die über das wilde Assozieren hinausgehen, – das ja auch einen Sinn hat oder annehmen kann, wie eine Zettelsammlung oder ein großes Blatt Papier, auf dem man (un)willkürliche Einfälle notiert.
Wenn ich die Namen nenne, höre ich schon die Aufschreie: Waaas? Komm mir nur nicht damit, das ist ja eine ganz Linke (oder Rechte), ein Wirrkopf sondergleichen, dieser gelernte Oberlehrer usw. usw., das wäre genau das, was ich günstigenfalls schon hinter mir habe. Ich könnte also zur Sache drängen. Oder mit Ausweichmanövern reagieren. Zum Beispiel indem ich sage, dass ich nichts gegen den Islam habe, außer wenn die Moslems einen „Ungläubigen“ anders traktieren als einen Gläubigen der anderen Schriftreligionen. Oder: Fußball ist ein Sport für Proleten und Professoren und alles dazwischen.
Ich nenne etwa die Namen Sonja Zekri (Kopftuch und Islam), Lothar Müller (Epidemie und Journalismus), Bernd Schwickerath (Fußball und Plutokratie) und gestehe, dass ich während der Lektüre einige Male das Smartphone bemüht habe, Stichworte „Gentrifizierung“ und „Spanische Grippe“. Ich könnte auch Sätze zitieren: „Aber um ihn selbst geht es ja nicht. Hopp ist das Symbol. Für einen gentrifizierten Fußball, den sich Milliardäre als Hobby gönnen. Ein chemisch reines Produkt ohne Fankurven.“ Oder selber erfinden: Die schlimmste Seuche der Neuzeit hat mehr Opfer gekostet als der Erste Weltkrieg. Diesen aber haben sich die Völker zusätzlich geleistet. Das Wort „Spanische Grippe“ hat man erfunden, weil Spanien damals das einzige Land mit freier Presse war und über die Krankheit berichtet hat (nicht nur über den siegreichen Kriegsverlauf wo auch immer).
Ich schließe mit den Quellenangaben und Dank an die Presse.
Quellen
Süddeutsche Zeitung 29.Februar/1.März 2020 Seite 15 Verhüllen, um zu zeigen (Kopftuch-Urteil und Vorurteil) / Von Sonja Zekri
SZ (wie vor) 29. Februar/1.März 2020 Seite 15 Der Seuchen-Reporter Seit es die moderne Öffentlichkeit gibt, erfassen Infektionskrankheiten die Gesellschaften, ehe die physischen Erreger sie erreicht haben. Mit Daniel Defoes „A Journal of the Plague Year“ beginnt das Zeitalter der Prävention in der Weltliteratur / Von Lothar Müller
WZ/Solinger Tageblatt 02.03.2020 Seite 2 Meinung und Analyse DFB setzt auf Härte – und die Spirale dreht sich weiter Von Bernd Schwickerath
Des weiteren lese ich (im NMZ Newsletter 28. Februar 2020):
Corona-Virus: Deutsche Konzert- und Tourneeveranstalter bangen um ihre Existenz
Nachdem in Norditalien und der Schweiz größere Musik- und Sportveranstaltungen nicht mehr stattfinden dürfen und auch in Deutschland bereits erste Messeveranstaltungen abgesagt wurden, bangen auch die deutschen Konzert- und Tourneeveranstalter um ihre Existenz.
* * *
Was bleibt? Einer der wichtigsten Grundsätze „Komplexität aushalten“.
Sonja Zekri: „Nur in einer Gesellschaft, die Muslimen misstraut, weil sie Muslime sind, ganz gleich, ob gläubig oder säkular, kann die demonstrative Verhüllung zu einem Ausdruck der Selbstbehauptung werden. Sie ist eben nicht Unterwerfungsgeste, sondern auch ein Aufbegehren gegen das Urteil der Mehrheit darüber, wer ein Muslim ist und wie er zu sein hat. Dieses Ineinanderspiel von kultureller Identität und politischem Appell, Abgrenzung und Integrationsbemühen ist, zugegeben, etwas verwirrend.“ (Siehe oben angegebene SZ-Kolumne)
Was bedeutet es eigentlich, wenn im Text „Der Seuchen-Reporter“ das Aufkommen von „Print 2.0“ erwähnt wird? Ich empfehle unter dem Stichwort „Web 2.0“ nachzulesen: Wikipedia hier. Dort besonders unter „Hintergrund“, „Verbreitung des Begriffs“ und „Charakteristika“. Es hatte bei mir mit dem Zwang zur Neugestaltung meines Lebens (nach 2005) durch Wegfall bzw. Reduzierung der „Plattform Rundfunk“ zu tun. Nicht zufällig erscheint im Wikipedia-Artikel dieselbe Jahreszahl auf (davon hatte ich damals keine Ahnung, mir half JMR auf die Sprünge):
ZITAT Wikipedia Print 2.0
Folgende Entwicklungen haben ab etwa 2005 aus Sicht der Befürworter des Begriffs zur veränderten Nutzung des Internets beigetragen:
- Die Trennung von lokal verteilter und zentraler Datenhaltung schwindet: Auch Anwender ohne überdurchschnittliche technische Kenntnis oder Anwendungserfahrung benutzen Datenspeicher im Internet (etwa für Fotos). Lokale Anwendungen greifen auf Anwendungen im Netz zu; Suchmaschinen greifen auf lokale Daten zu.
- Die Trennung lokaler und netzbasierter Anwendungen schwindet: Programme aktualisieren sich selbstständig über das Internet, laden Module bei Bedarf nach und immer mehr Anwendungen benutzen einen Internet-Browser als Benutzerschnittstelle.
- Es ist nicht mehr die Regel, die einzelnen Dienste getrennt zu nutzen, sondern die Webinhalte verschiedener Dienste werden über offene Programmierschnittstellen nahtlos zu neuen Diensten verbunden (siehe Mashups).
- Durch Neuerungen beim Programmieren browsergestützter Anwendungen kann ein Benutzer auch ohne Programmierkenntnisse viel leichter als bisher aktiv an der Informations- und Meinungsverbreitung teilnehmen (siehe User-generated content)
Soweit der Wikipedia-Artikel „Print 2.0“. Ich hatte damals eigentlich etwas ganz Anderes geplant. Nämlich ein System zu nutzen, das eine neue visuell vermittelte Form des Denkens ermöglichte (und mich irgendwie an die Gedankenentwicklung bei der Ausarbeitung von Radio-Sendungen erinnerte: mit Hilfe großer Papierbögen, auf die sich die einzelnen Motiv-Areale verteilen und mit Linien verbinden ließen. (folgt)
* * *
Was ich jetzt lieber geschrieben hätte:
Etwas über einen ZEIT-Artikel von Judith Butler (über Hegels „Herr und Knecht“), dann über Philosophinnen von Hypatia (s.a. hier) bis Judith Butler (nach dem Philosophie-Magazin Sonderausgabe 13 / Oktober 2019), etwas Kritisches über Knausgårds Wiedergabe der Kritik eines Kollegen an Munchs Bildnis seiner Schwester Inger Munch in schwarz, denn mir gefällt das Schwarz (weil ich kein Fachmann bin). Dann vor allem – angeregt durch Judith Butler – über Hegels „Herr und Knecht“ anhand anderer Quellen. (Es geht um Selbst-Bewusstsein, jedenfalls mehr als um Selbstbewusstsein.)
Und auch über die dionysische Erregtheit schriller Instrumente des Altertums, die im Vorderen Orient besänftigt wurden und erst in dieser Form bei uns eine modische Begeisterung für ethnisch inspirierte Melancholie auslösten. Aulos in der griechischen Antike und Memet im alten Ägypten, Duduki in Armenien.
 (Wikipedia hier)
(Wikipedia hier)