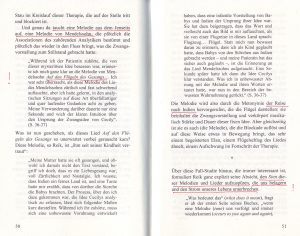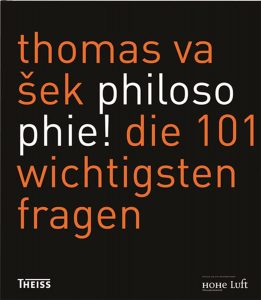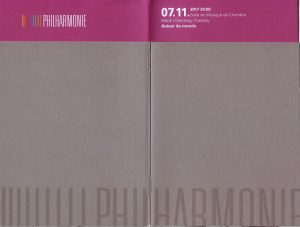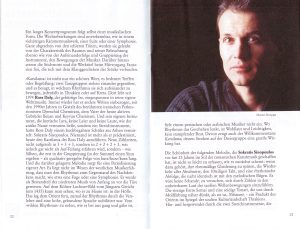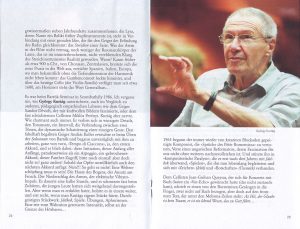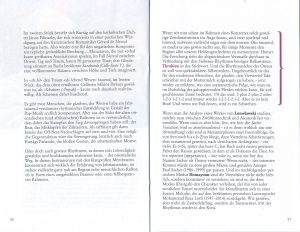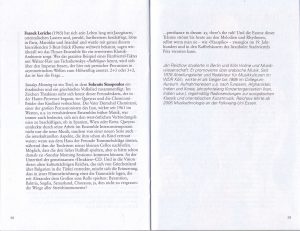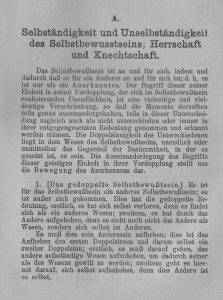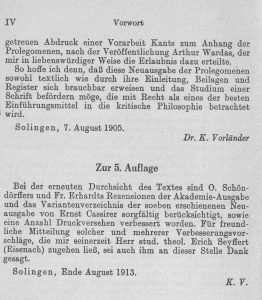Kurze Bilanz (privat)
Es scheint, als sei das tägliche Exerzitium (siehe hier) ins Stocken geraten, weil die Berichte fehlen. Einerseits ja, andererseits nein. Das Praeludium b-moll BWV 891 braucht viel länger als gedacht, die Fuge voraussichtlich nicht weniger, also bleibt Beethoven op.111 vorläufig zurückgestellt, zumal eine neue Streichquartett-Saison naht (op.130 ab 6. Februar). – Und Hermann Keller tut mir den Gefallen, meine musikalischen Themen miteinander zu verbinden:
Praeludium und Fuge in b-moll dürfen […] als der Gipfel angesehen werden, was kontrapunktische Kunst und gedankliche Strenge angeht. Sie machen es weder dem Spieler noch dem Hörer leicht. Das Präludium, eine dreistimmige Invention – die größte, die Bach geschrieben hat -, verzichtet auf jede rhythmische und harmonische Belebung; und es ist keine geringere Anstrengung, der Fuge zu folgen als der Fuge in der Hammerklaviersonate von Beethoven. [Es ist etwas missverständlich formuliert, weil man das Praeludium ebenfalls als Fuge deuten kann, und wenn Keller jetzt gleich mit dem Wort Thema fortfährt, muss man erst auf die Noten schauen, um zu sehen: er spricht also doch wieder vom Praeludium. JR] Wer aber in sie eingedrungen ist, hat einen Blick in die Werkstatt Bachs getan, wie ihn der Spieler der Sonaten op. 106 – 111 von Beethoven in den Schaffensprozess des Wiener Meisters tun kann. Schon das Thema ist von ungewöhnlicher Ausdehnung. In seiner vollständigen Gestalt zeigt es sich erst im Sopran (T.8):
 bei Keller S.178
bei Keller S.178 bei Dürr S. 414
bei Dürr S. 414
Die Literatur Hermann Keller: Das Wohltemperierte Klavier von J.S.Bach / Bärenreiter Kassel 1965 // Alfred Dürr: Johann Sebastian Bach Das Wohltemperierte Klavier / Bärenreiter Kassel 1998) // Christoph Bergner: Studien zur Form der Präludiebn des Wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach / Hänssler Verlag Neuhausen-Stuttgart 1986 //
Man muss sich dieses Themas – seines Umrisses und seiner Doppelgestalt – absolut sicher sein, ehe man sich an die Analyse der Form macht. Aber nicht nur dies: sondern auch den Tonfall der Satzteile erfasst haben, spielend, ehe man die Zäsuren setzt. Natürlich eher mitgedachten als gespielten Zäsuren. Zum erstenmal habe ich mich von einer Analyse des tüchtigen Christoph Bergner distanziert, weil ihm offenbar der Nachweis der Proportionen über alles ging:
Bereits das Konditional unterstellt eine Absicht Bachs, die nicht nachvollziehbar sein muss (aber hier dazu dient, die Anzahl der Takte hinsichtlich der Proportion plausibel zu machen). Der Fehler jedoch entsteht viel früher, nämlich schon in der Beurteilung des Taktes 30, der nicht als formale Zäsur zu deuten ist, sondern als das Gegenteil: als Verschleifung einer Zäsur: zwar beginnt das Thema in Takt 31 auf der ersten Zählzeit, – aber der Dominantseptakkord auf As dauert an und wird zunächst nur beiläufig aufgelöst, erst der nächste Takt kadenziert ausdrücklich mit IV -V – (I).
Die wichtige Zäsur liegt bereits in der Auflösung des Taktes 24 (25 auf Zählzeit 1), die nächste in der Auflösung des Taktes 42 (43 auf Zählzeit 1). Erst mit Ende dieses Teils träfen wir wieder mit Bergner zusammen auf Takt 54/55 ein. Mit seinen Proportionen hätten wir nichts mehr zu tun. Wir hätten also 24 + 17, dann 13, dann (reprisenartig, aber in es-moll einsetzend) 15 + 14. Das ist zwar keine mathematisch glänzende Lösung, aber eine musikalisch sehr befriedigende. Darüberhinaus stimmt sie dem Vorschlag von Alfred Dürr überein. (Übrigens ist es mir ernst, das lang gehaltene hohe As durch neuen Anschlag auf der 1 der beiden nächsten Takte (vorschlagend!) lebendig zu halten.)
Ich glaube, dass bei einem Stück dieser Länge die taktgenaue, rechnerische Balance der Proportionen keine Rolle spielt. Es wäre also nur eine Marotte des Analytikers, könnte auch dem Komponisten am Herzen liegen. Aber das musikalische Gewicht der Teilabschnitte entwickelt (!) sich auf andere Weise, nämlich durch die Intensität der Linien und des Harmonieganges.
* * *
Da es mir immer verlockender erscheint, Themen zu verbinden, statt sie unverbunden nebeneinanderzusetzen – um so erstaunlicher finde ich, dass viele Menschen die Phänomene, für die sie sich interessieren, „parataktisch“ zu behandeln: also als separate , auch mit Aberglauben durchsetzte Vorstellungen zu behandeln – neige ich auch dazu, solche Musikstücke als einen klanggewordenen „Bewusstseinsstrom“ zu behandeln: anders gestaltet als der, der uns im Alltag von morgens bis abends begleitet: die „Gedanken“ verteilen sich in einer schönen Regelmäßigkeit.
(Fortsetzung folgt: zum Thema Bewusstsein)
Hier sollte es nochmals um Artikel gehen, denen ich in Thomas Vašeks Buch der 1001 Fragen folge. Aber noch mehr die spannenden Ergänzungen, die gerade in der Zeitung zu lesen waren, geeignet, das Problem der „Qualia“ auf überraschende Art und Weise zu lösen…
Der Privatsender würde jetzt sagen: Also bleiben Sie dran!
Vašek: philosophie! die 1001 wichtigsten fragen / Theiss / Hohe Luft / WBG / 2017 / ISBN 978-3-8062-3631-6 / (Seite 15)
Ich betone von Zeit zu Zeit: es ist vor allem für mich! Nicht aus egozentrischer Anmaßung, – ich will es einfach nicht vergessen, und lade andere Menschen nur ein, daran teilzunehmen. Es soll aber niemanden verpflichten oder beeindrucken, denn vielleicht muss ein anderer andere Gedankengänge entwickeln, die ihn lebendiger machen (denn darum geht es! Wie hat es Humboldt noch gesagt?). Und dies hebe ich nicht hervor, um mich zu isolieren oder herauszustreichen: sondern um mich von „populistischen“ Ansätzen zu befreien. ALSO: Bewusstsein! Ein Dauerlink auf meinem Display, den ich vor langer Zeit gesetzt habe, führt zu einem Artikel von Peter Bieri (der Philosoph, der z.B. hinter „Nachtzug nach Lissabon“ steckte) und war bei ZEIT online komplikationslos abzurufen (inzwischen muss man sich registrieren, was auch keine Zumutung ist: siehe hier). Titel: Fühlen, um zu erkennen. In seiner monatlichen Kolumne für das ZEITmagazin LEBEN befasst sich der Philosoph und Schriftsteller Peter Bieri diesmal mit der Frage: Was macht Bewusstsein zu einem Rätsel? (2007)
Heute schaue ich also bei Thomas Vašek nach, um in aller Kürze einen Gedanken zu fassen. Und denke an die beiden genannten Autoren, wenn ich etwas Neues zum Thema in einer guten Zeitung entdecke. So las ich kürzlich (24.01.18) in der FAZ folgenden Artikelbeginn (und wusste, dass er mich noch viel Zeit kosten würde):
Bewusstsein ist ein einzigartiges wissenschaftliches Rätsel. Nicht nur Neurowissenschaftler haben keine grundlegende Erklärung, wie es aus physikalischen Hirnzuständen entsteht. Sondern es ist prinzipiell fraglich, ob wir je eine Lösung dafür haben werden. Astronomen wundern sich über dunkle Materie, Geologen suchen nach den Ursprüngen des Lebens, Biomediziner versuchen, den Krebs zu verstehen: Das sind alles schwierige Probleme, doch wir haben zumindest eine Idee, wie wir sie angehen, und grobe Vorstellungen, wie ihre Lösungen aussehen könnten. Unsere Erfahrung in der ersten Person hingegen liegt jenseits traditioneller naturwissenschaftlicher Methoden. Der australische Philosoph David Chalmers spricht vom harten Problem des Bewusstseins.
Doch vielleicht ist Bewusstsein nicht das einzige Thema, das solche Probleme bereitet. Die alten Naturphilosophen Gottfried Leibniz und Immanuel Kant rangen mit einem weniger bekannten, aber gleichermaßen harten Problem der Materie. Was ist physikalische Materie in und aus sich selbst, hinter der mathematischen Struktur, wie sie die Physik beschreibt? Auch dieses Problem scheint jenseits der traditionellen Methoden der Wissenschaft zu liegen. Denn alles, was wir beobachten können, ist, was Materie tut, nicht, was sie in sich ist. Wir kennen die „Software“ des Universums, aber nicht seine letzte „Hardware“.
Oberflächlich betrachtet, scheinen die beiden Probleme vollständig getrennt. Aber bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sie sehr tief verbunden sein könnten. Bewusstsein ist ein vielschichtiges Phänomen, subjektive Erfahrung ist sein rätselhaftester Aspekt.
Und der Artikel endet folgendermaßen (ich habe ihn vorsichtshalber nach dem Auffinden im Internet sofort kopiert und gespeichert – und immer noch nicht durchgearbeitet):
Die Möglichkeit, dass Bewusstsein der wirklich konkrete Stoff der Realität ist, also die fundamentale Hardware, die die Software unserer physikalischen Theorien implementiert, ist und bleibt eine radikale Idee. Sie stellt unser gewohntes Bild auf den Kopf, so dass man sie vielleicht schwer fassen kann. Doch es mag sein, dass man so die härtesten Probleme der Naturwissenschaft und der Philosophie auf einen Schlag löst.
Aus dem Englischen von Matthias Rugel
Die norwegische Philosophin Hedda Hassel Mørch arbeitet an der Universität Oslo und zurzeit am Center for Mind, Brain and Consciousness der New York University und ist regelmäßige Gastforscherin am Center for Sleep and Consciousness der University of Wisconsin-Madison. Der Text ist erstmals im April 2017 in der Zeitschrift „Nautilus“ erschienen.
[Rote Farbe und Links von mir hinzugefügt: JR]
13.01.2018 Der FAZ-Artikel ist inzwischen auf der Website der Philosophin abzurufen. Oder auch direkt: hier.