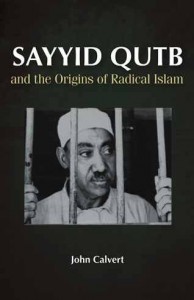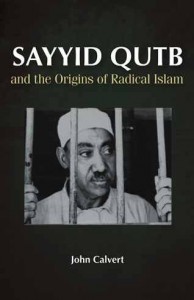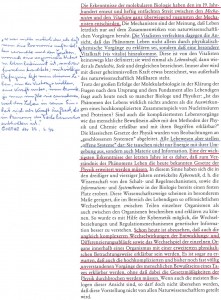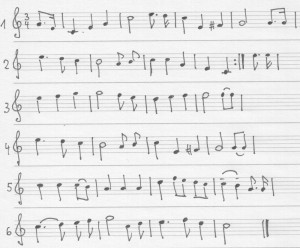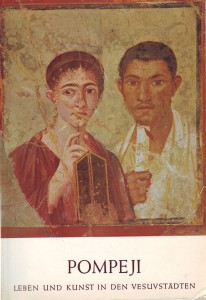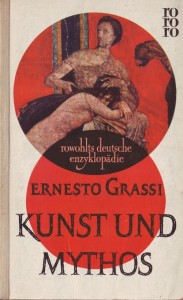Ein biographischer Essay von Hans Mauritz (Teil II ! Teil I siehe HIER)
Für Sayyed Qutb war die Reise nach Amerika alles andere als Erfüllung eines Traums. Um den unbequemen Publizisten loszuwerden, schickt ihn das Erziehungsministerium, vielleicht auf Anordnung des Palastes, auf „Mission“, mit dem vagen Auftrag, in den Staaten über Lehrpläne und Pädagogik zu forschen. Abgrenzung und Ablehnung prägen seine Reise von Anfang an. Bei der Überfahrt setzt er durch, dass er mit moslemischen Passagieren und nubischen Matrosen das Freitagsgebet verrichten darf. Eine betrunkene, halb nackte Dame, die in seine Kabine eindringen will, weist er empört hinaus. Aus seinen Briefen und Aufzeichnungen wird ersichtlich, dass er das Land nicht mit den Augen eines Mannes sieht, der neue Horizonte entdecken will. Auf den Strassen von New York erblickt er Menschen, die „auf der Suche nach ihrer Beute“ fieberhaft dahingetrieben werden, „scharfe funkelnde Blicke, voll von Gier, Verlangen und Lüsternheit“, und begreift, dass sie dabei sind, einem „Leben in Völlerei, Genuss, Gelüsten und Konsum“ nachzujagen. Bald quält ihn das Heimweh und die Sehnsucht nach Freunden: „Wie sehr brauche ich jemanden, mit dem ich über andere Themen als Geld, Filmstars und Automodelle sprechen könnte“. Die amerikanische Kultur sieht er beherrscht von American Football, Cowboy-Filmen, Thrillern und dem seichten Small Talk, der auf Partys herrscht.Was Sayyed Qutb entdeckt, ist ein von Materialismus geprägtes Land, ohne spirituelle Dimension.
Am State College of Education in der Kleinstadt Greeley im Bundesstaat Colorado verbessert er sein Englisch, lässt sich aber sonst nicht ernsthaft auf Studium und Forschung ein. Im Gegensatz zu Taha, der sich in Frankreich allen Prüfungen stellt, um „Diplome zu erlangen, die keiner seiner Mitbürger jemals vor ihm erworben hatte“, ist Qutb zu solchen Herausforderungen nicht bereit. Das Leben in der amerikanischen Provinz beobachtet er scharf und reagiert darauf mit Unverständnis und Ablehnung. Die Amerikaner, meint er, leben nicht in solidarischer Gemeinschaft, sondern abgeschottet, jeder für sich selbst. Ihre Welt hört auf an ihrem Gartenzaun, und Gartenarbeit ist ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Was er vermisst, ist wahre Lebensfreude. Zutiefst erniedrigt fühlt er sich, als ihm der Zutritt in ein Kino verwehrt wird, weil man ihn wegen seines dunklen Teints für einen Afro-Amerikaner hält. Heftig attackiert er den Rassismus der Weissen: „Sie sprechen über Farbige, auch über Ägypter und Araber allgemein, als wären sie nur halbe Menschen (…). Ich habe erlebt, wie sie die Farbigen mit verabscheuenswürdiger Arroganz und widerlicher Barbarei behandeln.“ Trotz der zahlreichen Kirchen, meint er, sei niemand so weit entfernt von Spiritualität und Heiligkeit der Religion. Eine Tanzveranstaltung, die in Anwesenheit des Geistlichen in den Räumen einer Kirchgemeinde stattfindet, widert ihn an: „Arme legten sich um Taillen, Lippen trafen auf Lippen, Brüste auf Brüste, und die Atmosphäre war angefüllt mit Leidenschaft“. Den unerfahrenen keuschenTräumer, der einem weiblichen Idealbild huldigt, empört der ungezwungene Umgang zwischen den Geschlechtern und die Freizügigkeit in Sachen Erotik und Sexualität. Sayyed Qutb, der sich schon in Kairo entwurzelt fühlte, den die vom Westen inspirierte Lebensweise abstiess, der in der liberalen Wirtschaftordnung nichts als Egoismus, Kolonialismus und Ausbeutung sah, wird der Aufenthalt in Amerika in seiner radikalen Opposition bestärken und weiter treiben auf einem Weg, der Heil und Rettung allein im Islam sucht.
Abdel Nasser
Nach seiner Rückkehr aus Amerika verstärkt Sayyed Qutb seine Annäherung an die Moslembruderschaft und ihre Positionen. Die amerikanischen Erfahrungen fliessen in seine Schriften ein. In seinem Buch „Der Kampf zwischen Islam und Kapitalismus“ (1951) konstatiert er, dass in Ägypten der Landbesitz noch immer genau so ungerecht verteilt ist wie zur Zeit der Feudalherrschaft. Der Staat schützt nicht die Interessen der Mehrheit, sondern jene der Elite und der ausländischen Investoren. Materielle Abhängigkeit vom Westen hat ideologische Abhängigkeit hervorgebracht, und daraus ist eine Generation von „braunen Engländern“ entstanden, die ihre ägyptisch-arabische und islamische Identität verlieren. Qutbs Angriff gegen den Kapitalismus bedeutet jedoch keineswegs, dass er mit dem Kommunismus sympathisert, denn dessen Atheismus würde die Ägypter ihrer angeborenen Spiritualität berauben.
Im Herbst und Winter 1951/52 erheben sich die Ägypter gegen die britischen Besatzer. In Ismailiyya demonstrieren und sterben Polizisten, Arbeiter, Azharis und Studenten. Gegen den Willen ihrer Führer kämpfen auch Moslembrüder in vorderster Linie. In Kairo Down Town brechen Feuersbrünste aus: vor allem Etablissements, die Ausländern gehören, gehen in Flammen auf, über 700 Betriebe und Geschäfte werden zerstört. Bevorzugte Ziele sind Kinos, Bars, Tanzlokale und Treffpunkte der Schickeria wie das Café Groppi am Midân Talat Harb.
Wenige Tage vor dem Staatsstreich der Freien Offiziere am 23. Juli 1952 kommt es zu einem geheimen Treffen zwischen Abdel Nasser und seinen Verschwörern mit ausgewählten Moslembrüdern im Haus von Sayyed Qutb. Die Freien Offiziziere brauchen die Zusammenarbeit der Moslembrüder, damit diese ihren Einfluss auf die Massen geltend machen. Qutb seinerseits sieht gemeinsame Anliegen wie soziale Gerechtigkeit, nationale Unabhängigkeit und Annäherung an die arabisch-islamische Welt und an die blockfreien Staaten. Er hofft, die Revolutionäre könnten zum Vehikel werden für die Renaissance des Islam. Im August wird er eingeladen, im Offiziersclub von Zamalek einen Vortrag zu halten über „Intellektuelle und spirituelle Befreiung im Islam“. Unter den Zuhörern ist Abdel Nasser selbst, der ihm gratuliert und seinen Schutz verspricht. Qutb wird zu einer Art kulturellen Beraters des Revolutionsrates und träumt davon, eine Führungsrolle als Architekt des neuen Ägyptens zu einzunehmen. Je mehr aber der Revolutionsrat die Kontrolle über den Staat übernimmt, desto mehr trüben sich die Beziehungen zu den Moslembrüdern. Die Offiziere wollen ihre Macht nicht an einen Konkurrenten verlieren, der eine weit grössere Anhängerschaft im Volk besitzt als sie.
Als Nasser im Dezember 1952 die politischen Parteien verbieten lässt, bleibt die Moslembrüderschaft zunächst verschont. Als Reaktion auf die Verschlechterung der Lage tritt Sayyed Qutb im Februar 1953 auch offiziell den Moslembrüdern bei. Er fühlt sich wie neu geboren und avanciert rasch zum Mitglied der Führung und zum Chef der Propaganda-Abteilung. Im Januar 1954 befiehlt Abdel Nasser die Auflösung der Organisation. Mit 450 anderen wird Qutb vorübergehend festgenommen. Als im Oktober 1954 ein Moslembruder auf Nasser schiesst, der vor einer Viertelmillion von Anhängern in Alexandria spricht, ist dies willkommener Vorwand, um mit den Brüdern aufzuräumen. Sie werden vor ein Volkstribunal gestellt und angeklagt, einen blutigen Aufstand geplant zu haben. Qutb wird gefoltert, „anti-gouvernementaler Aktivität“ beschuldigt und zu fünfzehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Von seiner Zelle aus muss er die positiven Errungenschaften des Regimes zur Kenntnis nehmen: Bodenreform und Landverteilung an die kleinen Bauern, Verstaatlichung von Grossgrundbesitz und ausländischem Eigentum, kostenlosen Schulbesuch, Industrialisierung , Nationalisierung des Suez-Kanals und Bau des Aswân-Staudammes, Gesundheitsfürsorge, Bau von Wohnungen für die Armen und Trinkwasser für alle: Anliegen ganz im Geiste Qutbs, aber realisiert von einem Gewaltregime, das nach seiner Überzeugung gegen die Werte des Islam verstösst.
Die „Flitterwochen“ zwischen Säkularen, Modernisten und Sozialisten auf der einen und Traditionalisten und „Islamisten“ auf der anderen Seite haben nur wenige Monate Bestand gehabt. Wie wäre wohl Ägyptens Geschichte verlaufen, wenn statt der Gewaltspirale auf beiden Seiten Kompromiss, Zusammenarbeit und Austausch von Ideen stattgefunden hätte? Stattdessen haben sich die beiden Lager brutal bekämpft. Seit der Revolution von 2011 hat sich der Konflikt verschärft. Die Moslembrüder hatten unter Morsi ihre „Chance“, haben sie verspielt und sind vom politischen Parkett verschwunden. Ihre Aktivisten warten im Gefängnis auf ihren Prozess, andere Islamisten sind abgetaucht und haben sich im schlimmsten Fall jenen angeschlossen, die anderswo einen „islamischen Staat“ errichten wollen. (16)
Sayyed Qutb hat neun Jahre im Tura-Gefängnis verbracht und miterlebt, wie Gefangene geprügelt, gefoltert und von Hunden zerfleischt wurden. Hier, berichten Zeugen, verliert er die letzten Illusionen, was den moslemischen Charakter des Nasser-Regimes angeht. Seine im Kerker entstandenen Schriften „Im Schatten des Islam“ und „Zeichen auf dem Weg“ rechnen ab mit einem Regime, von der er aus eigener Anschauung nur die Konzentrationslager kennt (17). Wer Sayyeds Lebensgeschichte verfolgt, kann nachvollziehen, wie sich ein „aufgeklärter“ Publizist zu einem Denker wandelt, der sein Heil einzig im Islam sucht. Was wir jedoch nicht akzeptieren dürfen, ist das totalitäre Programm, das er nun verkündet und das weiterwirkt bis in den radikalen Islamismus unserer Tage.
„Zeichen auf dem Weg“ zur Gottesherrschaft
Sayyed Qutb analysiert nicht nur das Nasser-Regime, sondern alle Staatsformen, welche die Welt beherrschen, seien sie kapitalistischer, sozialistischer oder faschistischer Natur. Alle sind von Grund auf böse, weil in ihnen die Souveränität الحكيميّة , „al-hakîmiyya“, nicht in Gottes Hand liegt, sondern in der Hand eines Diktators, einer herrschenden Klasse oder Partei (18). Herrschaft des Menschen über Menschen aber führt unweigerlich zu Unterdrückung. Nur die Herrschaft Gottes und seines Gesetzes, der Sharî‘a, in einem durch und durch islamisch geprägten Staat befreit von Tyrannei, Armut, Angst und Laster (19). Staatsformen, in welchen Menschen wie Götzen angebetet werden, gehören für Qutb zu الجاهليّة , „al-jâhiliyya“, der Zeit heidnischer Ignoranz und Barbarei, die vor dem Siegeszug des Islam geherrscht hat und in den Diktaturen des 20.Jahrhunderts auferstanden ist. In solchen Gesellschaften unterdrückt der Starke den Schwachen, häufen Individuen unglaubliche Reichtümer an, verdrängen Materialismus und Egoismus die Sorge um das Wohl der Allgemeinheit und breiten Dekadenz und Unmoral sich aus (20). Als جاهيلي (heidnisch, ignorant, barbarisch) brandmarkt Sayyed Qutb aussereheliche Beziehungen und Homosexualität, und er verurteilt Frauen, die sich ihr attraktives Aussehen und ihren Sexappeal zunutze machen, um im Beruf Erfolg zu haben, statt sich der Erziehung ihrer Kinder zu widmen. Die Jâhilîyya prägt nicht allein die „heidnischen“ Gesellschaftssysteme, sondern hat auch alle moslemischen Gesellschaften der Moderne infiziert, so sehr, dass nicht nur moslemische Regimes, sondern ganze Völker ausserhalb des wahren Islam leben. Auch wer an Allah und seinen Propheten glaubt, betet, fastet und nach Mekka pilgert, verharrt in Barbarei und Ignoranz, solange sein Leben „nicht gegründet ist auf Unterwerfung unter Gott allein.“
Moderne Regimes sind nur schwer zu stürzen, denn sie stützen sich auf Militär und Polizei. Qutb glaubt nicht, dass die Moslembrüder dies ändern, indem sie am politischen Leben teilnehmen, es unterwandern und Schritt für Schritt zur Macht gelangen. Er hofft auch nicht auf einen Aufstand der Massen, denn diese hat man durch Zuckerbrot und Peitsche, durch Gewalt und Propaganda zu gefügigen Untertanen gemacht. Er sieht das Heil allein in einer Avant-Garde, الطليعة „al-Talî’a“ , einer auserwählten Schar von Moslems, welche die Menschen zum wahren Islam zurückführen und zu professionellen Revolutionären werden, welche das Regime zu Fall bringen. „Predigen allein genügt nicht mehr, um die Herrschaft Gottes auf Erden zu etablieren“.
Allahs Herrschaft kann nur errichtet werden, wenn sie sich nicht auf die moslemische Welt beschränkt. Damit sie universal wird, muss zum جهاد „al-jihâd“ aufgerufen werden. Der Verbstamm ج ه د meint „sich bemühen, sich anstrengen, streben, kämpfen“ und „den heiligen Krieg gegen Ungläubige führen“. Der Begriff ist im Koran nicht frei von Ambiguität. Während manche Theologen den Akzent auf „einen geistigen Kampf“ legen, der darauf zielt, Begierden und böse Neigungen zu zügeln, und andere den heiligen Krieg nur dann erlauben, wenn Moslems von Ungläubigen angegriffen werden, rechtfertigen wiederum andere den Jihad als „Krieg gegen alle, die nicht an Allah glauben.“ Sayyed Qutb verkündet, „dass der Islam (die Hingabe an Allah) eine universale Botschaft ist, welche die ganze Welt akzeptieren oder mit der sie Frieden schliessen sollte. (…) Der Islam ist die wahre Zivilisation.“ Seine Botschaft ist totalitär: „Es gibt nichts jenseits des Glaubens außer Unglauben, nichts jenseits des Islam außer Jâhîliyya, nichts jenseits der Wahrheit außer Unwahrheit.“
Zwar ermahnt er ungestüme Kämpfer zur Geduld: die Avant-Garde braucht eine lange Zeit spiritueller Vorbereitung. Ihre Kämpfer sollen sich zurückziehen, sich abschotten von der Welt, um sich von Irrtümern und Lastern nicht kontaminieren zu lassen. Erst nach dieser Zeit des „Rückzugs“ und der erfolgreichen Mission unter moslemischen Massen wird man zum Angriff übergehen. Allahs Religion „hat das Recht, alle Hindernisse zu zerstören, die in Form von Institutionen und Traditionen die Wahlfreiheit des Menschen einschränken (…). Sie greift keine Individuen an, noch zwingt sie sie, ihren Glauben anzunehmen (…). Der Islam verbietet Moslems, ihre Feinde zu foltern und zu erniedrigen.“ Wie diese Avant-Garde aber Institutionen zerstören und Staaten zerschlagen will, ohne auch Unschuldige zu treffen, sagt er nicht.
Durch Intervention des irakischen Präsidenten wird Sayyed Qutb 1964 auf freien Fuss gesetzt, aber weniger als ein Jahr später zusammen mit Tausenden seiner Gefährten wieder festgenommen, weil Nassers Geheimdienste angeblich einen Umsturzversuch der Moslembrüder aufgedeckt haben. Sein Todesurteil führt zu Protesten in der moslemischen Welt. Am 29. August 1966 wird Sayyed Qutb gehängt. Das Problem der islamistischen Gewalt ist damit freilich nicht gelöst. Qutb wird zum شهيد „shahîd“, zum Märtyrer, der für seinen Glauben gestorben ist (21). Seine „Wegzeichen“ werden zur programmatischen Schrift. Im Oktober 1981, elf Jahre nach Nassers Tod, wird sein Nachfolger al-Sadât von Jihadisten umgebracht. Eine Generation später wird Osama Ben Laden eine Strategie entwickeln, die den Terror exportiert und sich dabei die Errungenschaften moderner Massenkommunikation zunutze macht. Die letzten Monate haben in Syrien und im Irak gezeigt, wozu die Gewalt von Islamisten fähig ist. Wir können nicht entscheiden, ob Sayyed Qutb all dies gebilligt hätte. Was er geschrieben hat, wirkt jedoch programmatisch fort und bietet manchen Interpretationen Raum: „Wir müssen den Ungläubigen den Islam nicht rational erklären (…), wir werden mit ihnen äusserst offen sein: die Ignoranz, in der du lebst, macht dich unrein, und Allah möchte dich reinigen (…), das Leben, welches du lebst, ist niedrig, und Allah möchte dich erhöhen“. Was Sayyed Qutb verschweigt, sind die Konsequenzen: wer sich nicht „reinigen“ und „erhöhen“ lassen will, dem wehe Gott! Wer das folgende Bekenntnis eines IS-Kämpfers von heute liest, kann nicht umhin, an Qutb zu denken: „Der Islam ist die einzig wahre Religion. Weltweit haben wir leider keinen einzigen echten islamischen Staat (…). Wenn man für eine gute Sache tötet, ist das legitim (…). Wenn Allah sagt, es ist erlaubt, solche Menschen zu töten, dann würde ich das auch machen. Ich folge seinen Gesetzen blind (…). Ich würde sogar meine Familie töten, wenn sie sich gegen den islamischen Staat stellt (…) In zwanzig, dreissig Jahren haben wir das geschafft. Wir kämpfen so lange, bis der ganze Planet islamisch ist.“ (22)
Anmerkungen
-
Taha Hussein, „Kindheitstage“, „Jugendjahre in Kairo“ und „Weltbürger zwischen Kairo und Paris“, Edition Orient, 1985 ff. Das arabische Original الآيام “al-ayâm“, „Die Tage“, ist in drei Bänden 1926, 1940 und 1955 erschienen. Vgl. Hans Mauritz, „Taha Hussein – vom blinden Jungen aus Oberägypten zum Dichterfürsten“, http://www.leben-in-luxor.de/luxor_essays_mauritz_taha.html
-
Sayyed Qutb, „Kindheit auf dem Lande. Ein ägyptischer Moslembruder erinnert sich“, aus dem Arabischen von Horst Hein, Edition Orient 1997. Das Original ist unter dem Titel طفل من القرية „Tifl min al-qarya“ 1946 erschienen.
-
„Was Taha Hussein a fellol?” siehe HIER.
-
Dabei spielten gerade im geistigen Leben von Musha die Sufi-Orden eine wichtige Rolle. Vgl. Nicholas Hopkins „Sufi Organization in Rural Asyut: The Riffa’iyya in Musha”, in “Upper Egypt. Identity and Change”, The American University in Cairo Press, 2004.
-
عفريت „’ifrît“ pl. عفاريت“’afârît“ sind Dämonen und Teufel, die im Volksglauben noch heute lebendig sind.
-
القرينة ist „ein weiblicher Dämon der Frauen, bes. Kindbettdämonin“ (Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.)
-
Vgl. den Roman von Mansura Eseddin, „Hinter dem Paradies“, Zürich 2011. In einem Interview gesteht die Schriftstellerin, wie sehr sie vom Mysteriösen und Unheimlichen fasziniert ist: „Der Wahnsinn fasziniert mich, die Frage, wie das wilde Tier aus dem Menschen herausbricht (…). Sie würden sich wundern, wie elementar meine Ängste sind“. (H.Mauritz, „Gestohlenes Leben. Die ägyptische Schriftstellerin Mansura Eseddin“, KEMET 4/2013, pp.73-76). Das Motiv des Zwillings, der sich nachts in eine Katze verwandelt, behandelt Hassan Abd al-Mawgud in seinem Roman „Das Auge des Katers“, Lisan-Verlag, Basel 2006.
-
Auch heute noch haben ägyptische Eltern die Wahl, ihre Kinder in Staatsschulen oder in von al-Azhar geführten Instituten einzuschulen. Wer es sich leisten kann, schickt seine Kinder in Privatschulen, vor allem ausländische Schulen.
-
„Efendi“ oder „afendi“, plural „afendiyât“ war der Titel für einen europäisch gekleideten Ägypter, für einen Mann aus dem Mittelstand und für Lehrer an staatlichen Schulen.
-
Wer wie der Schreibende seit langem in Oberägypten gelebt hat, ist mit ähnlichen Schildbügerstreichen vertraut.
-
العدالة الاجتماعيّة في الاسلا „al-’adâla al-igtimâ’iyya fi al-Islâm“, 1949
-
„Er begann sich Gedanken zu machen über diesen tiefen Graben, der die Reichen von den Armen trennt.“ („Jugendjahre in Kairo“, p.146.) Vor allem die Cholera-Epidemie von 1947 macht ihm bewusst, wie sehr sein Land „unfähig ist, das zu bekommen, was die freien Völker erlangen: das Gefühl eines Minimums an menschlicher Würde.“ („Au-delà du Nil“, Paris 1977, pp.246 f
-
Die folgenden Kapitel unserer Arbeit stützen sich auf John Calvert, „Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islam“, The American University in Cairo Press, 2011. Zitate, für die keine andere Quelle genannt werden, stammen aus diesem Buch.
14. Nagib Mahfûs, „Mirrors“, AUC, pp.119-122. Die deutsche Übersetzung „Spiegelbilder“, Unionsverlag Zürich, ist vergriffen.
15. „Weltbürger zwischen Kairo und Paris“, p.32
16. Über junge Ägypter, die in Syrien auf der Seite des „Daëch“ kämpfen vgl. Manar Attiya, „ces jeunes qui font la guerre sainte“, al-Ahrâm Hebdo, 24.-30.9.2014, p.24
17. „Tatsächlich ist Qutb überzeugt, dass die Wärter und Folterer in den Konzentrationslagern Gott vergessen haben. Sie beten ihn nicht mehr an, sondern setzen an seiner Stelle Nasser und den Staat zum Götzen ein.“ Gilles Kepel, „Le prophète et le pharaon“, Gallimard, folio histoire, 2012, pp.21ff
18. «al- hakîmiyya» ist ein Neologismus, gebildet vom Verbstamm ح ك م , der „herrschen, regieren, richten, urteilen, entscheiden, befehlen“ bedeutet.
19. Alle Zitate nach John Calvert, s.o., Anm. 12, pp.212-225
20. „Diese Jahiliyya basiert auf der Rebellion gegen Allahs Herrschaft auf der Erde; sie überträgt den Menschen eine der grössten Eigenschaften Allahs, nämlich die Souveränität, und macht Menschen zu Herren über andere.“ (Shahîd Sayyid Qutb, „Zeichen auf dem Weg“, aus dem Englischen von Muhammed Shukri, TEXT HIER.)
21. Die „Shiitische Republik Iran“ hat den „Märtyrer Sayyed Qutb“ 1984 mit der Herausgabe einer Briefmarke geehrt.
22. „Erhan A. würde für den islamischen Staat töten“ (Interview mit einem jungen Islamisten, der auf dem Absprung nach Syrien ist), Tages-Anzeiger, „Das Magazin“, nr.40, 2014.