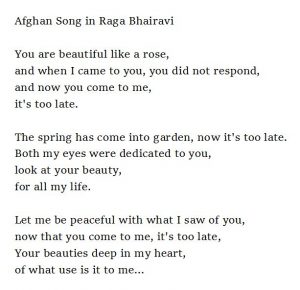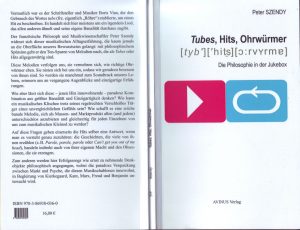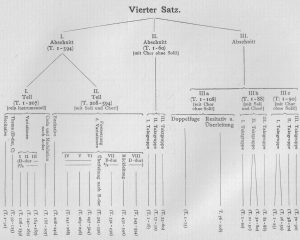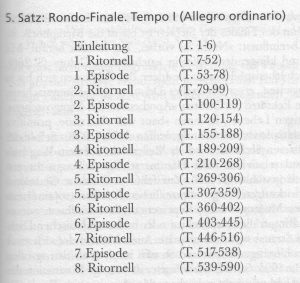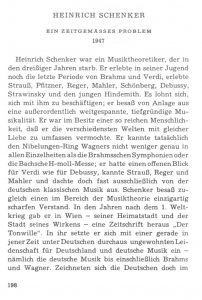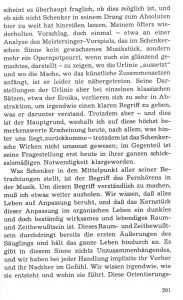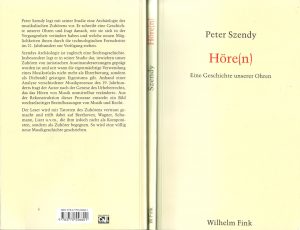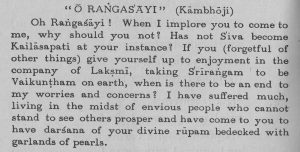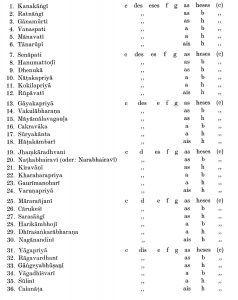Constance Scharff (SCH) im Interview mit Michael Rüsenberg (RUE)
SCH: … selbst bei den Arten, wo die Weibchen nicht singen, wie bei unsern Zebrafinken, da kann man mit ner kleinen Hormongabe, wenn die gerade geschlüpft sind und noch ganz winzig, dann kann man denen kleine Hormon-Pellets einbauen, und dann werden deren Gehirne plötzlich zu Männchengehirnen. Und dann hat man einen weiblichen Vogel, und die singt dann wie n Männchen. Weil alles, was man zum Singen braucht, da oben mit relativ wenig experimenteller Manipulation losgetreten werden kann, so dass dann die ganz hide ware (?), der ganze Schaltkreis dann da ist. Das spricht dafür, dass alles angelegt ist, nur manchmal nicht umgesetzt wird.
RÜ: Das heißt also: wenn Weibchen auch singen – kann man von dieser Funktion „den-andern-anlocken“ eigentlich noch ausgehen oder locken die ihrerseits auch?
SCH: Da sind relativ wenige Arten untersucht, wo Weibchen und Männchen singen. Da wo sie das tun, z.B. das Rotkehlchen bei uns, das ist der einzige Vogel, der das bei uns macht, da verteidigen sie gemeinsam ihr Revier. Wie stark die Männchen die Weibchen aussuchen danach, ob sie singen und wie gut sie singen, ist noch relativ unterbelichtet. Weil überhaupt in den Arten, wo die Weibchen mehr zu verlieren haben in Bezug auf Investition, – das ist ja in der Biologie immer so: wer wählt stärker aus? Der Partner, der mehr investiert. Das ist bei den Säugetieren das Weibchen, denn das trägt die Tiere aus, da kann sie nicht so schnell rennen, wird eher gefressen, dann muss sie die auch noch säugen, das ist alles super kostspielig, biologisch gesehen, also ist sie auch wählerischer. Bei den Tieren, wo das so ist, da wurde bis jetzt eigentlich vernachlässigt, dass die Männer trotzdem mitreden. Das Weibchen hat sozusagen das Erstwahlrecht, weil sie die teueren Eier produziert, und weil sie hinterher irgendwie sich drum kümmern muss; aber die Männchen reden schon mit. Und das ist n Forschungsfeld, das erst in den letzten Jahren gekommen ist. Also wie stark sind Männchen an Weibchensongs interessiert, da …. können Sie n Doktor drauf machen. (Lachen)
RUE: Also, jetzt tret ich nochmal n Schritt zurück, und das ist für mich, als Besonderheit mich mit dem Thema zu beschäftigen, ne Überraschung gewesen, – Sie haben schon die Unterscheidung gemacht: Singvögel und Vögel. Es gibt, korrigieren Sie mich: 9000 Vogelarten, wenn ich es recht sehe, aber nur 4000 davon sind Singvögel: was macht denn die Mehrh…
SCH: Nur??? Das ist ja erstmal knapp die Hälfte, das ist ja ne Menge, – warum lernen einige Vögel ihre Gesänge nicht? Ist das die Frage?
RUE: Das heißt… (Lachen) nein, das ist nicht meine Frage. Da sind ja viel zu viel Voraussetzungen drin. Meine Frage ist: Warum kommen 5000 ohne Gesang aus? Wie balzen die denn? Wir sagen doch immer: die Singvögel balzen. Was machen denn die andern? Singvögel sind in einer wenn auch kleinen Minderheit.
SCH: Wir wollen mal gemeinsam singen, wir singen mal was gemeinsam, dann hören wir uns die an, die vielleicht nicht so ganz gut affiniert sind im Ton, n bisschen schräg im Ton, und fragen, ob die auch n Partner gefunden haben (Lachen). Es gibt ja noch andere Qualitätsmerkmale als den Gesang. Es gibt unglaublich viele Sachen, wonach Tiere sich aussuchen. Die singen zwar, aber vielleicht ist die Qualität des Gesangs gar nicht so ausschlaggebend, sondern es ist eher das Gefieder, die Buntheit, wie gut die tanzen können, wie sie fliegen können, das sind alle möglichen Sachen, (der Pfau!) ja, der Pfau, der braucht nicht singen, der hat andere Qualitäten. Vielleicht … (3:32)
RUE: Gehört der überhaupt zu den Vögeln?
SCH: Zu den Vögeln, aber nicht zu den Singvögeln. Aber es gibt ja auch Vögel… die Singvögel müssen das lernen, die Papageienartigen und viele Arten, die Kolibris, das sind ja Vögel, die sind ja geboren, ohne dass sie genau schon wissen, was sie später singen werden. Die müssen das so lernen wie wir. Das ist ja auch der Grund, dass wir denen an den Kragen gehen, weil es wirklich wenige sind, deren Gehirn in der Lage ist, Geräusche zu hören, zu identifizieren: das ist meine Art, denn wir machen ja Menschensprache nach und nicht Hundequieken, das ist meine Art, so will ich reden, – das dann von Babbeln zu modifizieren, bis irgendwann mal „Mama, Papa, Milch, Auto, Hund, ich möchte“ kommt, das – und Singvögel machen das auch -, das ist der Grund, weshalb wir daran so interessiert sind. Nicht nur Jazz. Manche Vögel singen, ohne dass sie das müssen, die haben das angeboren, so wie Hunde, und Katzen, die das angeborenerweise wissen, wie man miaut.
RUE: Das heißt, es gibt also unter Vögeln, unter 9000 Arten eine unglaublich breite Variation. (Ja!) Und diejenigen, die nicht singen, haben die denn die Grundlagen dafür, und die singen nicht, weil sie es nicht brauchen, oder wie ist das zu verstehen?
SCH: Ja, – nochmal zurück: bei den Singvögeln singen Männchen und Weibchen häufig beide, aber oft auch das Weibchen dann nicht, da gehen wir inzwischen davon aus, oder ich gehe inzwischen davon aus, dass das eigentlich angelegt ist, rudimentär noch existiert, genetische … Architektenpläne, das Gehirn hat eigentlich die Kenntnis dafür, aber sie wird nicht benötigt, also wird sie auch nicht ausgeführt. Das sind die Singvögel. Bei den andern Vögeln, die ehh auch nicht ihre Laute lernen und teilweise auch keine Laute groß machen, da weiß man sehr wenig über deren Gehirne, da hat man auch noch nicht viel gekuckt. Viele Vögel können, auch wenn sie noch keine Gesänge machen, sich mit andern Lauten verständigen, sie machen Rufe zum Beispiel. Und da ist die Annahme, dass so wie bei Primaten – außer uns können ja sonst keine Affen so elaborat gelernt kommunizieren wie wir – dass es ältere Gehirnteile gibt, locker gesagt, die eben diese Laute, die mehr für „Feind“, „Futter“, solche Sachen existieren, dass die angelegt sind bei allen Wirbeltieren, würde ich mal sagen, und dafür da sind, dass das Überleben garantiert ist. (6:15) Darauf aufbauend ist dann so diese Sahnehaube.
RUE: Ich möchte diesen Teil so langsam abschließen mit einem Gedankensprung von unserm letzten Gast Kurt Gerhard, der war am 16. März hier. Kurt Gerhard, ein pensionierter WDR-Moderator, der sich engagiert in Afrika auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, aber ein großer Kritiker der organisierten Entwicklungshilfe ist, und der wird wie auch Frau Scharff heute immer gebeten, einen Gedankensprung, eine Frage an den nächsten Gast zu richten. Und Kurt Gerhard lässt Sie also folgendes fragen. Erstmal, als ich ihm das Thema nannte, kam er sofort auf die „Kraniche des Ibykus“ von Schiller: „Von euch, ihr Kraniche, dort oben, wenn keine andre Stimme spricht, sei meines Mordes Klag‘ erhoben, er ruft es, und sein Auge bricht.“
Der ist ja gestorben, der Ibykus, und der Kranich ist dabeigewesen, und die Frage, die er mit diesem Zitat verbindet, er hat es eingeleitet: Es gibt so viele schöne Vogelstimmen, und dieses fürchterliche Gekrächze der Kraniche und der Krähen – sind die zu kurz gekommen oder was?
SCH: Fürchterlich ja nur wieder nach Schillers Ohr. Also wir können halt nicht aus unserm Raster raus. Und wir finden das fürchterlich, aber die Kranichfrau findet das vielleicht super attraktiv, so wie inzwischen auch Musik perzipiert wird, die für die Nicht-Eingeweihten als erstes mal fürchterlich klingt. Und wenn man sich das erstmal lange genug anhört, dann hört man da Nuancen, und findet eben auch zum Beispiel Krach interessant. Wir sind ja flexibel in dem, was wir schön finden. Abhängig davon, wie wir groß geworden sind, sozialisiert worden und wie offen wir sind für Neues, ist „schön“ sehr sehr unterschiedlich ausgeprägt.
RUE (8:10): Das Interessante, – wir haben eben darüber diskutiert im Vorgespräch -, das Einzige, wo wir inhaltlich diskutiert haben, – normalerweise machen wir das nicht, müssen wir nicht die Inhalte vorbesprechen, – war nämlich der deutsche Name für den Butcherbird, der ja so wunderbar singt und klingt, Würgerkrähe, da haben Sie herausgefunden, dass der in der Taxonomie der Vögel nicht zu den Krähen gehört, sondern ein rein deutscher Name ist. Hätte man ja hier in Verbindung bringen können. Dann fällt mir noch was ein, Bernie Krause hat ja auch mal hier einen großen Vortrag gehalten, der im Museum König – heißt das so? – genau, der hat ja so n Buch geschrieben, wo die These drinsteht, dass also sozusagen die Welt eine Sinfonie ist, und die Behauptung, die er macht, – Frage an Sie jetzt, ob das zutreffend ist -, die Tiere sozusagen in diesem ganzen Schwall an Klängen, diesem Orchester, wie er es nennt, sich sozusagen mit ihren Klängen ihren Platz suchen. Da gibt’s Leute, die sagen „Quatsch, jeder singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist“, und sozusagen der Gesamtklang, der sich formt, ist ein Zufallsprodukt. Sie würden sagen, die Leute suchen sich…, die Vögel suchen sich akustisch eine ökologische Nische…
SCH (9:18): Also es gibt dazu zwei Antworten, und die sind komplementär: die strikte naturwissenschaftlich, sozusagen verhaltensökologische Antwort, und die ist gut untermauert, ist, dass Vögel, dass Tiere im Urwald sich wirklich ne Nische suchen, zwar evolutionär gesehen, die sind also nicht in der Lage zu sagen, heute singe ich mal hier und morgen singe ich mal in der Tonlage, aber die Frösche z.B.: gewisse Frösche sind adaptiert, die neben nem Wasserfall leben, nicht da zu quaken, wo der Wasserfall-Dezibel-Grenzbereich ist, das wäre ja auch nicht sehr sinnvoll, denn der Frosch quakt, wo die Froschfrau ihn findet, und wenn er jetzt von dem Wasserfall maskiert wird, dann findet die Frau ihn nicht. Also singt.. hat er langsam über die vielen Generationen der Evolution ein Quaken entwickelt, das da hörbar ist. So, das ist die unbestrittene naturwissenschaftliche Antwort auf : es gibt Gründe, warum Tiere so singen oder so Laute machen, wie sie das tun. Zum Beispiel die Meise in der Wüste singt anders als die Meise im Laubwald, weil die Töne in der Wüste sich anders fortsetzen können als im Laubwald. So, jetzt ist die andere Frage, gibt es auch möglicherweise noch andere Prinzipien, die ne Rolle spielen, wie unterschiedliche Arten oder selbst in der gleichen Art Tiere miteinander Musik machen. Und das ist im Großen und Ganzen noch nicht gut untersucht, zum Beispiel wird immer gesagt: es gibt die Nachtigallen, da singt die eine, da singt die andere, das ist klar, dass die miteinander kommunizieren, in der Art und Weise, wie sie auch ihre Melodien auswählen, kann man zeigen. Zebrafinken scheinen vorwiegend so vor sich hinzusingen, entweder n Weibchen an oder man weiß nicht warum, aber keine hat gekuckt, ob es z.B. Prinzipien gibt, wie eine Gruppe von zehn Finken miteinander singt. Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man zehn 2 Sekunden singende Roboter produzieren würde, die alle mehr oder weniger willkürlich was produzieren, dann würden die irgendwann auch so aussehen, als ob sie was zusammen tun. So ähnlich wie wenn wir alle anfangen zu klatschen: zu Anfang ist das ne Kakophonie und nach ner Weile schwingt sich das so ein, ohne dass wir das unbedingt merken. Ob solche Sachen auch in Tierverbänden z.B. im Urwald passieren, hat noch keiner gekuckt. Teilweise weil es die Methoden auch gar nicht dafür gab, heute könnte man da 7 Stunden am Tag oder 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche (11:41) alles aufnehmen, „big data“ heißt das heutzutage, mit sehr viel Computerauswertungskraft kucken. Aber sie wissen es nicht.
RUE: Es bleibt ne Künstlerthese einstweilen…
SCH: Ja, aber eine, die durchaus interessant wäre, sich mal anzukucken.
RUE: Ja, wir wollen den zweiten Teil nochmal einleiten mit einem sehr sehr schönen Vogelsound, der kommt aus Brasilien, der Vogel, und der heißt Oropendula.
KLANGBEISPIEL OROPENDULA 12:07 bis 13:05
RUE: Kannten Sie den Klang?
SCH: Ja! (Und?) Also: warum interessieren den Menschen manche Vögel mehr als andere? Dann, wenn Sie was damit anfangen können, es klingt, als ob er ne Tonleiter macht, das fasziniert dann Leute, die sagen: das ist doch Musik! Und es hat vor noch nicht langer Zeit ne Analyse gegeben: wie gut ist denn die Tonleiter? Und die Veröffentlichung sagt: die ist nicht so toll. (Lachen) Aber das ist ja die andere Sache, dass … also… wenn ich etwas ziemlich falsch singe, aber es ist ne bekannte Melodie, dann hören Ihre Gehirne trotzdem, was sie hören wollen. Und das ist bei uns mit Vögeln im Prinzip auch möglich. Es klingt tonleiterartig, und auch wenn das keine perfekte Tonleiter ist, dann ist es immer noch ne Tonleiter für uns. Und das ist natürlich… auch so jemand, der n Saiteninstrument spielt, es muss ja nicht unbedingt ne Tonleiter sein, man wird immer noch sagen, ja, ist okay, irgendwann ist es dann: au nein! Aber es gibt ja immer noch ne Variabilität, was wir zulassen als Musik und was wir nicht zulassen. Und.. es klingt super. Und die andere Sache, die man auch dran aufhängen kann, und wir auch n bisschen selber forschen, erstaunlich, wie wenig Leute sich über die Rhythmik bei Vögeln jetzt Gedanken gemacht haben. Also…dieses jjjjjjjjjup … das sagt Hollis immer: die haben auch ein rhythmisches Gefühl, die so synkopisch Zebrafinken auch, synkopisch, dass da ne Menge (14:37) in der zeitlichen Abfolge passiert. Und es hat trotzdem bis jetzt – also wir waren die ersten, die überhaupt gekuckt haben. Gibt es möglicherweise einen stetigen… nicht Takt im Sinne von „wir hören den Takt“, sondern eine isochrone Einteilung der Zeit, bei Zebnrafinken. Und dann haben wir uns gesagt „warum soll das so sein“ warum synchron, warum gleichmäßig, es gibt ja soviel verschiedene Rhythmen, Bingo! Die Vögel, wenn man sich nur mal so die Notenanfänge ankuckt, dann sind die sehr sehr regelmäßig, auf ner sehr kleinen Ebene, die machen mal ne Note, die ist 5 Takte lang, und mal ne Note, die ist 2 Takte lang, ne Pause, die ist 4 Takte lang, hätte man nie erwartet, muss man sich ankucken. Da ist glaube ich noch ganz ganz viel Platz für interessante Parallelen mit menschlicher Musik und Rhythmen in Tier-Äußerungen, und wenn man drüber nachdenkt, wofür ist das überhaupt da. Wir leben alle – obwohl Zeit ein Konstrukt angeblich ist – wir müssen uns mit der Zeit abfinden, und unsere ganzen Bewegungen und alles was wir tun hat zeitliche Komponenten, und unser Hirn schwingt in verschiedenen Zeitabfolgen, was wir so tun, ist wahrscheinlich ne Reflexion davon, dass es n relativ regelmäßigen Rhythmus wie unsern Herzschlag und all diese Dinge gibt. Warum sollten Tierlaute nicht auch in solchen zeitlichen regelmäßigen Wellen organisiert sein?
(16:03) RUE: Wir haben uns viel jetzt mit ästhetischen Fragen beschäftigt, teilweise biologische auch schon gestreift, ich möchte gern nochmal, oder überhaupt erstmal auf die Grundfragen gehen: Warum betrachten wir das überhaupt, warum beschäftigen wir uns damit, was haben wir gemeinsam? Andersrum gefragt: Vögel haben ja die … nicht nur die Möglichkeit sondern die Grundäußerung, die wir als musikalisch betrachten, sondern sie haben damit auch die gleiche Anlage wie wir, sagen wir, der Vokaltrakt, der ist bei Vögeln, wenn ich das richtig verstehe, ganz ähnlich wie beim Menschen, und dann kommen wir später auch dazu, was Sie da interessiert, was da auch für Rückwirkungen auf möglicherweise Krankheiten beim Menschen gibt, dass man die sozusagen am Vogel studiert, beim Menschen korrigieren kann. Ist es richtig, dass wir mit den Vögeln diesen Apparat, diesen Vokalapparat der Lautäußerung teilen?
SCH: Also, unhöflich gesagt: Nein (lacht), also, nicht ganz so, – was braucht man, damit man Laute machen kann, so wie Hören, das muss ins Gehirn rein, man muss produzieren, Laute machen können, das muss aus m Gehirn raus, zum Stimmapparat, der Stimmapparat muss irgendwas haben, was – in unserm… in beiden Fällen – da haben Sie recht – ist schwingende Membran, wo die Luft beim Durchfließen durch das Schwingen andere Tonhöhen geben, beim Vogel gibt es zwei Schallquellen, der hat im Gegensatz zu unserem Larynx hat der … zweimal vibrieren die Membranen, und wir haben nur eine, deswegen können Vögel, also Singvögel auch zweistimmig singen, die können mit dem… das heißt Syrinx beim Vogel, nach dem Pan und Syrinx aus der griechischen Mythologie, die können mit dem einen Syrinx, einer Syrinxhälfte, einen Ton machen und deswegen auch ganz schnell abwechseln, also der Syrinx und der Larynx, die sind relativ anders, die Vögel haben auch einen Larynx, die machen aber da keine Musik mit. Jetzt in Bezug auf die Gehirne wurde früher immer angenommen, die sind ja so anders, weil das sind ja keine Säugetiere, und da kann man also überhaupt nichts vergleichen. Dann ja Erich Jarvis, den Sie vorhin schon erwähnten, und Kollegen herausgefunden, dass die Reizleitbahnen im Gehirn, als da, wo tatsächlich auch die Töne dekodiert werden, also analysiert werden, alles was ich so höre, und wo sie komponiert werden, kodiert, wie die Neurowissenschaftler sagen, dass da erstaunliche Ähnlichkeiten sind. Das heißt so die Logik und wie aus dem Gehirn Töne produziert werden, vom Ingenieursprinzip her, da sind wir sehr ähnlich. (18:39) Und da haben auch die Singvögel wirklich ihre Nische, denn die beliebten weißen Mäuse, die sonst so Neurowissenschaftler forschen, die machen zwar auch Laute, die können auch singen, aber die werden nicht gelernt. Aber deswegen haben die auch nicht diese Schaltkreise im Gehirn, mit denen wir lernen und mit denen Vögel lernen, und wenn man rauskriegen will, wie sowas Lernen auf ner Einzelzellebene funktioniert – also wie macht denn so ne Nervenzelle das eigentlich, oder ne Hundertschaft von Nervenzellen, dann kann man aus den Vogelgehirnen – und idt über die letzten 30, 40 Jahre auch wirklich maßgebliche und bahnbrechende Befunde rausgekommen: wie macht n Gehirn das, dass es was hört und dass es das dann nachmachen kann? (19:10)
RUE: Das haben Sie schon angesprochen, das sind also Vocal Learners, etwas ganz Entscheidendes, dass der Vogelgesang, also die Lautbildung sg ich mal lieber, bei Vögeln und beim Menschen gelernt wird, und wenn man, wenn ichs richtig sehe, Vögeln eine Lernquelle abklemmt, gewissermaßen, dann lernen sie das auch nicht, dann bleibt diese Fähigkeit … liegt die brach.
SCH: So ist es, ja! Also das…, ich weiß nicht, ob Sie in diese Richtung gehen, das ist also auch da, wo erstaunlicherweise Singvögelforschung und menschliche Sprechen-Kapazität, also das ist es, woran wir forschen, sehr parallel sind, weil ein Gen ist, das, wenn es mutiert ist beim Menschen, dazu führt, dass die nicht richtig reden können, wenn wir das bei Vögeln experimentell manipulieren, dann können die auch nicht richtig singen lernen, und zwar in erstaunlich ähnlicher Art und Weise. (20:12)
Also diese Menschen, die die Mutation haben, inzwischen relativ viele von inzwischen auch eine große Familie, andere Individuen, die sprechen sehr sehr undeutlich, das kann man sich auf den Videos ankucken, man kann die verstehen, wenn man sie kennt, aber wenn man sie nicht kennt, versteht man sie erstmal nicht, sprechen erstmal sehr undeutlich, sehr einfache Sätze, das was sie sagen, ist viel variabler als bei uns. Wir reden ja auch variabel, ich sag (unterschiedlich im Ton:) heute, heute, heute, heute! Und es ist für Sie immer noch „heute“, aber es gibt halt auch Leute, die dann so variabel reden, dass man das nicht mehr versteht. (ganz dumpf:) heute. (ganz hoch:) heute. Und diese Patienten haben genau das Problem, dass sie variabler sprechen, einfacher und sehr undeutlich. Und wir haben dieses Gen bei Vögeln manipuliert, die Vögel singen weniger Noten, die, die sie singen, singen sie schlechter imitiert, und wenn sie die gleiche Note zehnmal singen, singen sie sie variabler, als es normal ist bei Zebrafinken. Das hätten wir nie erwartet, dass wir so eine Ähnlichkeit finden, und das erlaubt es uns dann, seit dem letzten… das haben wir 2001 gefunden, in den letzten 15 Jahren tatsächlich sehr sehr mechanistisch reinzugehen und rauszukriegen: was ist denn das nun mit dieser Mutation bei den Menschen, was ist denn da kaputt? Warum funktioniert die Zelle nicht so? Und im Endeffekt ist das nicht der Anlass gewesen, warum ich Vogelforscherin geworden bin, aber man findet dann Sachen, die es einem ermöglichen zu sagen, ja vielleicht können wir tatsächlich beim Menschen was bewirken. Zum Beispiel: wusste man, als diese Familie zu Anfang besprochen, also gefunden wurde, nicht: ist das primär ein Entwicklungsdefekt, dass das Gehrin sich nicht richtig entwickelt, im Uterus schon und als Kleinkind, oder ist das n Problem, dass wenn die Sprache gelernt wird, nicht die richtigen Lernprozesse stattfinden können? Und unsere Forschung hat dann gezeigt, dass es wahrscheinlich beides ist, auf jeden Fall auch das Lernen selbst durch diese Mutation beeinträchtigt ist. Wenn man erstmal weiß, was die macht, könnte man sagen, man kann wenigstens beim Lernprozess selber möglicherweise nachliefern, und das Dopamin, das Sie vorhin erwähnt haben, von Erik Travis, das uns glücklich macht, ist auch n Botenstoff, der beim Lernen extrem wichtig ist, weil er sagt „richtig gemacht, richtig gemacht“ zu den Zellen, zwei Zellen machen was richtig, und n kleiner Dopaminstoß kann denen möglicherweise sagen, dass die das auch weiter richtig machen sollen, und dieses Gen, das heißt FOXP2, spielt ne Rolle im Dopamin….schaltkreis. Global gesagt. Also da wo Dopamin ne Rolle spielt, spielt dieses Gen auch ne Rolle.
RUE: Das würde ja bedeuten, dass man über dem Umweg der Vögel (22:50) was über den Menschen gelernt hat.
SCH: Auf jeden Fall gelernt hat, im menschlichen Gehirn vorhersagen, wo man noch kucken sollte und was man postulieren sollte, was da möglicherweise kaputt sein soll.
RUE: Noch ne andere Gemeinsamkeit zwischen klassischen Vögel und Menschen: das Tanzen. Das können andere Tiere wie z.B. Affen nicht, die können auch gar keinen Beat erkennen,
SCH: das ist jetzt kein Tanzen…
RUE: dass Affen, die können keinen Beat erkennen, weil sie den Beat nicht vorwegnehmen können. Jetzt tue ich so, als wenn ich son Schlauer wär, (Lachen) nein, aber Beat-Erkennen heißt ja Beat vorwegnehmen, und Affen nehmen jeden Schlag in einem 4/4-Takt als ein Einzelereignis wahr, das unabhängig ist von dem davor und dem danach, und wenn ich mich recht erinnere, haben im 19. Jahrhundert, ich glaub, zwei Deutsche, festgestellt, dass Beat erfassen antezipieren. Aber ich wollte auf diesen andern Bereich, weil der auch ne Anwendung auf n andern Bereich hat, vielleicht auf Krankheiten beim Menschen, Vocal Learners, haben: d.h. irgendwo muss das ja mit der Motorik zusammenhängen.
SCH: Also, gehen wir nochmal zurück: weil, das ist superwichtig zu sagen: wo kommen denn solche Befunde her: Affen können keinen Beat erkennen, ja? Was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass im Gegensatz zu andern Tieren Affen, wenn man ihnen menschliche Musik vorspielt, oder Töne präsentiert, nicht automatisch mitschwingen. Wohingegen gewisse Tiere das machen, also der berühmte Kakadu – ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Snowball, dem spielt man irgendwelche Popmusik vor, und ob er das spontan macht oder ob man es ihm beigebracht hat, aber er kann sich drauf einlassen, dass er mitschwingt, und zwar richtig. Man kann die Musik schneller machen, und dann springt er schneller mit. Sowas (RUE er macht ja sogar …) genau, und wenn er rauskommt, dann macht er ganz toll, dann macht er so kurz mal ehhhh, wumm, also wieder genauso wie in der Tanzschule, also wenn man rauskommt … irgendwie und dann geht’s wieder los, und das macht Snowball auch, d.h. Der kann spontan mitschwingen. Dann gibt es andere Tiere, denen man das beibringen kann, am Anfang mit n bisschen Belohnung, sagen: du sollst bitte mit dem Beat mitmachen, und wenn sie das kapiert haben, was sie machen sollen, zum Beispiel Seelöwen, – Affen, mit denen ist bisher erst ein Versuch gemacht worden, wo man versucht hat ihnen beizubringen, immer wenn ein Ton kommt, dann machst du bitte n Tipp, Tipp, tipp, und wenn der Ton aufhört, dann machst du im richtigen Takt tipp tipp weiter. Davon ist jetzt die Take-home-Message, also was wir über alle Affen denken: die können keinen Beat erkennen, ne? Also: bis jetzt wissen wir nur, dass sie das nicht spontan machen, und dass sie nicht besonders gut sind in diesem einen Experiment. Nehmen wir mal an, das ist wahr, Affen können das nicht, gewisse Vögel können das: hat das jetzt was mit diesem Vocal Learning zu tun? Das ist ne These, die aufgestellt worden ist, die ist von Anipatel, weil halt der Kakadu, der auch n Vocal Learner ist, das konnte, hat der gedacht, ach, dann hat das bestimmt damit zu tun, dass der auch Laute nachmachen kann, also ein Vocal Learner ist. Jetzt gibt es zunehmend Forschung, wo man versucht zu hinterfragen, und z.B. Zebrafinken, die können super Laute nachmachen, die lernen ihren Gesang vom Vater, die können auf jeden Fall, wenn man ihnen beibringt, tipp mal, das können die auch nicht besonders gut weiter mitmachen, aber sie tippen, wenn der Ton aufhört, noch zweimal weiter, mehr oder weniger im richtigen Takt. Die Frage ist natürlich, was wir damit… was wollen wir da rauskriegen? (26:20) Wollen wir da rauskriegen, ob Gehirne im Prinzip in der Lage sind, Zeit vorauszusagen, wenn es ne Tonzeit ist, dann ist es ne sehr interessante Forschung. Wollen wir herauskriegen, warum manche Tiere so elaborat tanzen, es gibt tolle Tänze bei Vögeln, die Flamingos, die sich gegenseitig … solche Tänze machen und synchron funktionieren. Es gibt den Lyra Bird in Australien, der macht auch Supertänze, es gibt Finken in Japan, die machen so schnell mit ihren Füßen auf der Stange, dass man das mit menschlichem Auge gar nicht sehen kann, man muss das mit der Kamera aufnehmen, mit ner schnellen Kamera, dann runterspulen und plötzlich sieht man, dass die den hier machen (….), und dass die Weibchen auch wieder zukucken, – es ist nicht so überraschend, dass so etwas existiert, weil häufig wird in zwei Kanälen kommuniziert, also Sprechen, Kucken, Sprechen – Bewegung ansehen, Sprechen und Riechen, also die Biologie hat das so angelegt, dass häufig ne wichtige Nachricht in mehr als einem Kanal rübergebracht wird. Und deswegen sehen Vögel bunt aus und singen, traditionell wurde immer gesagt, Geruch ist bei denen nicht so wichtig, das ist gar nicht wahr, die können auch ziemlich gut riechen, vielleicht kriegen wir da auch noch demnächst raus, dass da Pheromone ne Rolle spielen, wir wissen jetzt schon, dass Vögel ihre Jungen teilweise am Nest erkennen können durch Riechen, die Sinne Hören, Sehen, Riechen, Spüren, die werden häufig parallel benutzt, und Tanzen ist eine der Versionen, die man an denen man wieder zeigen kann, was man so kann…
RUE: Was Sie da sagen, zeigt ja die Vorläufigkeit der Erkenntnisse…
SCH: Auf jeden Fall…
RUE: man sozusagen als Laie … produziere, weil sie ja für mich sehr einleuchtend sind, argumentativ ganz gut untermauert sind, aber dem berühmten Patel ist ja durch den Seelöwen nun auch schon widersprochen worden. (Genau!) und konnte trotzdem den Takt halten. Das ist ja das Spannende daran, dass es in der Naturwissenschaft Fortschritt richtig gibt, nicht nur Wandel, sondern auch Fortschritt, nämlich dass Erkenntnisse von gestern ad acta gelegt werden.
SCH: Ja, das zeigt natürlich auch: wir sind alle Menschen, auf die Art und Weise, wie wir uns profilieren, indem wir was Neues erfinden und ne neue These, – also wir haben nen Befund, und dann machen wir da gleich ne Theorie draus, und die Geisteswissenschaftler machen das auch, die haben auch permanent neue Ideen, wie man alte Sachen neu verkaufen kann, und dann steht man plötzlich für eine Idee, eine These, und bei jedem Paper, – die Leute, die besonders daran interessiert sind, dass die mit ihrem Namen da stehen, kommen dann gleich immer ne neue … ach, habe ich nen tollen Namen, noch ne neue Theorie. Und das ist erstmal toll, weil man dann ahhhh! „nur Vocal Learner können tanzen!“ so, und dann kommen die nächsten Paper, „ist ja Blödsinn“, dann sind wir aber trotzdem draußen mit dieser tollen These, das dauert dann noch zehn Jahre, bis sie sich durch die Presse und durch die populärwissenschaftliche Sache durchgepflügt hat, dass das gar nicht mehr stimmt, das ist nicht ihr Fehler, aber das ist natürlich… so ist Wissenschaftspolitik, halt.
RUE: Ziehe ich daraus den richtigen oder falschen Schluss, dass hier nicht heute abend schon ein Buch von Ihnen zu dem Thema gibt…?
SCH: Das ist schon richtig, ich finde… ich liebe Bücher, besonders gute. Und ich bin auch begeistert davon, wenn gute Wissenschaftler ihre Wissenschaft gut erklären können. Ich weiß, dass das auch n großer Markt ist, es wäre wahrscheinlich beinah ein Lebenswerk, das so zu machen, dass [….] ENDE [30:04] Niederschrift nach der Tonaufzeichnung. Jan Reichow.
Weiterlesen HIER