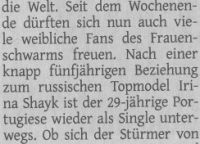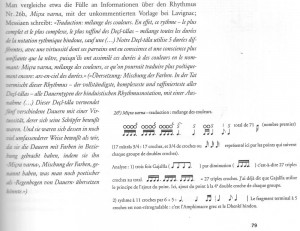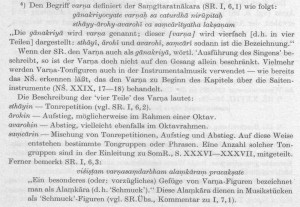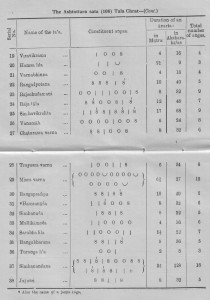Laufplan der WDR 3 Radiosendung am 3. Januar 2015 18:05 – 19:00 Uhr
[siehe am Ende dieses Artikels auch Fotos und einen Nachruf von Gerhard Peters]
Abt Klassische Musik
Red Dr. Richard Lorber
Titel Vesper I
Kantabel und virtuos – Zum Gedenken an den Violinisten Franzjosef Maier
Autor: Christoph Prasser
Jingle Vesper 0’11
Moderation 1:
Guten Abend und herzlich willkommen zur Vesper auf WDR 3.
Am 16. Oktober vergangenen Jahres ist im Alter von 89 Jahren der Violinvirtuose Franzjosef Maier verstorben, der seit Beginn der 1950er Jahre einen erheblichen Anteil hatte an der Entwicklung der Kölner „Alte Musik-Szene“. Der erste Teil der Vespersendung erinnert an den einflussreichen Geiger, der nicht nur durch sein meisterhaftes Spiel zu Berühmtheit gelangt war, sondern sein Wissen auch als erster Dozent für Barockvioline an der Kölner Musikhochschule weitergeben konnte, wo Geiger wie Reinhard Goebel, Werner Ehrhardt, Manfredo Kraemer und viele andere zu seinen Schülern zählten. Diese wiederum gaben sein Wissen in berühmt gewordenen Ensembles wie „Musica Antiqua Köln“ oder „Concerto Köln“ weiter und förderten und festigten damit den Ruf der Stadt Köln als Zentrum für „Alte Musik“ und „Historische Aufführungspraxis“. Dem WDR war Maier dabei in unzähligen Produktionen und Konzerten zeit seines Lebens verbunden. Und im „Collegium musicum des WDR“ war Franzjosef Maier über Jahrzehnte als Konzertmeister tätig. Zur Erinnerung an den großen Musiker bringt die Vesper heute ausgewählte Aufnahmen, die vor allem in Produktionen Alter Musik mit dem Kölner WDR entstanden sind. Autor der Sendung ist Christoph Prasser.
Unsere erste Musik zeigt Maier als Solist und Konzertmeister an der Spitze eines Ensembles, mit dem er am meisten bekannt werden sollte, dem „Collegium aureum“. Dieses in der Regel dirigentenlose Orchester für historische Aufführungspraxis sollte er über Jahrzehnte vom Konzertmeisterpult aus leiten. Die folgende Aufnahme des Mozart-Rondos in C-dur für Violine und Orchester stammt aus dem Jahre 1977 und wurde wie so viele Aufnahmen des Ensembles im Cedernsaal des Schlosses in Kirchheim aufgenommen. (Mod.: 1’58)
Musik 1:
K.: Wolfgang Amadeus Mozart 6029210105 7’02
Allegretto grazioso aus: Rondo C-dur KV 373
Franzjosef Maier, Violine / Collegium aureum / Ltg.: Franzjosef Maier
Moderation 2:
Das Collegium aureum mit Mozarts Allegretto-grazioso, dem Rondo in C-dur KV 373. Solist und musikalischer Leiter der Aufnahme war der Geiger Franzjosef Maier.
Maier wurde am 27. April 1925 in Memmingen im Allgäu geboren und lernte schon früh Klavier, Violine und Bratsche. Ab 1938 besuchte er das Augsburger Konservatorium, anschließend die Münchner Akademie und das musische Gymnasium in Frankfurt. Nach Kriegsende und Gefangenschaft studierte er schließlich bis 1948 an der Kölner Musikhochschule.
Als junger Geiger geriet Maier sehr schnell ins Fahrwasser des WDR, der damals noch NWDR hieß. Dort produzierte er mit dem Musikwissenschaftler Eduard Gröninger erste Werke für den Rundfunk, die sich bereits an einem historischen Klangbild orientierten, denn der NWDR war ein innovativer Pionier in Sachen Alter Musik. Schließlich wurde Maier Gründungsmitglied des „Collegium musicum des NWDR“, eines Orchesters, das sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert hatte und neben dem sich später das Schwesterensemble „Cappella Coloniensis“ etablieren sollte. Die Cappella wurde letztlich zum prominenten Aushängeschild für Alte Musik, allerdings ohne Franzjosef Maier. Das lag aber nur daran, dass Maier in jener Zeit im Schäfferquartett als 2. Geiger spielte und er die Quartettarbeit der Orchesterarbeit zunächst vorzog. Denn ursprünglich sollte Kurt Schäffer, der Namensgeber des Quartetts und Maiers ehemaliger Lehrer an der Kölner Musikhochschule, Konzertmeister in der neu gegründeten Cappella werden. Er verzichtete aber, nachdem Maier ihn bat, die Arbeit am Schäfferquartett fortzuführen. Vielleicht spielte dieser Verzicht auch mit eine Rolle für das spätere Zerwürfnis zwischen Maier und Schäffer, aber erst nach der Trennung vom Schäfferquartett war für Maier der Weg frei für seine spätere Karriere als Leiter des Collegium Aureum.
Unsere nächste Musik zählt zu den Höhepunkten der Violinliteratur in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und zeigt einen Franzjosef Maier in Hochform. Heinrich Ignaz Bibers virtuose Sonate Nr. 1 in A-dur gehört zu den 8 Salzburger Sonaten aus dem Jahre 1681. Die Violinstimme wird von einer Basso-continuo-Gruppe unterstützt, die aus Orgel, Violone und Violoncello besteht. (Mod.: 2’22)
Musik 2:
K.: Heinrich Ignaz Biber 6029229102 13’29
Sonate Nr 1 A-dur (für Violine und Basso continuo)
Franzjosef Maier, Violine / Rudolf Mandalka, Cello / Johannes Koch, Violone / Wilhelm Krumbach, Orgel
Moderation 3:
Die Vesper auf WDR 3 mit der Sonate Nr 1 in A-dur für Violine und Basso continuo von Heinrich Ignaz Biber. Gespielt hat sie der im Oktober vergangenen Jahres verstorbene Geiger Franzjosef Maier, dem der erste Teil der heutigen Sendung gewidmet ist.
Die Anfangszeit der historischen Aufführungspraxis, die ihren stärksten Triebmotor in den 1950/60er Jahren durch Produktionen des WDR erhielt, war geprägt durch die Suche nach dem historisch authentischen Klang. Maier fühlte sich aber nicht nur der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, sondern er blieb auch den Komponisten der neueren Musikgeschichte treu. Und so spielte er die Kompositionen der alten Meister bis in die Mitte der 1960er Jahre nicht etwa auf einer zurückgebauten oder historischen Violine alter Mensur, sondern meist auf seiner moderneren Vuillaume-Geige, die er dafür lediglich mit Darmsaiten bespannte. Auch der Kammerton blieb bei ihm meist bei 440 Hertz. Allerdings benutzte er für Produktionen Alter Musik zwingend einen alten historischen Bogen.
In der nun folgenden Aufnahme spielt er allerdings ein 1752 erbautes historisches Instrument in alter Stimmung, eine Geige von Michele Deconetti. Die hatte er 1965 als Dauerleihgabe von der Schwägerin des Harmonia-Mundi-Geschäftsführers Rudolf Ruby bekommen. Nicht ohne Hintergedanken, denn schließlich war die Harmonia-Mundi die Plattenfirma, die Maiers Collegium aureum unter Vertrag hatte.
Hören sie jetzt den Tenor James Griffett mit Joseph Haydns Bearbeitung des schottischen Volkslieds „Margret’s ghost“. Franzjosef Maier spielt Violine, Rudolf Mandalka Violoncello und Bradford Tracey sitzt am Hammerklavier. (Mod.: 1’45)
Musik 3:
K.: Joseph Haydn 6044235119 7’57
Margret’s ghost, Hob XXIa:65
(Bearbeitung eines schottischen Volksliedes für Singstimme, Violine, Violoncello und Tasteninstrument)
James Griffett, Tenor
Franzjosef Maier, Violine
Rudolf Mandalka, Violoncello
Bradford Tracey, Hammerklavier
Moderation 4:
“Margret’s ghost”, die Bearbeitung eines schottischen Volksliedes von Joseph Haydn, mit dem Tenor James Griffett und dem Geiger Franzjosef Maier. Eine historische Aufnahme aus dem Jahre 1980.
Bereits ein Jahr zuvor hat Maier die nun folgende Aufnahme für den WDR produziert. Als Orchester stand hier das Collegium musicum des WDR zur Verfügung, das durch die Strahlkraft der berühmten Cappella Coloniensis des WDR zwar an Bedeutung verloren hatte, nicht aber an musikalischer Qualität. Dafür sorgte schon die Besetzung des Orchesters, in der mittlerweile bereits Geiger wie Gerhard Peters und andere saßen, die ihre Meisterkurse für Barockvioline bei Franzjosef Maier an der Kölner Musikhochschule erfolgreich hinter sich gebracht hatten. Gemeinsam spielen sie nun als „Collegium musicum des WDR“ die Sonata a cinque, op 2 Nr. 6 in g-moll von Tomaso Albinoni. (Mod.: 0’57)
Musik 4:
K.: Tomaso Albinoni 6109386103 8’29
Sonata a cinque, op 2, 6 g-moll
(für 2 Violinen, 2 Violen und Basso continuo)
-
Adagio
-
Allegro
-
Grave
-
Allegro
Collegium musicum des WDR
Moderation 5:
Die viersätzige Sonata a cinque, op 2 Nr. 6 in g-moll von Tomaso Albinoni, gespielt vom Collegium musicum des WDR. Die Leitung hatte der Geiger Franzjosef Maier, der im Oktober vergangenen Jahres im Alter von 89 verstorben ist und dem der erste Teil der heutigen Vespersendung gewidmet ist. Mit Maier ging einer der Pioniere und Schlüsselfiguren des letzten Jahrhunderts, die sich um die Rekonstruktion und Wiederbelebung Alter Musik im neuen Klanggewand verdient gemacht haben. Als Professor für Violine an der Kölner Musikhochschule konnte er seine Kenntnisse und Erfahrungen an zahlreiche Schüler weiterreichen, die heute diese Ideen selbst in weltweit erfolgreichen Orchestern vorstellen und weiter entwickelt haben.
Zum Schluss des ersten Teils der Vesper steigen wir jetzt ein in das Concerto grosso in A-dur op. 6 Nr. 11 von Georg Friedrich Händel, gespielt von der „Cappella Accademia des Seminars für Alte Musik“, aufgenommen in der Aula der Kölner Musikhochschule im Juni 1981. Unter der Leitung von Franzjosef Maier spielen Geiger wie Helmut Hausberg und Werner Ehrhardt so, wie es Maier gegen Ende seiner großen Karriere gefallen hat: Vereint, im Kreise seiner Schüler. (Mod.: 1’22)
Achtung Technik: : folgende Musik 5 (Händel) bitte nur von Minute 7’11 – Ende spielen und auf Zeit fahren! Ab Min. 17’50 folgt nur noch Schlussapplaus der in der darauffolgenden Abmoderation ausgeblendet werden kann!
Diese letzte Musik dient als Zeitpuffer, Daher entsprechend unter der Moderation 5 stumm starten und gegen Ende der Moderation 5 langsam einblenden!
Musik 5:
K.: Georg Friedrich Händel 6046367102 ca. 11’00
Andante; Allegro von 7’11 – ca. 18’05
aus: Concerto grosso A-dur, op 6,11 auf Zeit fahren!
Helmut Hausberg, Violine
Werner Ehrhardt, Violine
Bruno Klepper, Violoncello
Cappella Accademia des Seminars für Alte Musik
Ltg.: Franzjosef Maier
(von ca 7’12 – 18’05)
Abmoderation:
Zum Abschluss des ersten Teils der Vesper spielte die „Cappella Accademia des Seminars für Alte Musik“ den Schluss des Concerto grosso in A-dur op 6 Nr. 11 von Georg Friedrich Händel. Die Leitung hatte der Geiger Franzjosef Maier, dem die Sendung gewidmet war. Der Autor der Sendung war Christoph Prasser.
(Mod.: 0’22)
————————————————————————————————————————–
47’57
Musikzeit: 47’57
Jingle: 0’11
Moderation: 8’46
———————–
total: 56’54
Das Collegium Aureum 1971 im Fuggerschloss Kirchheim/Schwaben




Prof. Franzjosef Maier, Violinist und Konzertmeister. Collegium aureum, erstes Bild, Gesichter von links nach rechts: Günter Vollmer, Franzjosef Maier, Ruth Nielen, Werner Neuhaus, Gerhard Peters, Wolfgang Neininger, Jan Reichow, Ulrich Beetz, Violinen; Heinz-Otto Graf, Viola; Horst Beckedorf, Rudolf Mandalka, Celli. Zweites Bild: (Günter Vollmer) Rudolf Mandalka, Violoncello; (Wolfgang Neininger) Helmut Hucke, Oboe.
Fotos: harmonia mundi Deutschland, Daniela-Maria Brandt
Weiteres zu Franzjosef Maier s.a. hier.
Nachruf seines Schülers und Nachfolgers in Köln, Prof. Gerhard Peters
(Quelle: Hochschulzeitung Das Journal 2015/16)