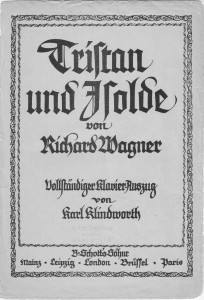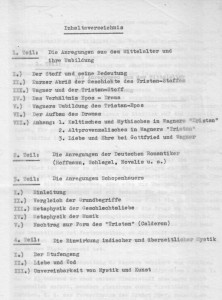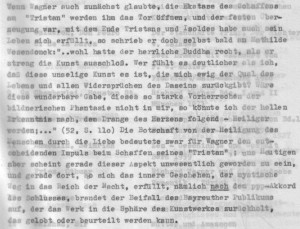Ein Essay von Martin Geck
Geschrieben für die Kolumne in der Zeitschrift Concerto. Magazin für Alte Musik. Vorabdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors.
Weil diese Kolumne vor allem von Musikern und Musikliebhabern gelesen wird, darf ich es wohl wagen, anhand eines konkreten Beispiels gegen Auswüchse des sogenannten Regietheaters vom Leder zu ziehen. Als ich solches vor einigen Jahren angesichts von Frank Castorfs Bayreuther „Ring“ in der FAZ getan habe, hat mich Manuel Brug, Kritiker der WELT, alsbald einer PEGIDA-Mentalität bezichtigt.
Nun wäre es in der Tat unvernünftig, sich gegen das Regietheater wenden zu wollen, also gegen jedwede unkonventionelle Inszenierung: Es gibt stets Triftiges und Untriftiges, Erhellendes und Verdunkelndes, Pfiffiges und Läppisches. Und gottlob leben wir in einer Gesellschaft, in der über das jeweilige Für oder Wider gestritten werden kann.
Und weil ich hier in einem Magazin für alte Musik schreibe, darf ich hinzufügen, dass mir gerade die Oper der Barockzeit als ein geeignetes Spielfeld für inszenatorische Experimente erscheint: Moral und Message vieler barocker Libretti sind so verstaubt, dass man ihren Plot aus den Angeln heben darf, jedenfalls nicht todernst nehmen muss. Außerdem zeigt die u. a. von Händel ausufernd gepflegte Parodiepraxis, dass die Musik kaum verliert, wenn sie als gleichsam „absolute“ präsentiert wird.
Ich erinnere mich an die Fernsehaufzeichnung einer Händel-Oper, in der eine Sängerin zu edelstem Gesang suchend in einer Ansammlung von Lumpen oder Abfall wühlt. Ich fand diesen Regieeinfall, dessen Kontext ich vergessen habe, keineswegs befremdlich oder gar abwegig, sondern geradezu erhellend für meine Seele: hier die Perlen begnadeter Musik, dort unser aller Gedankenmüll.
Zwar verdienen Händels Opernlibretti Respekt, wo sie trotz ihres generell affirmativen Wesens eine humanitäre Botschaft erkennen lassen. Der Vergleich mit späteren Generationen führt uns jedoch einen gewaltigen qualitativen Sprung vor Augen – etwa hin zu Mozarts Oper „Hochzeit des Figaro“, von der hier anhand eines Details die Rede sein soll.
Mozarts Librettist Da Ponte hat auf der Grundlage des Schauspiels von Beaumarchais ein Textbuch geschaffen, das an Prägnanz und Aussagekraft seinesgleichen sucht. Auch die „Message“ ist sonnenklar: Am Vorabend der französischen Revolution begehrt der Diener gegen seinen adeligen Herrn auf. Und er gewinnt – nicht zuletzt mit Hilfe gewitzter Frauen.
Ich kenne kaum ein anderes Opernlibretto des 18. /19. Jahrhunderts, das unsere Gegenwart ähnlich triftig abzubilden vermöchte. Doch das bedeutet eben nicht, dass man den Grafen Almaviva mit einer Trump-Maske ausstatten und die Handlung ins Weiße Haus verlegen sollte! Es heißt vielmehr, das Zeitlose im Zeitbedingten wahrzunehmen und bereits der Musik Mozarts inszenatorische Fähigkeiten zuzutrauen. Das Paradigmatische eines Kunstwerks zeigt sich gerade in Formen, die keiner platten Aktualisierungen bedürfen. Mit dieser Auffassung weiß ich mich mit namhaften Opernregisseuren einig; und ich denke dabei nicht nur an die früh verstorbene Ruth Berghaus, die sich in ihren Regiearbeiten vorab stets an der Partitur orientierte. Auch Hans Neuenfels und Andrea Breth, die im jüngsten Heft der Zeitschrift „Lettre International“ zu Wort kommen, treten für eine Regie ein, die sich auf die Musik einlässt. Das schließt Konfrontationen mit dem Unerwarteten, etwa mit märchenhaften oder gestischen Einfällen, keineswegs aus. Wenn Neuenfels in seinem Bayreuther „Lohengrin“ die Chorsänger als Ratten in Laborsituation auftreten lässt, so hat das einen guten Sinn: Sofern die Voraussetzungen stimmen, ist die geballte Masse des Brabanter Volks gern bereit, auf einen Wink einiger Wortführer hin Elsa zu quälen. Wir brauchen uns als Zuschauer nur in Elsa hineinzuversetzen, um das zu verstehen: „Wer quält mich da?“, fragt sie sich – um festzustellen, dass es anonyme, manipulierbare Wesen sind, derer sie kaum habhaft werden kann.
Andrea Breth erzählt, sie habe anlässlich der Stuttgarter Inszenierung von Luigi Dallapiccolas Oper „Der Gefangene“ vom April dieses Jahres „wahnsinnige Angst“ vor der Szene gehabt, in der die bereits vom Tod gezeichnete Titelfigur in wahnhafter Weise denkt: „Das ist jetzt das Leben und die Hoffnung“. Sie habe dann während der Proben intuitiv, ohne nachzudenken, um einige Seile gebeten und mit diesen Seilen die Akteure miteinander verknotet. Auch hier geht der Transfer nicht über den Intellekt, sondern über die Geste, welche eine Situation öffnet aber auch offenlässt – offen für unsere eigene Fantasie.
Und nun der Darmstädter „Figaro“ vom Herbst letzten Jahres – eine Übernahme der Kölner Inszenierung von Emmanuelle Bastet. „Die Regie weiß eigentlich gar nicht, welche Geschichte sie erzählen soll“, heißt es in einer Aufführungskritik. In der Tat will sie vor allem mit beliebigen Gags punkten. Der in meinen Augen am meisten deplatzierte: Zur Arie „Non più andrai farfallone amoroso“ („Aus und vorbei, verliebter Schmetterling“), in der Figaro den ungeliebten Cherubino boshaft auf die Strapazen des ihm drohenden Soldatenlebens vorbereitet, sind auf der Bühne flimmernde Videobilder mit Szenen aus dem 1. Weltkrieg zu sehen! Diese Dummheit raubt einem den Atem bis zur Übelkeit. Mozart will, dass unser inneres Auge den armen Cherubino bei seiner Musik „über Berge, durch tiefe Täler, bei Schnee und bei Hitze“ stolpern sieht, während ihm die Kugeln um die Ohren pfeifen. Und er komponiert solches nicht etwa passgenau tonmalerisch, schafft vielmehr einen Freiraum, in dem unsere Fantasie Handlung und Musik vor eigenem Erfahrungshorizont verschmelzen kann. Zugleich verdeutlicht er, dass die imaginierte Szene nur Figaros genüssliche Wunschvorstellung ist, wir uns also nicht wirklich um den verwöhnten Pagen sorgen müssen.
Weniger Prekäres passiert im neuen Mainzer „Figaro“ in der Regie von Elisabeth Stöppler. Doch als ob man nicht ohnehin wüsste, dass es in der Oper um Sex und Eros geht, zeigt eine der Protagonistinnen – innerhalb einer an sich ansehnlichen Kostümshow – ihr Lack-Korsett-Mieder her. ‚Nun ja, kann man alles machen’, sagt der postmodern und liberal gesonnene Betrachter. Ist es nur altmodisch, von einer „Figaro“-Inszenierung etwas anderes zu fordern, nämlich zugleich Biss und Charme? Zumindest sollte das der Musik eigene utopische Moment nicht auf der Szene verhöhnt werden. Mozart mit dem Holzhammer – kann das gutgehen?
Wann endlich geschieht der große Aufstand gegen die inszenatorische Dummheit? Er müsste von den Musikern ausgehen, die sich ja vergleichbare Dummheiten nicht erlauben können, sie aber am Pult oder im Orchestergraben ständig hinnehmen müssen.
* * *
Vorabdruck des Textes (©martin geck), der in der Zeitschrift Concerto – Magazin für Alte Musik erscheinen wird. Mit herzlichem Dank an den Autor, Prof. Dr. Martin Geck.