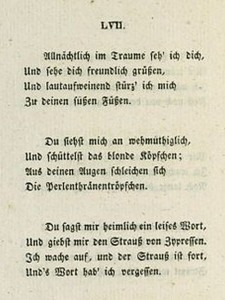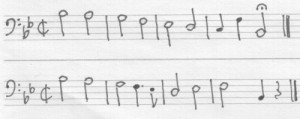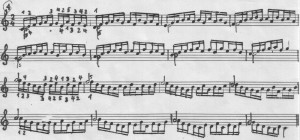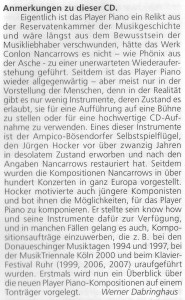Der Schwer-zu-Deutende, den alle verstehen
Walther Vetter: Franz Schubert / Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion Potsdam 1934
Natürlich war ich gestern erschöpft (nach der Probe dieses Quartetts) und weit entfernt, ihn klarer als früher vor Augen zu sehen. Aber eins ist sicher, der massiv grüne Bücken-Band aus der Nazi-Zeit verfehlt ihn mehr als alle Werke, die in jüngerer Zeit entstanden sind. Was man schwer erträgt, sind die wohlfeilen Vergleiche mit Beethoven und der Ausblick auf Bruckner. Schubert ist Schubert.
Im Fall des Streichquintetts C-dur liest man zum langsamen Satz, der vielleicht alles in den Schatten stellt, was je geschrieben wurde:
Im Adagio mag man die Differenziertheit der Rhythmik und die unkontrapunktische, aber sehr obligate Stimmführung als Beethovensche Art empfinden: im Kern hat diese Musik mit Beethoven keine Berührung.
Was sie stattdessen berührt, wird mit ein paar Platitüden bedacht. („So wird die Form von innen her aufgebrochen“.) Und zum Trio des Scherzos, das unvermittelt die Tür zu ungeheuerlichen Räumen aufstößt, für die man keine Worte findet, fällt dem Autor ein:
Im Scherzotrio häufen sich die Des-Dur-Ganzschlüsse, aber der Komponist zögert, die angeschlagenen Gedanken zu Ende zu denken. Nirgend ist in Schuberts Lebenswerk der Weg zu Bruckner entschiedener betreten als hier.
Dort wo Schubert am größten ist, windet sich der Musikwissenschaftler, verweist ohne sich zu schämen auf andere Komponisten, die offenbar imstande waren, „angeschlagene Gedanken zu Ende zu denken“, und verrät in schrecklichen Allgemeinplätzen, was ihm dieses „Musikertum“ bedeutet. So im oben wiedergegebenen Abschnitt zum G-dur-Streichquartett:
In allen seinen wesentlichen Teilen ist dieses Quartett jedoch Dokument eines von jeder gedanklichen und sinnlich-stofflichen Zielsetzung losgelösten Musikertums, für welches alle Melodik im herkömmlichen Sinn lediglich die materialisierte Erscheinungsform gewisser tiefer geschichteter musikalischer Vorgänge ist.
So hat man ihn vom Hals. Unter Berufung auf Ernst Kurth darf man noch verweisen auf „die völlige Zersetzung der tonalen Klangverhältnisse, die einem … labileren und farbenreicheren Prinzip weichen“. Und zum Abschluss hebt man noch die Wirkungen hervor (Tremoli), „deren sich von jeher die Romantik bemächtigte und die deren Grenzregion zwischen Träumen und Wachen, ihrem eigentlichsten Kunstgebiet“ entsprechen.
Kurz: Ein Komponist, der seine Gedanken nicht zu Ende denkt, der die Zersetzung tonaler Klangverhältnisse in Kauf nimmt, um einem labileren Prinzip zu folgen und letztlich in einer Grenzregion zwischen Träumen und Wachen zu verweilen.
Diese Art von Schubert-Exegese gibt es heute nicht mehr. Das Buch stammt aus dem Jahre 1934 und ist natürlich nicht geschrieben worden, um den Komponisten herabzusetzen. Aber gerade die Tatsache, dass ein solcher Eindruck quasi aus Versehen entsteht, sagt etwas über das Klima jener Zeit: der Weg zu Schubert war verschüttet (er war in einer „Grenzregion“ zu Hause).
***
Um eine Vorstellung zu geben, was wirklich in dieser Musik geschieht (wenn man es schon in Worten und eher technisch anzudeuten versucht), sei hier Werner Aderhold zitiert, der allerdings auf jede Poetisierung verzichtet und natürlich auch bei dem Dur-Moll-Wechsel der ersten Akkorde ansetzt:
Der Prozeß, aus widerstreitenden Ansätzen zu Gestalten zu kommen, hat teil an der Konstitution des Satzbaus und verbindet als übergreifendes Moment alle vier Sätze. Dafür sinnfällig ist der, vor allem den Ecksätzen eigene, Wechsel von Dur- und Moll-Terz. Schubert stützt sich im ersten und letzten Satz auf die Sonatenanlage, handhabt diese jedoch nicht im Sinne eines Wettstreits gegensätzlicher Charaktere, sondern als Nebeneinander sich ergänzender Aktionsräume. Darin reiht sich Block auf Block einander ablösender Varianten. Variierte Reihung kennzeichnet auch den zweiten Satz, dessen ausgedehnt singende Cello-Melodien wohl Beruhigung, gar Frieden auszustrahlen vermöchten, wäre ihnen nicht der Affekt der Ruhelosigkeit in den Oberstimmenfiguren beigegeben. Mit den zweimaligen Ausbrüchen der Mittelteile – Affektentladungen in einer Chromatik, die jeder „geregelten“ Modulation spottet – gerät alles aus den Fugen. Ähnliche Stürme hat Schubert nur noch im zweiten Satz der späten A-Dur-Klaviersonate (D 959) entfacht. Beide Erfindungen sind nicht einfach des Kontrastes wegen erdacht, sie sollen vielmehr die äußersten Zeichen der Bedrohung dort setzen, wo die Kunst, über dem Vorschein eines im Gesang vorgestellten Glücks, menschliche Not zu verraten in der Lage ist.
Quelle Reclams Kammermusikführer FRANZ SCHUBERT von Walther Dürr und Arnold Feil / Philipp Reclam jun. Stuttgart 1991 (Seite 253) – grüne Hervorhebung JR
Die Gefahr, die ich heute bei Schubert sehe, ist die des uneingeschränkten Wohlgefühls, ungeachtet aller Zeichen äußerster Bedrohung. (Ob nicht diese Wortfolge im obigen Text gemeint ist?)
Eine andere Gefahr ist die, – um ihn ja nicht zu bagatellisieren – überall und in jedem freundlichen Lied eine latente Katastrophe zu wittern. Die Fremdheit dieser Welt und das Fremdsein in dieser Welt ist allerdings eine Sache, mit der nicht nur Schubert zu tun hatte, sondern jeder von uns, heute mehr denn je, – was uns nicht hindert, hier und da Glück zu empfinden. Auch bei Schubert und genau wie Schubert, „über dem Vorschein eines im Gesang vorgestellten Glücks .“
Ich habe vor Jahren einmal versucht, dieses Gefühl der Fremdheit zu erkunden und mit grundlegenden Fremd-Erfahrungen zu verbinden. Ich glaube, ein wenig zum Befremden meiner Zuhörerschaft, die klein war, aber zweifellos aus Schubert-Freunden bestand, die keinesfalls gekommen waren, um indische Musik zu hören. Egal, wie fremd sie ist und welche Erfahrungen sie erlaubt…
Der Vortrag ist HIER zu finden.
Hinter der Überschrift des heutigen Blogs („Singularität“) steht die hier nicht weiter hervorgehobene Behandlung des Themas bei Thr. Georgiades.
***
Nachtrag Peter Gülke über die letzten Quartette:
In dem Brief vom 31. März 1824, den er vermutlich nach Beendigung des d-Moll-Quartetts geschrieben hat, dem das in a-Moll knapp vorausging, spricht Schubert von drei Quartetten. Nun begegnet in dem mit der Datierung „20.-30. Juni 1826“ überlieferte G-Dur-Quartett D 887 vielerlei beim d-Moll-Quartett Beobachtetes wieder – der schroffe Beginn, der Passus duriusculus (T. 15ff.), das in Terzgängen kreisende zweite Thema (der am konsequentesten in sich kreisende Charakter, den er je komponiert hat), noch deutlicher als im d-Moll-Quartett als Thema des Trios, der „delirierende“ Sechsachtel-Wirbel eines riesig dimensionierten Finalsatzes, dessen Hauptthema fast wie eine Umkehrung des entsprechenden d-Moll-Themas beginnt, und gleicherweise ein dem fortreißenden Wirbel blockhaft entgegengesetztes Seitenthema; am Beginn des zweiten Satzes skandiert Schubert ebenfalls die Frage nach der „schönen Welt“*, und in dessen dramatischen Passagen verschärft er fast ins Unerträgliche die Verzweiflungsschreien ähnelnden Terzaufschläge der Marcia funebre sulla morte d’un Eroe aus Beethovens Klaviersonate op. 26. Hat er den Tod und das Mädchen, hindurchgegangen durch die Erfahrungen des d-moll-Quartetts, ein zweites Mal komponiert – extremer und ohne direkten motivischen Bezug? War dieses Quartett, nur in der endgültigen Ausarbeitung auf später vertagt, das dritte?
Quelle Peter Gülke: Franz Schubert und seine Zeit / Laaber Verlag 1991 (Seite 211 f) / *bezieht sich auf auf das Zitat des Liedes „Schöne Welt, wo bist du?“ („Die Götter Griechenlands“) im Menuett des „Rosamunde“-Quartetts.
PS.
Natürlich nehme ich, wenn ich Gülke lese, meine Anfangsworte über die wohlfeilen Vergleiche mit Beethoven und Bruckner gern zurück. Höchst interessant, wenn er im Zusammenhang mit Der Tod und das Mädchen darauf hinweist, dass sich „von den Seufzerfiguren der ersten Variation der Kontext flehender Gebärde kaum wegdenken“ lässt, und dazu die Anmerkung gibt:
Auch, wenn Beethoven der Seufzer-Topos nicht neu nahgebracht werden mußte, erscheint nicht ausgeschlossen, daß er von hierher angeregt wurde für die im Folgejahr komponierte Cavatina im Streichquartett op. 130; Schuppanzigh könnte der Mittler gewesen sein.
A.a.O. Seite 208 und Anm. 107 auf Seite 215 / Dort auch die Anmerkung (bezogen auf die Ausführungen auf Seite 210) zur Situation des Dialogs von Tod und Mädchen (Schluss des ersten Satzes):
Von diesem Satzschluß könnte Bruckner bei der Revision seiner Achten Sinfonie zur Totenuhr angeregt worden sein.
Musikbeispiel
siehe (und höre) Brandis Quartet / https://www.youtube.com/watch?v=vnAoj_4rji4 (Achtung: am Anfang erscheint im Schriftbild fälschlicherweise „Rosamunde-Quartett“). der eben erwähnte Schluss des ersten Satzes ab 15:21 bis 16:05 (Satzende).
Das Staunen über die unglaubliche Meisterschaft eines so jung verstorbenen Komponisten regte Hans-Klaus Jungheinrich in seinem lesenswerten Buch „Der Musikroman“ (Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1998) zu interessanten Gedankengängen an (Seite 114f):
Das Pensum, das Schubert in seinem kurzen Leben absolvierte, ist so groß, daß es kaum vorstellbar ist, wie dieser Mann mit gleicher Intensität noch dreißig, vierzig Jahre hätte weiterkomponieren können. Womöglich gibt es, mit einer großen Schwankungsbreite zwischen den einzelnen kreativen Potenzen, nur ein begrenzte Menge von künstlerisch hochrangigem Output einer Person, ein endliches Quantum von Triebenergie, und wenn das schon in jungen Jahren mobilisiert wurde (Rossini, Sibelius), bleibt fürs Alter nichts übrig. Oder umgekehrt: produktive Alterswildheit zeigt sich nur da, wo früher haushalterische Zurückhaltung herrschte (Janáček, Brian). Doch ist es auch müßig, über eventuelle Gesetzlichkeitenzu spekulieren, wo sich alles immer wieder als unvorgersehbar, rätselhaft und geheimnisvoll erweist. Schuberts jugendliches Oeuvre ist so unüberbietbar wundervoll, daß das, was einige Jahrzehnte zusätzlicher Meisterschaft noch hätten hinzufügen können, eher den ganzen musikgeschichtlichen Kontext verändert hätte als das Bild dieses Musikers, dessen letzte Klaviersonaten oder Große C-Dur-Symphonie Ausdruck einer Reife sind, die man nicht durch beliebige biographische Schritte hinter sich hätte lassen können. Hugo Wolfs hektische Kompositionsweise deutet auch darauf hin, daß extreme Kunstleistung mit „Ernstfall“ und „Gefahr“ enger liiert ist und Tod und Wahnsinn näher steht als der Gemütlichkeit und Wohlversichertheit eines Heinzelmännchenfleißes. So dürfen wir annehmen, daß Schubert, ohne begründetes existentielles Bangen, seine Große C-Dur-Symphonie mit sechzig statt mit dreißig geschrieben hätte – in jedem Fall eine Summe und ein Abschied. 1860 hätte sie dann aber wie Brahms, Bruckner und Liszt geklungen – vielmehr wie „Schubert“, der um diese Zeit vielleicht wie ein altersweise-eisgrauer Mahler geklungen hätte.
Wie gesagt: ein sehr lesenswertes, kenntnisreiches und anregendes Buch.