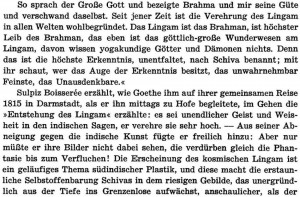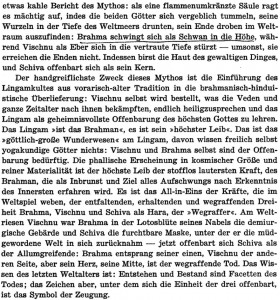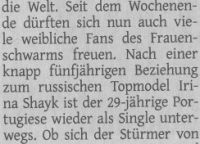„Ein fabelhafter Geiger, ein mittelmäßiger Komponist“ , schrieb Carlo Goldoni (* 1707) um 1780 über seinen Landsmann Antonio Vivaldi, mit „Kompositionen allenfalls für Kinder“ legte der Selbst-Biograph Dittersdorf um 1790 nach, Joseph v. Wasielewski 1927 dann mit „Haydn machte in seinen Jahreszeiten sehr schöne Musik, was man von Vivaldis gleichnamigen Werk nicht behaupten kann“ – und mit Stravinskis Dictum, Vivaldi habe einfach nur 600 Mal das gleiche Konzert geschrieben, beenden wir auch diese Revue der wenig hilfreichen Kritiken. Für den heutigen Hörer ist Vivaldi der klingende Inbegriff des Venezianischen, dem italienischen Musikwissenschaftler ist er inzwischen das, was Bach, Beethoven und Brahms dem deutschen Kollegen seit hundert Jahren sind und der Schallplatten-Industrie ein nie sterbender Goldesel :„Vier Jahreszeiten“ gibt es mehr als viermal neu pro Jahr…
Johann Georg Pisendel, bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem Prete Rosso im Jahre 1716 ein bereits gestandener Virtuose und später dann Konzertmeister des Dresdener Hof-Orchesters ( dem nach Aussage der noch heute vorhandenen Notenbestände wichtigsten Zentrum der Vivaldi-Pflege außerhalb Venedigs ) schrieb 1756 über die „Veränderung des Geschmacks seit den fünf und zwanzig letztvergangenen Jahren …zum Schaden des wahrhaftig guten Geschmacks“: „Zweene berühmte lombardische Violinisten haben hierzu insonderheit viel beygetragen. Der erste war lebhaft, reich an Erfindung, und erfüllete fast die halbe Welt mit seinen Concerten…..Zuletzt aber verfiel er, durch allzuvieles und tägliches Componieren… in eine Leichtsinnigkeit und Frechheit, sowohl im Setzen als auch im Spielen, weshalb seine letztern Concerte nicht mehr so viel Beyfall verdieneten als die erstern.“
Als Pisendel diese Sätze seinem Ghostwriter J. Fr. Agricola in die Feder diktierte, war Vivaldi längst tot, völlig unbeachtet von der Kunstwelt am 28. Juli 1741 in Wien gestorben und sein früher Ruhm Makulatur.
1711, also genau drei Jahrzehnte früher, hatte das Amsterdamer Druckhaus Etienne Roger Vivaldis erste Konzert-Sammlung, zugleich dessen erste nordeuropäische Publikation auf den Markt gebracht. Vivaldi hatte sich von den völlig rückständigen Verlagen seiner Heimatstadt verabschiedet, deren Typendruck-Editionen noch genau so ausschauten, wie um 1600: total unleserlich – und dem virtuosen Gestus seiner Musik äußerst hinderlich. Es waren übrigens die „pro Seite“ bezahlten, handarbeitenden Kopisten, die die die Modernisierung der Druckereien boykottierten und erfolgreich verhinderten !
Durch Mund-Propaganda aber hatte Vivaldi schon vor der Präsentation des Opus 3 in fürstlichen Kreisen von Kennern und Liebhabern nördlich der Alpen einen beträchtlichen Ruf: die Grafen Schönborn in Pommersfelden hatten ebenso wie der sächsische Hof in Dresden lange bereits Kontakt mit dem Komponisten und auch Aufsehen erregende Werke als Handschriften erhalten: Cello-Konzerte, zwei-orchestrige Concerti mit vier Solo-Flöten und vier Solo-Violinen, sowie grandiose Triosonaten belegen diesen frühen Austausch.
Der großen Öffentlichkeit aber wurde der Komponist erst mit dem fabelhaften Druck des Opus 3, seiner ersten Konzert-Sammlung bekannt – und man war hingerissen und fiel ins Vivaldi-Fieber: ganz zu recht! Denn eigentlich krebste man in Deutschland immer noch in einem verlängerten 17. Jahrhundert herum und suchte verzweifelt nach formal und organisatorisch logischen Lösungen für Beginn und Ende eines Instrumental-Werks, um die Probleme von Zeit und Raum und musikalischer Kohärenz in der Instrumental-Musik zu meistern – in der Vokalmusik hingegen war das Problem nicht so offensichtlich, denn hier vertonte man „am Text entlang“ : neue Worte, neue musikalische Motive…
Und so heißt es bei Forkel über den immerhin schon 25jährigen Bach: „ Er fing bald an zu fühlen, daß es mit dem ewigen Laufen und Springen nicht ausgerichtet sey, daß Ordnung, Zusammenhang und Verhältniß in die Gedanken gebracht werden müsse und daß man zur Erreichung solcher Zwecke irgend eine Art von Anleitung bedürfe. Als eine solche Anleitung dienten ihm die damals neu herausgekommenenen Violinconcerte von Vivaldi. —- Er studierte die Führung der Gedanken , das Verhältnis der selben unter einander, die Abwechselungen der Modulation und mancherley andere Dinge mehr. Die Umänderung der für die Violine eingerichteten, dem Clavier aber nicht angemessenen Gedanken und Passagen lehrte ihn auch musikalisch denken…“
Vivaldis Opus 3 muss für junge deutsche Komponisten, die diesen beinahe ausweglosen Stillstand wie Notstand am eigenen Leibe erfuhren, als die Lösung des gordischen Knoten erschienen sein: ein rhythmisch packendes Motiv – Anapäst und Dactylus, Trochäus und Spondäus – in Tonika, Dominante, Subdominante darstellen und beleuchten und dann Rückkehr zur Tonika; Motiv-Beschränkung und nicht alle drei Takte etwas Neues – und vor allem gliedernde motivische Zusammenhänge!! Dennoch war das Opus 3 nun nicht en total das Non-plus-ultra an radikalster Modernität , denn Albinoni und Torelli hatten bereits Konzert-Sammlungen publiziert, – in denen moderne Konzerte aber eher wie Zufalls-Trouvaillen neben unbedeutendem Krimskrams standen. Zudem musste Vivaldi sich erst einmal auch seine Erfahrungen „von der Seele“ schreiben, die allfälligen Hommages an den venezianischen Übervater Legrenzi und natürlich auch an den römischen Apoll Arcangelo Corelli austeilen, erhöhte doch die historische Legitimation durch die Vorväter den Wert ungemein: die Geschichte kennen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten! Nur dem gebildeten Kenner öffnen sich diese Fenster, durch die man ein wenig zurück ins 17. Jahrhundert blicken kann, – und auch nur dieser Connaisseur erahnt die ungeheure Brisanz und Modernität des Opus 3 mit all seinen versteckten Konnotationen und Alliterationen….
Johann Sebastian Bach, 1711 geigender Konzertmeister und Hof-Organist in Weimar, erkannte genau, wo Vergangenheits-Bewältigung und wo Moderne vorherrschend waren: die von ihm für Orgel und Cembalo bearbeiteten Werke sind die visionärsten Kompositionen des Zyklus und Altmodisches ließ er eher unbeachtet. Selbst in den 1730er Jahren griff er noch – nunmehr stolz seine Söhne und Schüler im „collegium musicum“ zu Leipzig als Virtuosen präsentierend – auf das wohl schönste Werk der Sammlung zurück, das rauschhaft-extatische h-moll-Konzert Nr.10, und bearbeitete es für vier Cembali. Um das Fugato-Concerto Nr.11 rankte sich ein zum gleichen Zeitpunkt initiierter Krimi: Wilhelm Friedemann Bach beanspruchte der Komponist zu sein, aber man war sich da nicht so sicher – und schrieb es dem Johann Sebastian Bach, dem Vater zu….
. . . und erst zu Beginn des 20.Jahrhunderts entdeckte man den wirklichen Komponisten, denn Vivaldi war schon zu Lebzeiten im kollektiven Gedächtnis völlig tot: die Wellen der sich heute wie damals mit gleicher Schnelligkeit ablösenden „Modernen“ waren über ihn hinweg gerollt und lediglich der Franzose Jean Marie Leclair erinnerte sich hörbar in seinen wunderbaren Konzerten der Werke des Venezianers, die er allerdings um unnachahmliche französische Eleganz bereichert.
„L´Estro Armonico“ – Geistreiche Harmonie – ist für ein Ensemble von vier Violinen, zwei Violen, Cello, Cembalo (und Kontrabass-Instrument) konzipiert, also für eine vor-orchestrale Gruppe von Solisten, denn das heute geläufige „Orchester“ mit mehrfacher, chorischer Besetzung der Streicher war – Paris und Rom ausgenommen – immer noch die Ausnahme. Der besondere Reiz von Vivaldis Opus 3 lag für die Zeitgenossen also auch in dieser aparten Verbindung von Alt & Neu: bisweilen verbünden sich die vier Violinen zu machtvoll-orchestralem Unisono – einer Neuigkeit schlechthin, dann aber gehen sie auch wieder getrennte Wege und fiedeln eigenständig vor sich hin.
Die zwölf Konzerte des Opus 3 in vier Serien zu gliedern (viermal folgt einem Konzert für vier Violinen ein solches für zwei Violinen und dann eins für Solo-Violine) mag uns heute eher billig erscheinen – aber 1711 war genau dies schon mal ein wichtiger Schritt, es war eine faszinierende „captatio benevolentiae“: denn das Werk-Dutzend war als Präsentations-Form keineswegs etabliert, und in Sammlungen von sieben und auch acht Werken oder solchen, in denen die Kompositionen nach Besetzungs-Stärke geordnet waren, deutete meistens nichts auf zyklische Ordnung hin.
Die Tonarten-Folge D-g-G / e-A-a / F-a-D / h-d-E läßt auf den ersten Blick keine bemerkenswerten Symmetrie-Achsen erkennen, – allerdings sind Dur- und Moll- Konzerte in gleicher Anzahl vorhanden. Weitere Verfeinerung auf dem Weg, Serien von Kompositionen durch unhörbare, aus anderen Künsten abgeleitete Kriterien zu Zyklen zu verschmelzen, gelang lediglich J.S.Bach: in seiner durch Luthers Lehren geprägten Musik-Philosophie wurden Concerti zu einem „Fürsten-Spiegel“ zusammengefasst – so in den „Brandenburgischen Konzerten“ aus dem Jahr 1721 – und heterogene Kompositionen wie Canons, Ricercare und Sonata zu einer „Rede an den Fürsten“ verschmolzen, wie im 1747 komponierten „Musicalischen Opfer“. Telemann kehrte mit der gigantischen „Musique de Table“ 1733 noch einmal äußerlich zur seriell-zyklischen Stilisierung zurück: die drei „Productions“ sind formal und besetzungs-rechnerisch absolut gleich, alle Einzel-Kompositionen sind jedoch in einem komplizierten Werte-System des „vermischten Geschmacks“ miteinander verknüpft.
Vivaldis Opus 3 hatte für Deutschland einen ungeheuren Reinigungs-Effekt: man wusste plötzlich „wo’s lang geht“- äußerlich zumindest ! Innerlich verband, ja überhöhte man das Gelernte sofort mit dem Besten, was aus der nun ad-acta zu legenden Musik des final beendeten und bewältigten 17. Jahrhunderts zu retten war und legte damit einen der Grundsteine für die überragende Rolle deutschsprachiger Komponisten im 18. und 19. Jahrhundert.
Das 1716 folgende Opus 4 – La Stravaganza – wurde kaum noch mit vergleichbar großer Begeisterung rezipiert: die bescheidenen Protestanten Nordeuropas schmunzelten sicher über den aufgeblasenen Titel der Sammlung, rieben sich ansonsten aber verwundert und erstaunt die Augen darüber, dass jener Antonio Vivaldi, der gestern noch einen so dankbar angenommenen Ausweg aus der schöpferischen Krise gezeigt hatte, nun selbst jegliche eindeutige Klarheit vermissen ließ und ein Druckwerk von – so der erste Eindruck – äußerst rätselhafter Flatterhaftigkeit auf den Mark warf. Der wie immer dem Amsterdamer Erstdruck direkt folgende englische Raubdruck verkürzte die Sammlung dann auch gleich um die Hälfte auf nur sechs Konzerte !
Um diese erstaunliche Kurs-Korrektur zu verstehen, muss man sich Vivaldis Biographie, vielleicht doch auch seiner Person an sich, ganz gewiss aber den Umständen in Venedig – dem Las Vegas des 18.Jhdts – zuwenden.
Die durch die Entdeckung Amerikas vom früheren mittelmeerischen Handels-Zentrum der Welt nun an die denkbar ungünstigste Peripherie gedrängte Lagunen-Stadt entdeckte im späten 17.Jahrhundert bereits den monetären Wert des karnevalesken Tourismus : vier, ja sechs von Patriziern betriebene Opernhäusern boten zwischen Oktober und März „Unterhaltung“, Tausende von Prostituierten ihre Dienste an : die inzwischen in Ausstellungen und dazugehörigen kiloschweren Katalogen gefeierte „Grand Tour“ nordischer Reisender war im Grunde genommen ein Hin-und Her zwischen der feinsinnigen Betrachtung antik-marmorner und der handfesten Benutzung jener von der terra ferma herangekarrten lebenden Frauenkörper. Man sollte indes nicht glauben, dass derartige Laszivitäten den Venezianern zugestanden wurden: „Tourists Only“! In Venedig wurde immer mit mindestens zweierlei Maß gemessen.
Für den gerade internationale Anerkennung erstrebenden Vivaldi muss es schon eine arge Zumutung gewesen sein, als die Signoria für das in der Frari-Kirche 1711 inszenierte Memorial-Konzert zur Krönung des Habsburgers Karl VI zum römischen-deutschen Kaiser an seiner Statt dem Florentiner Konkurrenten F. M. Veracini ein europaweit beachtetes Forum bot –und ausgerechnet diesen Geiger 1716 erneut einlud, um den Aufenthalt des sächsischen Kurprinzen mit sechs Ouverturen „im vermischten Geschmack“ auszugestalten, während der mit Bürgerrechten ausgestattete Vivaldi, höchst geschätzt vom Kurprinzen ebenso wie von Pisendel, dem mitreisenden Geiger, ausgeschlossen wurde. Zudem wackelte sein Lehrstuhl am Ospedale stets und ständig, bisweilen holte man für zwei Jahre namenlosen Ersatz, dann wieder ihn, kündigte nach einem Jahr erneut, holte ihn aber nach zwei Wochen reumütig zurück…. Nein doch: Goldonis Komödien sind keine lustigen Fantasien, sonder verdichtete Wirklichkeit !
Der Opern-Amüsier-Betrieb benötigte stets und ständig neue Werke – es ist der bedeutungslose Trash, der heute als „Barock-Oper“ die Feuilletons füllt – und drängte jeden ernsthaften Instrumental-Komponisten an den Rand der Szene, wenn nicht gar aus dem Land heraus: Locatelli und Geminiani sind nur die wichtigsten derer, die sich dauerhaft ihrem „failed state“ entzogen, nun ja: Tiepolo, Platti, Goldoni, Casanova, da Ponte folgten ihnen. Die, die zurückblieben, amüsierten sich und die Touristen „zu Tode“, ruinierten durch gnadenlos-platte Massenproduktion den Markt und unterboten sich derartig an Niveau, dass das Land nach 1750 keinerlei Beitrag mehr zum europäischen Konzert leisten konnte, Entwicklung anderswo, nämlich in Mannheim, London, Paris und Wien stattfand, aber nicht mehr und nie wieder in Rom oder Venedig!
Vivaldis Kompositions-Handwerk wurde bereits 1722 von seinem Landsmann Benedetto Marcello in der Satire „Teatro alla Moda“ gnadenlos ridikülisiert. Als Schüler von Gasparini und Antonio Lotti trat Marcello für eine Musik mit Ethos und Haltung ein – konnte folglich mit den fröhlich quietschenden Elaboraten des immer von mindestens drei Frauen und zwei Dienern umgebenen Vivaldi, der hüstelte und kränkelte und vielleicht auch ein wenig dümmelte, so garnichts anfangen. „Im Übrigen lasse der moderne Komponist verlauten, er komponiere oberflächliches und ausgesprochen fehlerhaftes Zeug, um den Vorlieben der Zuhörer entgegenzukommen. Auf diese Weise verunglimpft er den Geschmack des Publikums, dem ja der Schund, den es zu hören bekommt, bisweilen in der Tat gefällt. Dies rührt jedoch daher, weil ihm einfach nichts Besseres geboten wird.“
Auf den Profilierungsdruck von außen reagierend, wandte sich Vivaldi mit der Publikation des Opus 4 völlig vom Ensemble-Konzert ab und ausschließlich dem Solo-Konzert zu, in dem er neben stilistischen Sonderheiten vor allem seine geigerischen Qualifikationen zu demonstrieren suchte. Sämtliche gestalterischen Parameter sind nun dem bedingungslos Bizarren unterworfen: ausgedehnte Doppelgriff-Szenen, Bariolagen , exzessives Lagenspiel und querulante Bogentechniken auf der technischen Seite, im kompositorischen Tonfall hingegen deutliche Französismen, preziöse und elegante Wendungen neben solch prallen Formulierungen und Aufsehen erregenden Harmonisierungen, wie sie nur ein Vivaldi in Venedig zu Papier zu bringen wagte. Bisweilen sind die Ritornell-Strukturen aufgelöst, nur noch zu ahnen oder bereits ganz verschwunden: die Form mäandert zwischen Bogen und Griffbrett hin und her – sozusagen das Gegenteil der aus dem Opus 3 zu ziehenden Lehren., bzw. ihrer deutenden Weiter-Entwicklung durch J. S. Bach. Dennoch bietet auch das Opus 4 eine Menge von Motiven und Gedanken, die überformt, verfremdet und unkenntlich gemacht in Bachs Konzerten erneut aufscheinen.
Vivaldi war als Geiger-Komponist nur einer von fast unglaublich vielen italienischen Zeitgenossen, die bisweilen sogar Beachtlicheres geleistet haben, hatte aber mit den als Opus 8 publizierten Konzerten „Vier Jahreszeiten“ das ungeheure Glück, problemloser als alle die anderen im 20. Jahrhundert „anzukommen“ und nicht nur die Charts, sondern auch die öffentliche Meinung positiv besetzen zu können. Lange bevor die italienische Musikwissenschaft sich seiner erinnerte, war sein Oeuvre zudem durch die Verbindung zu J. S. Bach und auch zum Repertoire des „l’orchestra di Dresda“ bereits Forschungs-Gegenstand in Deutschland, durch erste Ausgaben um 1920 auch Spielmusik in Laien-Orchestern und später dann dem Nachkriegs-Kammerorchester mit reiner Streicherbesetzung.
Seine Kompositionen „con molti strumenti“ – wie sie vor allem in der Hofkapelle des augusteischen Dresden beliebt waren – blieben durch diese Begrenzung auf die Kammerorchester-Konditionen weitgehend unbekannt und wie auch jene kleinen pittoresk-turbulenten Concerti a quattro und a cinque an der Peripherie des Repertoires.
Genuin dürfte es sich bei diesen Concerti da Camera um Übungs-Material für die musizierenden Mädchen des Ospedale handeln, die – bevor sie als Solistinnen mit Orchester auftreten durften – erst einmal diese diffizilen Petitessen im kleinen Kreis zu absolvieren hatten. In all diesen Kompositionen, die so sehr unter der Gefahr stehen, in belanglose „schwere Stellen“ zu zerfallen, steht die scharf und klar zeichnende Blockflöte im Vordergrund, bisweilen ein ebenso heftig bewegtes Fagott und manchmal auch die bis ans Ende des Griffbretts ausgespielte Violine. Dass sich Vivaldis Verlag in Amsterdam nicht dazu entschließen konnte, diese Werke in einem eigenständigen Opus zu publizieren, später ein eher ungeschickter französischer Bearbeiter ein Opus 13 mit sechs Concerti für Flauto (traverso) auf den Markt warf, liegt daran, dass man in der Grachtenstadt durchaus wusste, welches geistvolle Feuer Telemann und Fasch aus den Funken, die Vivaldis Kammerkonzerte versprühten, zu entfachen imstande waren.
Wie in Marcellos ätzender Satire deutlich zu lesen ist, machte die Partei der „vieux partisans de la musique ancienne“ Vivaldi für den rasanten Niedergang der venezianischen Musik verantwortlich – nein: sein Oeuvre repräsentiert einen „failed state“, der angesichts des finalen Untergangs bedingungslos auf Karnevalisierung setzt. Das, was an Vivaldis vor allem frühen Kompositionen visionär, neu, lebendig und ausbaufähig war, wurde in Leipzig, Dresden und Paris genommen und inkorporiert. Ohne ihn, ohne seine geistreichen Harmonien und Stravaganzen klänge die Musik zwischen 1710 und 1750 und demzufolge auch heute vermutlich ein ganz klein wenig anders !