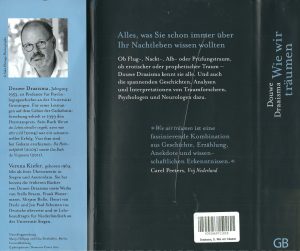Weitere Notizen zum Thema:
Schlagwort-Archive: Douwe Draaisma
Eine große Zeitung
Daran erkenne ich sie:
Sie passt nicht nur zu Silvester, sondern auch zum Neujahrsmorgen. Und im Streiflicht, das man gern als erstes liest, erscheint sogar, wie von vielen Menschen gewünscht, die inzwischen bekannte rhetorische Jahresendfigur als Satire: „Heute ist die Oma der weiße alte Mann unter den Frauen.“
Andere Themen, die uns zu Beginn eines neuen Jahrzehnts unter den Nägeln brennen, lassen sich in neuer Beleuchtung nachlesen. Ich hatte mir längst ein Büchlein ans Bett gelegt, um bei plötzlich auftauchender nächtlicher Melancholie gewappnet zu sein. (Ehrlich gesagt: das erste, was mir heute beim ersten Sonnenstrahl – den gab es wirklich!!!! – einfiel, war die Frage, warum das Schubertlied vom Heideröslein mir in meiner Kindheit viel weniger gefallen hat als das Volkslied und weshalb das ganze Schulmusikstudium, bei dem solche Vergleiche immer zugunsten der Klassikerversion ausfielen, nicht geholfen hat, bis dann Elly Ameling kam und alles zugunsten Schuberts wendete. Noch mehr durch das Lied „Frühlingsglaube“: Nun muss sich alles wenden…)
Man wird wieder sagen, dass ich die Holländer bevorzuge, und das vielleicht nur wegen meines Vornamens, den mein Vater gegen meine Mutter durchgesetzt (ihr war der Name zu kurz). Habe ich erwähnt, dass ich Elly Ameling schon einmal zum Hotel Solitude fahren durfte? Vielleicht hier? Und im Neuen Jahr werde ich wieder nach Domburg fahren. Um aber auf das anfangs erwähnte Büchlein zurückzukommen, das wirklich hervorragend ist und auch das im Titel genannt Problem zufriedenstellend löst:
Aber ich würde auch Hartmut Rosa nicht vergessen, – war es nicht ein Gespräch mit Richard David Precht? Jawohl, siehe hier, dafür habe ich ja den (das) Blog: damit ich behalte, was ich vergesse!
Falls ich an diesem Eintrag noch weiterschreibe (das schöne Neujahrswetter lockt in die nahgelegne Ohligser Heide), also: falls, – so sollte es dem „Heideröslein“ gelten. Und nicht der Vergänglichkeit.
As Time goes by…
Eigentlich liebe ich diesen Song aus „Casablanca“ nicht besonders, jedenfalls weniger so für sich (als Musik) als so, verbunden mit der Atmosphäre des Films, aber anderen bedeutet er – glaube ich – so wie so viel mehr, und das hat sicher gute Gründe .
Gegen Ende des Jahres 2014 erhielt ich die Mail eines alten Freundes, die mit den Sätzen schloss:
Wie kommt es nur, dass die Zeit einem mal rasend, mal schleichend vorkommt? (Gut: dass sie schleicht, wenn man wartet, ist ja bekannt.)
Voriges Jahr Ende Dez. waren wir in Palma – und das kommt mir mindestens wie 2 Jahre vergangen vor. Wahrscheinlich, weil soviel zwischendurch war – was mir wiederum viel zu wenig war. Wenn E. nicht ein bisschen bremsen würde, wäre ich vermutlich die Hälfte des Jahres woanders. Immer mit dem Druck im Rücken: Irgendwann sorgt die Natur schon für ein abruptes Ende. Und da das Reisen aufhört, wenn nur einer ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch.
Und ich antwortete mit dem Hinweis auf ein Buch, in das ich selbst immer mal wieder gern hineinschaue: Douwe Draaisma: „Warum das Leben schneller vergeht, wenn man älter wird. Von den Rätseln unserer Erinnerung“. (Piper Verlag 2006 / 2009)
Und nun lese ich noch einmal das kostbare Büchlein „Orte und Nicht-Orte“ von Marc Augé und sehe einen größeren Zusammenhang, der auch meinen Großvater einschließt. Doch zunächst erschrecke ich, dass der Fall der Mauer in Berlin erwähnt wird, denn die Lektüre dieses Buches schien mir mindestens 30 Jahre zurückzuliegen:
…doch können wir uns dem Problem der Zeit aus einer anderen Perspektive nähern, im Tageslicht von einer banalen Beobachtung nämlich, die wir täglich machen können: Die Geschichte beschleunigt sich. Kaum haben wir Zeit gehabt, ein wenig älter zu werden, da ist unsere Vergangenheit bereits Geschichte. Meine Generation hat in ihrer Kindheit und Jugend die stille Nostalgie der Veteranen des Ersten Weltkriegs kennengelernt, die uns zu sagen schien, daß sie die Geschichte (und welche Geschichte!) erlebt hätten und daß wir niemals wirklich verstehen würden, was das bedeutete. Heute gehen die sechziger, die siebziger und die achtziger Jahre ebenso schnell in die Geschichte ein, wie sie daraus hervortraten. Die Geschichte ist uns auf den Fersen. Sie folgt uns wie ein Schatten, wie der Tod. Die Geschichte – das heißt ein Folge von Ereignissen, die von vielen als Ereignisse verstanden werden (die Beatles, 1968, der Algerienkrieg, der Fall der Mauer in Berlin, die Demokratisierung der Länder des Ostens, der Golfkrieg, der Zerfall der Sowjetunion), eine Folge von Ereignissen, von denen wir annehmen dürfen, daß sie in den Augen der Historiker von morgen oder übermorgen Gewicht haben werden und zu denen jeder von uns – obschon er sehr wohl weiß, daß er in diesem Geschehen keine gewichtigere Rolle gespielt hat als Fabrice in Waterloo – ein paar Umstände oder partikulare Bilder hinzufügen könnte, als wäre es jeden Tag weniger wahr, daß die Menschen, die ja die Geschichte machen (wer sollte es sonst tun?), nicht wissen, daß sie sie machen. Ist es nicht gerade diese Überfülle (auf einem Planeten, der täglich kleiner wird; davon wird noch zu reden sein), die diffizile Probleme für den Historiker der Zeitgeschichte schafft?
Quelle Marc Augé: „Orte und Nicht-Orte“ S.Fischer Verlag Frankfurt am Main 1994 (Seite 35f) ISBN 3-10-000516-3