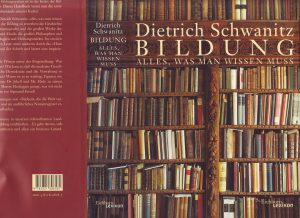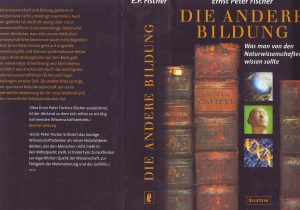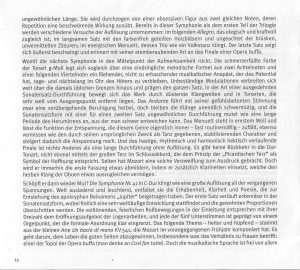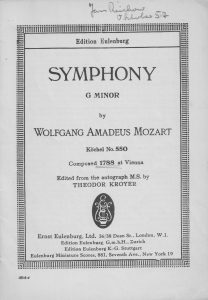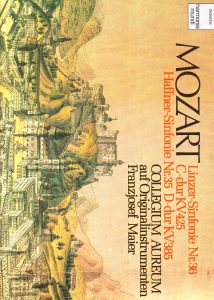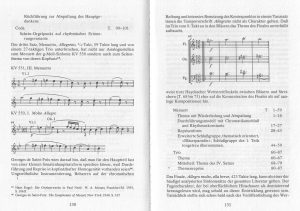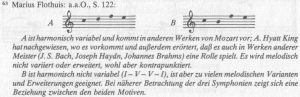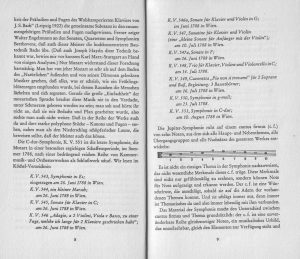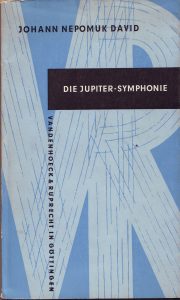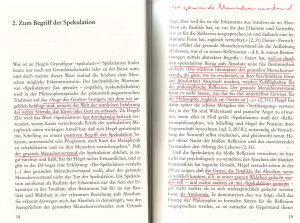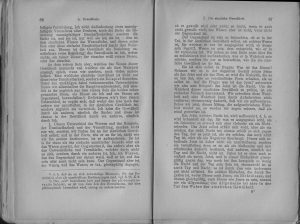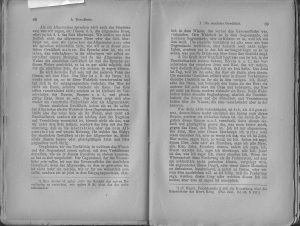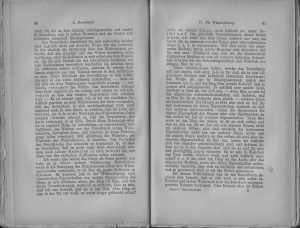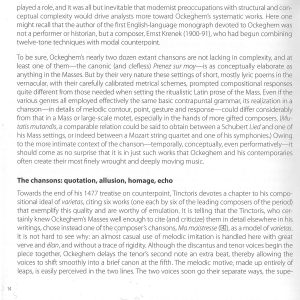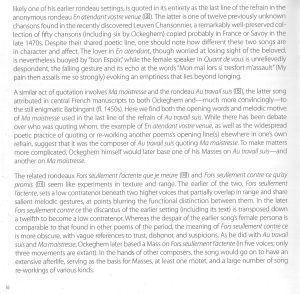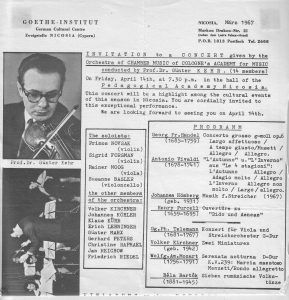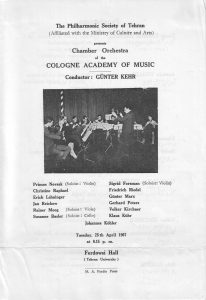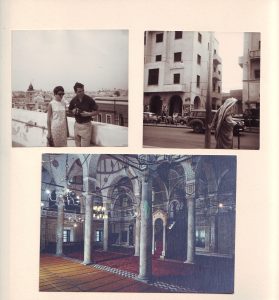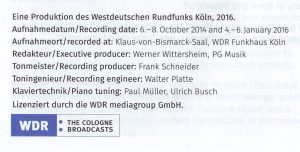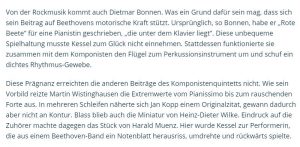Wie ein fruchtbares Gespräch verlaufen könnte
ZITAT zur heutigen Situation
Die Kulturmaschine fordert die Enthierarchisierung der Kulturformate. Während die klassische Moderne eine klare Hierarchie zwischen Hochkultur und Massen- beziehungsweise Populärkultur sowie öffentlicher und privater Kultur sah und kultivierte, bauen sich diese Hierarchien in der digitalen Welt der Spätmoderne ab. Sämtliche Kulturelemente sind nun auf die gleiche Weise zugänglich und unterliegen den selben Mechanismen der Aufmerksamkeits- und Valorisierungsmärkte. In der digitalen Welt befinden sich die Kulturformate alle auf einer Ebene, die hochgradig plural ist; nur wenige Klicks führen die Rezipienten aka [also known as] User von ihren privaten Urlaubsfotos zu Klassikern der Filmgeschichte, von den Nachrichten ihrer Freundezum Bericht vom Parteitag, vom Porno zu Shakespeares The Tempest oder Innenansichten der Suiten eines Pariser Nobelhotels.
Anmerkung 35
Die formale Gleichheit der Kulturelemente geht mit ihrer Entkontextualisierung einher. Klassische Kulturhierarchien wurden auch über die eindeutige Differenzierung stabilisiert: Bücher in der Bibliothek, Nachrichten im Fernsehen, klassische Musik im Konzerthaus, private Mitteilungen im Brief oder am Telefon. Nun sind jedoch alle diese heterogenen Kulturformate über den „gleichen Kanal“ zugänglich.
Zugleich konkurrieren diese Kulturformate gewissermaßen objektiv auf der gleichen Ebene miteinander: Es findet ein Wettbewerb um Sichtbarkeit und Anerkennung statt, konkretisiert in der Anzahl der Klicks und der Verlinkungen, der Likes und der Rangfolge, den die Suchmaschinen ihnen zuordnen. In diesem Wettbewerb stehen die Urlaubsfotos ebenso wie die Shakespeare-Sonette, das Hotel, der Parteitag oder der Tweet in gleicher Weise. Enthierarchisierung heißt natürlich nicht, dass alles gleich viel wert wäre, im Gegenteil: Mit Blick auf ihr Aufmerksamkeitsprestige sowie ihre valorisierte Qualität unterscheiden sich die Kulturformate drastisch voneinander. Den wenigen äußerst sichtbaren Elementen steht die große Masse der nahezu unsichtbaren gegenüber. Wie in der Ökonomie der Singularitäten herrscht auch im Internet eine ausgeprägte Sichtbarkeitsasymmetrie; und beide Asymmetrien, die ökonomische und die medientechnologische, verzahnen sich miteinander.
Quelle Andreas Reckwitz: Die Gesellschaft der Singularitäten / Zum Strukturwandel der Moderne / Suhrkamp Verlag Berlin 2017 (Seite 240f)
Wo bleibt der Wille zur Bildung durch Bücher?
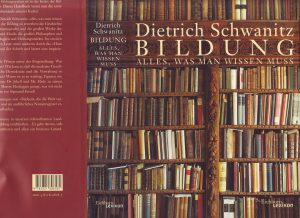
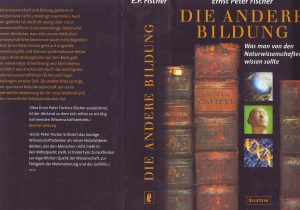
Eine Merkwürdigkeit: dass diese ganze Diskussion, die um die letzte Jahrhundertwende stattfand, vergessen ist. (Über Dietrich Schwanitz hier).
Was ich früher mal zum Thema notiert habe
 zur Blogseite HIER
zur Blogseite HIER
Zur Bildung gehört meines Erachtens nicht nur das Lernen (und das heißt eben nicht einfach: der einzelne Mensch vor dem Computer), sondern auch das Gespräch, die Diskussion, – nicht die konfrontative, in der die Teilnehmer letztlich nur die jeweils eigene Position ausbauen und verstärken, sondern die konstruktive, einander ergänzende, durchaus latent competitive Unterhaltung mit einer anderen Person (oder mehreren, ich glaube, nicht mehr als um einen kleinen Tisch passen). Die Runde bei Markus Lanz (eine zur Kamera hin aufgebrochene!) ist etwas anders, weil der Moderator Sonderrechte genießt, die im Gespräch schwer erträglich wären. Trotzdem ist es möglich, dank seines persönlichen Geschicks und seiner Fähigkeit zuzuhören. Vielleicht eher nach dem Muster der Precht-Sendung, in der durchaus drei oder vier kommunizierende Teilnehmer denkbar wären, die sich unterhalten.

 Screenshots ZDF-Sendung
Screenshots ZDF-Sendung
Gesprächstext ausschnittweise
Lanz ab 32:42
So hängt alles mit allem zusammen, und es ist auch klug, die Argumente auszutauschen. Harald Lesch ist bei uns, der ein interessantes Buch mitgebracht hat, eigentlich ist es eher son Streitgespräch, und eigentlich ist es, so hab ich das gelesen, eher die Aufforderung, ein Herzensthema von Ihnen, nämlich Bildung, und die Frage, wie schauen wir auf Wissen, mal wirklich auf den Kopf zu stellen. Was läuft denn, wenn wir ne kleine Analyse mal machen, was läuft denn (..) wenn Sie mal versuch müssten, die fünf wichtigsten Punkte kurz ma skizzieren, – Was läuft grundlegend und prinzipiell nicht gut in unserem Bildungssystem, Ihrer Meinung nach?
33:25 LESCH Also ich glaube, dass insgesamt zu wenig in Zusammenhängen unterrichtet wird. Also wir haben zuviel Schubladen und zu wenig Motivation für alle diejenigen, die alle diejenigen, die irgendwo unterrichtet werden: Warum soll ich mich mit einem bestimmten Thema überhaupt auseinandersetzen? Und dadurch, dass die Fächer so stark voneinander getrennt sind, anstatt sie wirklich zusammenzuziehen, und anhand von einem Phänomen, einem bestimmten Thema sollten möglichst viele Schulfächer sollten daran arbeiten, Klimawandel wäre zum Beispiel son wunderbares Thema, wo man zeigen kann, da sind nicht nur die Naturwissenschaften, sondern natürlich auch Literatur, wie gehen Menschen in den Ländern mit den Gefahren eines verwandelten Klimas um? Was bedeutete das, wenn (Geschichte!) genau, Geschichte natürlich, das Anthropozän als Begriff, der Dirk [Steffens] was ja neulich hier und hat das erzählt, durch den Menschen, ich benutze gern das Wort Kapitalozän, nicht wahr, das Erdzeitalter, das durchs Geld geprägt ist, aber das hats noch nicht so weit gebracht (ML Sie kriegen heute wieder Ärger nach dieser Sendung, Herr Lesch, aber das kriegen wir schon hin. HL ja das ist schon o.k.)
Der Hauptpunkt ist einfach, dass durch diese Klassifikation in einzelne Fächer in unserm Kopf etwas entsteht, das gar nicht der Welt entspricht. Der Welt entspricht nämlich etwas ganz anderes, dass wir nämlich über grundlegende Fähigkeiten verfügen müssen, wie wir uns mit ihr auseinandersetzen müssen. Und ein wichtige davon, die im Abendland sich entwickelt hat, ist eben: zu schreiben, zu lesen und zu rechnen. 34:55 Das heißt: wir können etwas quantisieren, (zu Juli Zeh, die lacht) nicht quantisieren, Pardon, wir haben vorhin über Dekurenz (???) gesprochen, also wir können etwas quantitativ erfassen, in Zahlen nämlich, – Mathematik spielt für uns ne wichtige Rolle: in allen Lebensbereichen ist es wichtig, die Relationen einschätzen zu können, aber wir müssen auch mit Texten umgehen können, also wir müssen den Text lesen können, verstehen können, interpretieren können, also wir müssen auch verstehen, was zwischen den Zeilen steht, und wir müssen natürlich auch selber Texte produzieren können, und diese drei wesentlichen Fähigkeiten im Zusammenhang gebracht mit dieser unglaublichen Informationsmenge, die uns ja heute über die verschiedenen Medien zur Verfügung stehen, das macht heute einen gebildeten Menschen aus 35:33 und dafür sind die Schulen in Deutschland einfach nicht gemacht… ML mal ganz so ganz holzschnittartig runtergebrochen, wer geht da so mit fünf, sechs Jahre in so ne Schule herein, und wer kommt am Ende raus? HL Also das ist interessant, ich glaube, man sollte n Film drehen, so die erste Woche in so ner ersten Klasse, die sind noch total begeistert, das ist so ne Freude, denen zuzugucken usw. – natürlich gibt’s auch den einen oder anderen, der sagt: hm, hier geh ich nicht mehr hin. Aber dann, merkt man… und wenn man jedes Jahr so ein Video von der Klasse machen würde, wie die Lust etwas zu lernen systematisch in die Knie geht (Lauterbach nickt), und dann kommt die Phase, wo vor allem bei Jungen hier vorne (zeigt auf die Stirn) steht: „under construction“, ja? das ist die Pubertät – „Baustelle!“

– da müsste man etwas tun in der Schule, was in Deutschland viel zu wenig gemacht wird – man muss sie tatsächlich dann in den Wettbewerb schicken, Theater spielen, Musik machen, Sport, Kunst, Werken, woran sich eine Person ausprobieren kann, und dann später – weil Sie vorhin gesagt haben, mit der Pubertät hört die Mathematik auf – um später dann wieder einzusetzen – o.k. jetzt bist du so weit, dass du auch mit Abstrakterem, mit abstrakteren Begriffen und Themen auseinandersetzen kannst, alles woran sich eine Person ausprobieren kann und dann später – weil Sie gesagt haben, in der Pubertät hört die Mathematik auf – und dann später wieder einzusetzen und dann zu sagen: o.k., jetzt bist du so weit, dass du dich auch mit abstrakteren Begriffen, mit abstrakteren Themen auseinandersetzen kannst, – dazwischen muss Schule die Gelegenheit geben, dass Persönlichkeiten entstehen, die an ihrer … an ihrer Findung ihrer Identität viel intensiver beteiligt sind, als das momentan der Fall ist. Wir sind einfach zu viele (Beifall) zu viele Kinder, also: das Leben vieler Jugendlicher findet nur zweidimensional statt, also entweder auf dem digitalen Diktator in der Hand oder auf dem Flachbildschirm, auf dem irgendwelche Spiele gespielt werden. Aber das Dreidimensionale, das Leben, das riecht, das anders klingt, wo es dreckig ist, wo irgendwas passiert, was einem möglicherweise nicht gefällt, und wo vor allem die Auseinandersetzung da ist, – bei Aristoteles ist es im Grunde so schön definiert: Der Mensch ist das Tier, das mit andern Menschen zusammenlebt, das zoon politikon, dieses Zusammensein, das ist natürlich der große… der große Punkt, wo man Schule viel stärker machen muss, und das ist auch der Gegenstand unseres Buches, „Wie Bildung gelingen könnte“, hat natürlich damit zu tun, wie diejenigen sich fühlen könnten, die in der Schule sich Tag für Tag treffen, nämlich die, die unterrichten, und die, die unterrichtet werden. 37:46 Exakt“ ML Wenn wir nun zunächst mal den Blick auf die richten, die unterrichtet werden. Eh … Sie plädieren für die Waldorfisierung der Schule (ja), sagen auch, es könnte mal n bisschen gemütlicher zugehen (na klar), sollte n bisschen mehr Raum geben … auf diese Nachricht habe ich 15 Jahre gewartet (HL lacht laut) und habe sie nicht … und Mathe abschaffen in der Pubertät, und morgens um 9 erst anfangen (aber unbedingt!)… Unbedingt??? Einmal kurz: warum? HL der Biorhythmus der meisten Menschen ist tatsächlich so, vor allem der Kinder ist tatsächlich so, dass ab 9 Uhr ist der Organismus ganz anders wach, aufmerksam und in der Lage, auch für längere Zeit ja dann recht heftig zu arbeiten, diese erste Stunde in der Schule ist für viele Kinder einfach (Geste der Müdigkeit) schwierig. ML Steht da nicht die Sorge, dass man so das Leben einfach verschiebt, also dass das eine große Zeitverschiebung wird, HL Aber man sieht es ja in Spanien, in Frankreich, in Italien, überall fängt die Schule später an Karl Lauterbach es gibt ja auch medizinische Hinweise da drauf, dass … es gibt also Studien darüber, wie der Biorhythmus funktioniert, mindestens die Hälfte der Menschen hat genetisch einprogrammiert, dass über Jahrtausende und Jahrtausende, insgesamt über 30.000 Jahre hat sich das entwickelt, also für die Hälfte der Menschheit ist der Biorhythmus so entwickelt, dass man vor 9 Uhr überhaupt die volle Denkfähigkeit noch nicht hat, leider für mich auch so und … (Lachen und Beifall) ML Also der perfekte Schultag, wie sieht der dann aus? 39:28 (….) Sechsjähriger in die Grundschule, dann lernt der erstmal Lesen und Schreiben, Rechnen wichtig, Sie sagen es, mit der Hand schreiben HL Mit der Hand schreiben ist ne ganz wichtige Sache (weil?) ist für unser Gehirn extrem wichtig, also diese Verbindung zwischen Hand und Kopf, ist über die Handschrift eine ganz wichtige Sache, die zur Vernetzung dieses jungen Kopfes sehr stark beitragen. Der nächste Punkt ist die Frage, mit welcher Geschwindigkeit eigentlich die Inhalte präsentiert werden, und Kinder mögen nichts mehr als zu spielen, also sollte man ihnen zum Beispiel Mathematik – Mathematik – Kopfrechnenwettbewerbe als dieses schnelle — Einmaleins zackzackzack das ist inzwischen aus der Schule fast verschwunden, es gibt ja fast niemanden mehr, der richtig mit dem Kopf rechnen kann, man weiß es … ich weiß nicht, wann der Taschenrechner seine Tür in die Schule gefunden hat, aber damit war klar: muss ich nicht mehr wissen, und heutzutage geht es ja noch viel weiter, weil: das muss ich nicht mehr wissen ist selbst gesellschaftsfähig geworden weil, man kuckt einfach so automatisch bei der Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, bei irgendeinem Lexikon, deren Name auch nicht genannt werden muss, und dann weiß man’s und dann hat mans auch schon wieder vergessen. Aber diese grundlegende Fähigkeit, das was ich eben meinte mit diesen drei Dimensionen Schreiben, Lesen und Rechnen, die spielerisch und mit etwas – was an den Musikschulen zum Beispiel das Thema ist (ML Fokussierung!), nämlich: Üben – Üben – Üben – einfach immer, aber diese Übung macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Motivation an erster Stelle steht, also: was kann man damit machen? Ich hab mit Gudrun Mebs n kleines Büchlein geschrieben, das hieß „Mit Mathe kann man immer rechnen“, da gehen Kids mit einem Proff, also mit einem Professor, los und ziehen durch die Welt und kucken, wo gibt es überall Mathematik und wo muss man und die sind bei einem Schreiner und der erklärt ihnen, ohne Mathematik kann ich keinen Tisch bauen, kann keinen Stuhl bauen, und sie gehen in den Supermarkt , das kostet so viel und das kostet so viel, aber das ist ja viel teurer usw. und sie gehn auch in ne Bank und wollen dann aber sehen, dass der Bankmitarbeiter im Kopf rechen kann und dass er nicht alles auf seiner Kassenmaschine – also es ist großartig, so, was ich damit sagen will, die Möglichkeit, die Fähigkeit derer, die da unterrichten, auch mal wahrzunehmen, ich meine, wir bilde Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland aus, in allen möglichen fachlichen Inhalten, aber ihnen die Gelegenheiten, die Gestaltungsspielräume zu geben, mit dem Inhalt in der Schule wirklich zur Persönlichkeitsbildung beizutragen, die schlagen wir wieder kaputt, weil wir sie, weil wir diese Schulsysteme so stark beschleunigt haben 42:10 so stark verdichten, von den ganzen Inhalten her, die da präsentiert werden, dass die armen Leutchen, die da unterrichten da, „du ich kann nichts… du, ich würd ja gerne, ich hab gar keine Zeit, am Ende einer Schullaufbahn stehen irgendwelche Zentralprüfungen, ich kann keine Rücksicht darauf nehmen, dass ich bei jedem einzelnen mit verschiedenen Tempi eigentlich arbeiten muss.“ ML Menschen haben unterschiedliche Geschwindigkeiten… HL Es gibt ja auch ne Reihe von Schulen in Deutschland, die das schon machen, es gibt in Jenaplan-Schulen zum Beispiel, die Waldorfschulen sind – da will ich gar nicht auf den anthroposophischen Hintergrund ko…“ ML Die Waldorfisierung der Schulen, – erklären Sie das mal… Was ist damit gemeint? 42:44 HL Es geht darum tatsächlich zunächst einmal für lange Zeit ganz darauf zu verzichten, Kinder zu beurteilen in irgendwelche Zahlen; denen erstmal die Gelegenheit zu geben, irgendwelche grundlegenden Fähigkeiten, also meine großen Drei, dass die die alle erstmal können. Das ist das allerwichtigste. Die müssen richtig schreiben, lesen und rechnen können. Und dann kann man allmählich tatsächlich beginnen, über Wettbewerbssituationen, die man in der Schule ja ständig schaffen kann, tatsächlich sowas zu machen wie Tabellen und Ranking, aber es geht vor allem darum, dass allmählich zu tun und zu sehen, wie Kinder sich entwickeln, diese große Neugier, dieser Enthusiasmus, den man in dem ersten Video in der Grundschule im ersten Schuljahr noch sieht, das ist der eigentliche Schatz, den diese Kinder mitbringen. 43:31 Wenn wir denn in der Schule kaputtmachen, dann (…)
49:49 ML Infrastruktur, öffentlicher Nahverkehr, alles wichtig, keine Frage, aber, Herr Lesch, ich hab Ihr Buch – es ist ja kein wirklich dickes Buch – aber ein sehr interessantes, sehr inspirierendes Buch – schon als etwas anderes verstanden, da geht es schon auch um n bisschen mehr. Es geht auch um die Frage, wie schaffen wir es, kreative, neugierige menschen da rauszukriegen am Ende, die auch in der Lage sind, sich z.B. zu konzentrieren, das ist etwas was mir immer wieder auffällt, wie erleben Sie das , als Professor, wie erleben Sie das bei Ihren Studenten, ich hab neulich ne Untersuchung gelesen, wir waren im Jahre 2000 im Schnitt noch in der Lage, uns 12 Sekunden noch auf eine Sache zu konzentrieren, mittlerweise sind wir bei 8 und Goldfische sind bei 9, das ist ja keine wirklich gute Nachricht… ML Ja, ich unterrichte gern im Aquarium, (Lachen) also es ist in der Tat so, und da hat man natürlich als Hochschullehrer hat man ja, so wie alle Lehrer diese irre Situation, jedes Jahr kommen wieder Menschen aus dem gleichen Alter, man hat so im Laufe der Jahrzehnte dann so ne Erfahrung, man sieht natürlich, also ich hab – da bin ich mit vielen völlig einig – wir erleben eine Reduktion der Aufmerksamkeitsspanne. (Ist so, nicht?) Ist ganz klar, ist ganz klar, und zwar unter anderem mit dem Hinweis: ich muss das in der Vorlesung ja gar nicht so… weil, das kann ich mir ja alles nochmal ankucken, weil: es gibt das Skript digital, es gibt alles mögliche digital, und wenn ich es digital hab, dann habe ichs ja auch alles schon hier oben irgendwie drin. Gut, ich muss noch dran arbeiten, aber das sind Details. Das mach ich so irgendwie nebenher, das kann man auch im Stehen machen, (Handy-Gesten, Lachen ) die Aussicht, man könne ja alles, wenn man nur wolle, dann könne man ja, verursacht Aufmerksamkeitsprobleme, weil man dann braucht man sich ja jetzt nicht zu konzentrieren, weil da gibts vielleicht ganz andere Dinge, auch schon wieder irgendwelche Informationen, also Ruhe zu haben, sich zum Beispiel einem Text zuzuwenden und den laut vorzulesen, also für alle anderen im Saal mal laut vorzulesen, was man da ….. an Deutschlands …. Universitäten … das ist schon interessant. Ne? 51:58 Einen Text so vorzulesen, dass alle gut zuhören und auch vor allen Dingen am Ende nicht nur eine Inhaltsangabe zu machen, sondern eine Zusammenfassung, wo der oder diejenige, die das dann präsentiert hat, auch tatsächlich mal sagen, wie haben sie denn den text verstanden und was ist ihre Position dazu. Das ist z.B. ne Sache, die mir auffällt, und das andere, was mir auch auffällt, ist: die fast flächendeckende Unfähigkeit, über das Theme oder über das Fach, das man studiert, zu sprechen. Im Sinne von: warum mach ich das? und was fasziniert mich daran eigentlich? Als was ist der Grund gewesen, weshalb ich warum habe ich angefangen Physik zu studieren, und was mach ich denn jetzt so grade? Es gibt nach wie vor diese Top 10 Prozent, die können das, aber ein erheblicher Teil der Studierenden hat überhaupt… also ist gar nicht in der Lage … ich bin jetzt grade mitten in der Prüfungsphase, also, und ich mache mündliche Prüfungen in Physik, das ist für viele Studenten … hnnnyyh… 52:56

(Fortsetzung folgt)
 bitte anklicken und auch die kleinen Bilder rechts zur Kenntnis nehmen. Es bleibt interessant ! Zur Originalsendung jedoch nur über den folgenden Link:
bitte anklicken und auch die kleinen Bilder rechts zur Kenntnis nehmen. Es bleibt interessant ! Zur Originalsendung jedoch nur über den folgenden Link: