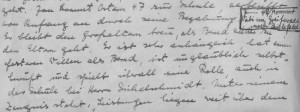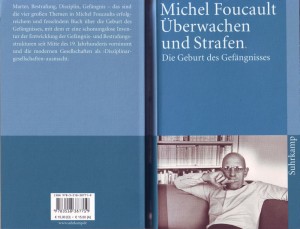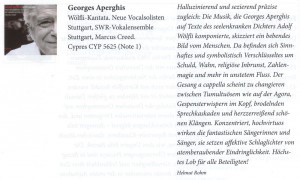Auf der Suche nach der verlorenen Zeit …
Aufführungspraktische Betrachtungen
Von Reinhard Goebel
Hätte man mich vor 25 Jahren um Gedanken zur Frage »Was ist AP« [= Aufführungspraxis; Anm. d. Red.] gebeten, wäre eine flammende forensische Rede entstanden. Ich will nicht sagen, dass meine Gedanken heute lahmer wären – das festzustellen überlasse ich anderen – aber das »Gschmäckle«, dass das Wort AP durch seinen inzwischen inflationären Gebrauch provoziert, lässt mich nicht ganz kalt. An jedem Dirigentenpult hängt heute ein Mäntelchen mit einem in müllmännchenrot-fluoreszierenden Aufdruck vorne und hinten: »AP« – und wenn der Dirigent sich diesen Paletot umgeworfen hat, dann weiß selbst das Orchester in der Provinz: absolut kein Vibrato, Bogenstriche von abstrusester Art, mehr in der Luft als auf der Saite und vor allem Doppel-Punktierungen und auf dem zweiten Schlag betonte Sarabanden! Das ist AP praktisch: Irgendwo Aufgeschnapptes möglichst sofort und ungeprüft in die Praxis umsetzen, plagiieren, irgendwie auch immer zeigen, dass der Komponist ein Depp war und noch nicht korrekt schreiben konnte, was er hören wollte. Zur Kennzeichnung derartiger Kenner und Könner, zur Unterscheidung der vermeintlich Klugen von den vermeintlich Dummen, hat sich im englischen Early-Music-Milieu inzwischen die Bezeichnung H.I.P., »historically informed player« durchgesetzt. Wo und vor welchem Gremium man eine H.I.P.-Prüfung ablegen kann, ist indes noch unklar!
AP ist – so wie ich sie verstehe – die Wissenschaft von der umfassenden Verortung eines musikalischen Kunstwerks an seinem ursprünglichen Ort in seiner ursprünglichen Zeit. Diese Wissens-Aneignung ist in zweierlei Richtung neutral: Zum einen habe ich mit der Komposition kein Liebesverhältnis, sie ist nicht meinem Ausdruckswillen kongenial, sondern ich muss Sie kennenlernen – zum anderen aber verpflichtet mich nichts, das erworbene Wissen in musikalische Tat umzusetzen. Im Grunde ist der Aufführungs-Praktiker erst einmal ein Dramaturg, der sämtliche erreichbaren Quellen und auch Aussagen zu einem Werk findet und zusammenstellt; ob der Regisseur – im Glücksfall ist der Konzertmeister bzw. der Dirigent Dramaturg und Regisseur in Personalunion – später all das Wissen in Anwendung bringen will und kann, ist allein seine Entscheidung.
Die »Ortung« ist rein physikalisch und umfasst Fragen des Raums und der Besetzung, der Wahl der Instrumente, ihrer Aufstellung und auch der Beziehung Klangquelle – Hörer. Gerne wüsste man beispielsweise etwas zum Grundriss des Leipziger Kaffeehauses Zimmermann, in dem Bachs Collegium Musicum auftrat!
Die »Zeit«-Frage ist komplexer: Zum einen verortet sie die Komposition in der Biografie des Komponisten, wesentlicher aber ist die Frage nach der Eingebundenheit des Kunstwerks in das oder in ein zeitgenössisches Theoriegebäude. Die Historizität der Notationsmöglichkeiten muss geprüft werden und sicher stellt sich auch die Frage nach den Rezeptionsmöglichkeiten der ursprünglich adressierten Hörer.
Allein der Versuch einer Beantwortung dieser Fragen kommt dem Kampf des Herkules mit der Hydra gleich: Aus jeder Frage wachsen gleich mindestens zwei weitere nach. Man geht irgendwann auf die physische Beurteilung der Materialüberlieferung zurück – und muss sich fragen, ob das, was die Neue Bach-Ausgabe und die Schwester-Editionen der Werke Telemanns, Händels und Mozarts als klinisch reinen Druck vorlegen auf eine Kompositions- und Konzept-Partitur, eine Partitur nach einem gespielten Stimmensatz oder eine finale (Dedikations-) Reinschrift zurückgeht.
Kein selbstbestimmter und in den Methoden der diplomatischen Quelleninterpretation erfahrener Künstler liefert sich heute noch bedingungslos den Meinungen eines Herausgebers aus: Er wird sich – es mag sich um bachsche Sopran-Kantaten, Beethovens Violinkonzert op. 61 oder Mozarts quellenmäßig besonders heikle Linzer Symphonie handeln – immer selbst den Originalen zuwenden (müssen) und feststellen, wie radikal und rücksichtslos in dem Spagat, »für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen« brauchbare Texte zu liefern, originale Befunde verändert wurden.
Zu den Arbeiten im »Zeit«-Sektor gehört zweifellos auch die Befragung und vor allem die Evaluation der aufführungspraktischen Originalquellen: Wer schreibt hier für wen, wer kannte diese Quelle im 18. Jahrhundert, wie maßgeblich war sie – war sie gar ein Ladenhüter oder vielleicht völlig unbekannt? Nur ein Beispiel: In den heute tonangebenden Zirkeln der »vrais partisans de la musique ancienne« werden die Strichanweisungen von Georg Muffat, gedruckt im Jahr 1698 im Vorwort zu der Tanzsammlung Florilegium Secundum, wie goldene Worte, wie die zehn Gebote des Barockbogens gehandelt und wahllos auf alles zwischen Monteverdis Orfeo und Brahms’ Requiem angewendet. Vor nicht allzu langer Zeit konnte man im Fernsehen ein Kammerorchester mit Muffat-Strichen höchst anachronistisch durch den dritten Satz von Beethovens Erster Symphonie hüpfen sehen. Man hatte ganz offensichtlich »nur« vergessen, in der 1834 erschienen Violinschule von Pierre Baillot, dem ersten großen französischen Apologeten Beethovens, nachzuschauen, welche Stricharten hier für Punktierungen empfohlen sind. Zeitlich noch näherliegend wäre allerdings die (heute schwer aufzutreibende) dritte, von fremder Hand korrigierte Auflage (Leipzig 1806) von Leopold Mozarts Violinschule. Und last not least hatte sich der Berliner Johann Friedrich Reichardt schon 1776 in seinen Pflichten des Ripien-Violinisten explizit zu diesem Tatbestand geäußert.
Erstaunlicher aber noch ist, dass die Sammlung Florilegium Secundum im Gegensatz zu ihrem ersten Teil in keinem der maßgeblichen Lexika (Walther, Zedler, Gerber) des 18. Jahrhunderts Erwähnung findet, ja selbst ein so raffinerter Büchernarr wie der Straßburger Komponist Sébastien de Brossard kein Exemplar besaß – mit anderen Worten: Die heute grandios überbewertete Quelle ist das Werk eines nie-und-nimmer-Lully-Schülers, eines Organisten, der glaubte, aus Ranküne mit seinem ehemaligen Salzburger Kollegen Heinrich Ignaz Franz Biber einen öffentlichen Zweikampf ausfechten zu müssen!
Weitaus bedeutender für die AP sind hingegen die bisweilen atmosphärischen Texte Giuseppe Tartinis, der als Paduaner »maestro delle nazioni« ein Halbjahrhundert lang eine schier unendliche Schülerschar aus ganz Europa lehrte und über Ausstrahlung und Einfluss bis hin zu seinen Enkelschülern Bartolomeo Campagnoli und vielleicht auch Wilhelm Friedemann Bach verfügte. Gleichwohl ist auch hier zu beachten, dass Tartinis Lehrmeinungen nicht nur von väterlicher Milde triefen, sondern immer in Richtung jener Kollegen gezielt sind, die es anders machen, vor allem die des vermutlich etwas robusteren Antonio Vivaldi in der Nachbarstadt Venedig.
Eine kleine Fortsetzung dieser ständigen Auseinandersetzung wurde von dem Vivaldi-Freund Johann Georg Pisendel und dem Tartini-Schüler Johann Gottlieb Graun um 1725 in Dresden dargeboten: Letzterer blieb auf Weisung Pisendels so lange vom »orchestra di Dresda« ausgeschlossen, bis er seinen tartinischen Manieren abgeschworen hatte und wieder zur Lehrmeinung der Desdener Schule zurückgekehrt war.
Je feiner die Methoden der Quellenbefragung sind, umso klarer erscheint, dass die Aufführungsstile vor der Erfindung von Tonträgern weitaus mehr chronologische, lokale und nationale Eigenarten und Unterschiede aufgewiesen haben müssen, als uns heute auch nur annähernd vorstellbar ist – und dass unsere moderne AP älterer Musik ein synthetischer Idealstil ist, der Textbausteine von 1600 bis 1800 miteinander verknüpft und (viel) Fehlendes mittels eines zwischen 1950 und 1970 entwickelten Jargons ausgleicht. Ultima Ratio war das bedingungslose Anderssein. Sämtliche musikalischen Äußerungen des spätest-romantischen Karajanismus, besonders aber Karl Richters, der ja das Zentrum der Alten Musik beackerte, galten a priori als »impossible« – und neben einigem Gutem bescherte uns diese radikale Abkehr empathie- und pathos-freie, kammermusikalisch durchhörbare Matthäus-Passionen sowie einen Lastwagen voller unmanierlicher Aufnahmen der Vier Jahreszeiten, die pseudo-rezitativische Larmoyanz und naturalistisches Gekratze ohne klar erkennbare Tonhöhen als »authentisch« an den Hörer zu bringen versuchen.
Wenig Wertschätzung beim Studium der AP haben leider die umfangreichen Dokumentensammlungen zum Leben und Schaffen Bachs, Mozarts, Haydns und Beethovens gefunden. Zweifellos quält man sich bei der Lektüre durch einen Berg von Taufbelegen, Brennholz-Rechnungen und belanglosem Klatsch, trifft jedoch auch auf Sätze, bisweilen nur Satzfragmente, von zentraler Bedeutung, denen nachzugehen ungeheuren Gewinn bringt.
So schreibt Johann Adolf Scheibe 1737 in seiner Kritik an Bachs Kompositionsweise: »Alle Manieren, alle kleinen Auszierungen, und alles, was man unter der Methode zu spielen verstehet, drücket er mit eigentlichen Noten aus […]« Man überliest das, hakt es schnell als bekannt ab – anstatt sich auf die Suche nach dieser »ausgeschriebenen Methode« zu machen. Man findet sie überreichlich in den nach authentischen Stimmensätzen erstellten Partituren der Neuen Bach-Ausgabe in Form von artikulatorischer Durch-Ästhetisierung der Chöre und Arien, mag überrascht sein von dem gestalterischen Furor Bachs, der zumindest in seinen beiden letzten Lebensjahrzehnten mit dem heute als »authentisch« betrachtetem schwer-leicht-Getrampel wohl seine Probleme hätte. Und mit Vorsicht noch weiter ausgeholt: Scheibe schreibt nicht »alles, was man unter seiner Methode zu spielen versteht«, sondern »unter der Methode«! Und so eröffnet sich ein weiter Gestaltungsraum – nicht unbedingt für die Spielart vivaldischer Konzerte im authentischen Stil des »prete rosso«, vielleicht aber doch für ihre Darbietungsweise im vermutlich gänzlich anders gearteten Stil des »orchestra di Dresda«.
In den von Pisendel für Dresden »bearbeiteten« Werken fremder Komponisten – in Sonderheit solchen von Vivaldi, Telemann und Fasch – fällt auf, dass immer wieder an entscheidenden Stellen die ursprüngliche, in den vorliegenden Widmungs-Partituren ersichtliche Notation des Komponisten verändert ist, man weder um »Werk-Gestalt« noch gar »Authentizität« irgendwie bemüht war, sie zumindest nicht nur im philologisch einwandfreien Text verortete, wie wir das heute zu tun gewohnt sind.
Zudem scheint es in den »großen« höfischen Klangkörpern der Zeit – Dresden, Wien und Darmstadt, später Mannheim, Berlin und München – eine Ebene der künstlerisch-organisatorischen Durchgestaltung gegeben zu haben, die sich der Schriftlichkeit »per definitionem« entzieht. So lässt z. B. Johann Sebastian Bach in seiner im August 1730 erfolgten Eingabe an den Leipziger Rat erahnen, dass diese »in schwerem Solde stehenden« Musiker ihre Sachen »ja fast auswendig können«. Vorsichtig mit anderen Worten ausgedrückt: dass sie nicht am Sonntagmorgen eine kaum fertige Kantate eben mal durchsägten, sondern eine ganze Woche auf das Hofkonzert hinarbeiteten und dabei auch eine eigene Darbietungsart entwickeln konnten, die man bisweilen ganz tief zwischen den Zeilen und ganz weit hinter den Worten zeitgenössischer Beschreibungen zwar nicht entdecken, wohl aber erahnen kann.
Da bis weit ins 19. Jahrhundert hinein chorisch besetzte Streicherstimmen das »grosso« des Orchesters bilden, halte ich persönlich deren Spiel- und Gestaltungsweise bestimmend für den wesentlichen Klangeindruck eines Ensembles. Und so interessieren mich vorrangig Methoden und Bogen-Organisationen eines Bach, Biber, Vivaldi und vor allem Jean-Marie Leclair. Bei ihm – der als professioneller Tänzer erst mit 20 Jahren zur Violine kam und dennoch Frankreichs Apoll wurde – ist am ehesten eine sinnvolle Choreografie und Geometrie des Bogens für Tanzmusik »à la française« zu erwarten.
Untersucht man Leclairs Œuvre (eine Oper und etwa 80 sehr genau bezeichnete Kammermusikwerke), so wird man auf allenfalls nur ein Dutzend jener violinistisch-aufführungspraktischer Details stoßen, die normalerweise nicht notiert wurden. Aber so, wie wir in Johann Philipp Kirnbergers Schriften das Theoriegebäude seines Lehrers Johann Sebastian Bach erkennen, so finden wir in den 1761 publizierten Principes du Violon von Leclairs Schüler Joseph-Barnabé Saint-Sevin genau die gesuchten praktisch-organisatorischen Lehren seines Meisters: weit weg von all dem aufwändig-äußerlichen Bogen-Klimbim, der heute im Pseudo-Muffat-Stil inszeniert wird, dafür völlig »modern« in der geometrischen Handhabung des Streichbogens, der von Virtuosen – wie in Leopold Mozarts grafischer Darstellung eindeutig ersichtlich – (übrigens wie heute!) direkt am Frosch und nicht kurz vor der Mitte gehalten wurde.
Nein, das war jetzt nicht »alles«, gleichsam der lange ersehnte Schnellkurs »Historische Aufführungspraxis«, es war nur ein minimaler Einblick in die Methoden und Probleme der AP. All diese sachlichen Trouvaillen – und noch viele, viele mehr! – müssen zu einem wohlgemerkt heute wirkenden und heute künstlerisch beeindruckenden Ganzen verbacken werden. Denn AP hin oder her: Weder können sich die Einen darauf herausreden, »man« habe damals »anders« gespielt, habe sich bedeutungsloses Violinspiel und inkohärente Ensembleleistungen schon »irgendwie« zurecht gehört, noch kann die Gegenseite weiter behaupten, der Cembaloklang sei starr, die Barockoboe hässlich und die Darmsaite unerträglich. Die historische AP hat unser Musikleben doch enorm bereichert und auch verändert. Leider tritt sie augenblicklich ein wenig auf der Stelle …
Der Autor ist einer der führenden Vertreter der Alte-Musik-Szene. Von der Gründung bis zu seiner Auflösung leitete er über Jahrzehnte das Ensemble Musica Antiqua Köln, das mit maßstäblichen Interpretationen der Musik Bachs und seiner Söhne, Telemanns und den Komponisten der Dresdner Hofkapelle aber auch mit Werken italienischer und französischer Komponisten des Barock Interpretations- und Schallplattengeschichte geschrieben hat. Heute ist Goebel als Dirigent und Lehrer (für Barock-Violine) tätig. Nach wie vor basieren seine Interpretationen auf intensiven musikologisch-aufführungspraktischen Forschungen.
Nachweis: © Reinhard Goebel; Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Berliner Philharmoniker.
Website Reinhard Goebel: Hier. Wikipedia Hier.










































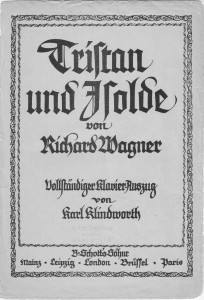
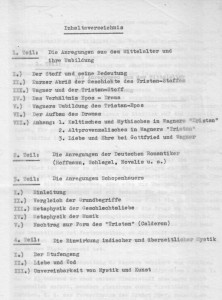
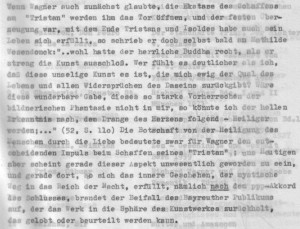


 Fernblicke
Fernblicke Nachbarschaften
Nachbarschaften