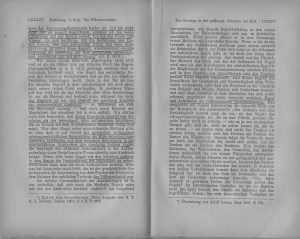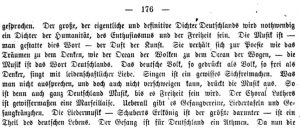Über Gemeinschaft und Gesellschaft
Seine eigenen Grenzen sind stilistischer Art; ich mochte ihn, fand aber, dass er sich mühsam liest, habe nicht einmal die Grunddefinitionen (eben: Gemeinschaft, Gesellschaft) klar in den Kopf bekommen. Als mir sein Büchlein von 1924 (Suhrkamp 2002, von mir gekauft 15.05.2002, flüchtig gelesen, positiv beurteilt, beiseitegelegt, nie wieder vorgenommen) in dieser Woche wiederbegegnete, erinnerte ich nicht, ob ich ihn überhaupt gelesen hatte oder ob ich ihn mit Kassner verwechselte. Oder mit Arnold Gehlen, dessen Gespräch mit Adorno auf youtube ich irgendwann einmal mit Staunen erlebt hatte, vielleicht sogar als Video, jetzt finde ich nur noch den Ton mit Standbildern. Ein Unruhe erfasst mich und drängt zur Klärung (eine Sache des Gewissens, das ja auch bei Plessner ernst genommen wird). Plessner arbeitete sich ab an der Jugendbewegung, dem Phänomen seiner Zeit. Aktuell angesichts der neuen, sehr ernsten Jugendbewegung heute. Man stutzt bei Plessners Sätzen (Seite 35):
Die Jugendbewegung wuchs aus dem Protest gegen die Großstadt und Degenerationsideale, gegen Versnobtheit und Müdigkeitspathos. Und der Wald allein tut es nicht. Wenn sie eine Bewegung der Erneuerung und nicht bloß der Asphaltfeindschaft sein wollte, mußte sie Ideen haben.
Man darf vor Plessners Verteidigung der Technik nicht zurückzucken, als sei es uns plötzlich wieder freigestellt, sondern sie in der aktuellen Gegenwart neu durchdenken.
Was tun? Ich bin in einer neuen Situation: ich lese hier und da im Buch, merke, was ich in etwa damals nicht begriffen habe und ziehe es vor, mit einer Zusammenfassung zu beginnen, die mich bei der Originallektüre nicht mehr abdriften lässt, nämlich mithilfe von Wikipedia. „Grenzen der Gemeinschaft“ hier. Bei dieser Gelegenheit auch ein kurzer Blick auf Kassner (verbunden mit Rilke & Hofmannsthal) sowie Gehlen (konservativer Gegenspieler Adornos).
Was mich damals bei Plessner skeptisch stimmte, war die eigentlich etwas unprofessionelle Begrifflichkeit, zum Beispiel der Einsatz des Wortes Liebe, noch mehr der des Wortes Keuschheit. Auch das Wort Lächerlichkeit macht stutzig, – es klingt, als ob ein philosophischer Laie sich seine eigene Gedankenwelt aufbaut. Es ist aber wohl eher die Sprache der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
(Fortsetzung folgt)
Ich beginne einfach mit einem Abschnitt, der nicht bei der Organisation von Gesellschaft, sondern beim Ich, bei der Individualität, dem Abgegrenzten. Auch hier wieder die Substantiv-Häufung, darunter solche, die beschwerlich wirken, wie „Seinsfülle“, „Urgrundcharakter“ oder „Quellnatur“, und doch verfestigt sich bei insistierender Lektüre der Eindruck, dass hier Wesentliches gesagt wird.
ZITAT
Alle Fehler in der Psychologie, ja, man konnte bis vor fünfzig Jahren fast sagen, der Mangel einer Psychologie, kommen aus der Gebundenheit an die Denk- und Anschauungsformen der dinglichen Welt. Man macht sich nicht von den Vorurteilen frei, die nur klar abgegrenzte Gegenstände und womöglich Atome als echte Wirklichkeiten gelten lassen. Man glaubt an eine Definitheit [?] des psychischen Seins, weil das physische Sein sie besitzt und durch sie ganz eigentlich bestimmt ist. Kommen und gehen, Entstehen und Verschwinden spielt sich in der Natur, nicht nur für den Mathematiker und Experimentator, sondern für die naive Anschauung schon auf dem Hintergrund einer bleibenden Ordnung von Gestalten ab. Wird etwas, so wird es aus Gewordenem, um Gewordenes zu werden. Die Natur ist allemal eindeutig und ihre Geheimnisse, schwer zu entziffern, liegen offen dem Auge da.
Anders die seelische Seinsfülle. Sie erschöpft sich nie im Gewordenen, sondern passiert dieses Stadium der Bestimmtheit und Erschöpftheit nur, um wieder ins Werden, in die lebendige Aktualität überzugehen. Aus einem unauslotbaren Quellgrund, dem Innern, steigen ihre schwer faßbaren Gestalten ind Licht des Bewußtseins, an dem sie wieder wie alle echten Geschöpfe der Nacht zergehen. Die Seele ist allemal zweideutig, ihre Geheimnisse weichen vor jedem Versuch der Enträtselung in andere Tiefen zurück. Jedes Seelische hat also eine Bestimmtheit, die Laune, der Schmerz, die Liebe, das echte Gefühl, die falsche Freude lassen sich fassen, aber erfaßt zerrinnen sie unter dem Griff der Wahrnehmung, wie wir erwachen, wenn wir träumen, daß wir träumen. Aus dem Urgrundcharakter, noch besser sagte man Ungrundcharakter der Psyche, aus ihrer Quellnatur folgt also, daß sie mehr ist als bloßer Strom oder Gerinnen der Strömung zu fester Gestaltung. Sie ist Werden und Sein in einem, weil sie zugleich die Genesis von beiden ist.
Darum erträgt die Seele, die seelenhafte Individualität, keine endgültige Beurteilung, sondern wehrt sich gegen jede Festlegung und Formulierung ihres individuellen Wesens. Darum aber fordert sie ebensosehr das Urteil heraus und bedarf des Gesehenwerdens vom eigenen wie vom fremden Bewußtsein, da ihr keine andere Möglichkeit der Erlösung aus der Zweideutigkeit gegeben ist. Der doppeldeutige Charakter des Psychischen drängt zur Fixierung hin und zugleich von der Fixierung fort. Wir wollen uns sehen und gesehen werden,, und wir wollen ebenso uns verhüllen und ungekannt bleiben, denn hinter jeder Bestimmtheit unseres Seins schlummern die unsagbaren Möglichkeiten des Andersseins. Aus dieser ontologischen Zweideutigkeit resultieren mit eherner Notwendigkeit die beiden Grundkräfte seelischen Lebens: Drang nach Offenbarung, die Geltungsbedürftigkeit, und der Drang nach Verhaltung, die Schamhaftigkeit.
Solche Zweideutigkeit kennt die physische Welt von sich aus nicht. Die Dinge werden von der Erkenntnis nicht „berührt“ und beharren in ihrem ein für allemal gesättigten Sein unabhängig vom Bewußtsein. Darf nun auch das psychische Leben nicht mit seinem Bemerktwerden, mit Bewußtseinsinhalt identifiziert werden, was viele Psychologen wollten, wenn es auch nicht, wie Bergson und Natorp etwa lehrten, eine gänzlich unfaßbare Aktualitäts- und Inensitätsmannigfaltigkeit ist, also Reales und bis zu einem gewissen Grade Geformtes und Anschaulich-Faßliches darstellt, so ist es für den Blick des Bemerktwerdens doch empfänglich und empfindlich wie die fotographische Platte für Licht. Weil eben die Seele nur uin extremen Fällen quasi dinghafte Momente und Seiten („Komplexe“) gewinnt, unter deren objektiver Macht die Person dann leidet, im Normalfall aber in einer eigenartigen aktuellen und zugleich gestalteten Vollzugsform eines ewigen Überganges von Strebung zu Strebung lebt; weil sie in dem Maße, als sie an Eindeutigkeit des Habitus der Gefühle, Willensrichtungen, Affekte, Gedanken und Gesinnungen gewinnt, an Fülle, Spannkraft und Tiefe verliert; weil seelisches Leben, kaum zu seelischem Sein abgesetzt und der Beurteilung klat und deutlich geworden, in den unendlichen Quellgrund seiner selbst wieder zurückgenommen wird, sucht es und flieht es zugleich Bewußtsein und Urteil. In der Definition gewinnt es Gestalt, büßt aber an Möglichkeit ein.
Unter nichts leidet die Seele so wie unter dem Unverstandensein, ihrem doch wesensmäßigen, von ihrer eigenen Natur selbst herausgeforderten Schicksal. Denn dieses Nichtverstehen ist kein einfaches Verfehlen einer Sache, ein Vorbeisehen am Wirklichen, sondern in gewissem Sinne beides zugleich: Verfehlen und Treffen. Ein treffendes Urteil trifft uns, verletzt uns ebensosehr als ein falsches. Getroffen, sehen wir uns, im eigenen oder im fremden Blick, vereinseitigt und festgelegt. Es kommt hier gar nicht darauf an, was man von uns sagt, als daß man von uns sagt. Ob Lob oder Tadel – im tiefsten muß sich die unendliche Seele aufbäumen gegen das verendlichende Bild im Bewußtsein eines URteils. In der Gegenrichtung dazu liegt aber ebensowenig ihr Heil. Denn unter nichts