Zwei Texte für Luxembourg (JR)
* * * (Reklame leider unvermeidlich, weil im Original enthalten)
Der Film der Filme: Bild, Leben, Ton
Dass ich diesen Eindruck festhalten muss, fiel mir wie Schuppen von den Augen: als ich Bachs Mittelsatz des Italienischen Konzertes hörte, diese unglaublich schöne, todtraurige Melodie, und dann den Cis-moll-Satz aus Schuberts Klaviersonate, nein, der Moment, wenn diese ergreifende Musik ausgeblendet wird, – da weiß jemand, von welchen Emotionen wir leben (Mensch und Musik). Eine Frau natürlich… würde ich nicht sagen, aber nun steht es da. Ein ganzer Film zur Verherrlichung eines unerbittlichen Elementes, des Wassers und des Windes.
Ich denke an den Ärger, den einmal ein anderer, visuell sehr schöner Film ausgelöst hat, siehe hier.
Und nun dies! Der folgende Link führt zum Film, die Bilder unten sind nur gescannte Momente des Films!
HIER bzw. https://www.arte.tv/de/videos/069762-000-F/ouessant-wo-der-wind-waltet/
Ein Film von Raphaëlle Aellig Régnier
O-Ton des Wetterfahnen-Machers:
3:45 Der Wind ist auf der Insel ein ständiger Begleiter. Überall dringt er hervor, bis in die Seele der Menschen hinein. Unablässig ist die Insel mit ihm konfrontiert. Im Guten wie im Schlechten. „Der Nordwind geht durch die Türritzen. Das pfeift ganz schön. Es ist wie mit einem Sturm. Am Anfang findet man ihn toll, aber irgendwann soll er einfach aufhören. Es gibt einen Wind, der dich verrückt macht, die Tiere reagieren ganz stark auf ihn, sie flippen richtig aus, rennen, machen Bocksprünge. Wir kennen das ja, deshalb warten wir, bis er vorbei ist, denn mit den Tieren ist dann sowieso nichts anzufangen. Irgendwann wird dieser ständige Wind anstrengend. Teile der hiesigen Kultur sind immer noch lebendig. Dazu gehören auch die Wetterfahnen.“ 4:55
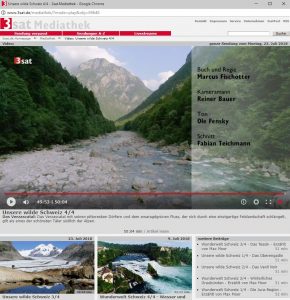 noch abrufbar HIER
noch abrufbar HIERForm-Übersicht nach Ludwig Czaczkes
Fortsetzung der Fugen-Serie von hier (EE2018)
Drei Durchführungen, mit blauen römischen Zahlen gekennzeichnet
Roter durchgezogener Taktstrich bei Beginn einer neuen Durchführung
Themeneinsätze mit rotem Halbkreis, die Töne jeweils mit rotem Punkt
Zur Probe eine Original-Seite Czaczkes-Analyse – sehr zeitraubend, aber in der analytischen Präzision unübertrefflich:
Zum Hören-Üben:
(die Tonqualität ist defizitär, aber die Fuge – ab 4:48 – ist im Zugriff atemberaubend) hier
Auch hier vom Visuellen nicht ablenken lassen: Fuge ab 3:35 / extern hier
(Fortsetzung folgt)
Was Otto Jahn schon 1858 wusste
Vorbemerkung J.R.: Den folgenden Text habe ich im Wesentlichen unverändert aus der ganz unten angegebenen Quelle übernommen. Ich habe lediglich die Hinweise auf die originalen Seitenzahlen in Otto Jahns großer Mozart-Biographie entfernt und die Anmerkungen vom Internet gelöst; man darf sich also durchaus der Mühe unterziehen, jeweils ans Ende des Textes zu scrollen, oder sich von dort aus ganz zur Zeno-Wiedergabe ins Internet begeben. (Anmerkungen, die Rochlitz selbst dem fraglichen Mozartbrief beigefügt hat, erscheinen als A1, A2 etc.) Einige in Klammern gesetzte Seitenzahlen verweisen auf bestimmte Stellen in Otto Jahns großer Biographie und sind bei uns hier ohne Bedeutung. Mir ging es ja im übrigen nur um den bloßen Text, der im vorigen Blog-Artikel angesprochen wurde. Ich habe mir auch erlaubt, einzelne Passagen rot zu kennzeichnen.
 Friedrich Rochlitz (1820) nach Wikipedia
Friedrich Rochlitz (1820) nach Wikipedia
* * *
TEXT OTTO JAHN (1858)
Rochlitz machte im Jahre 1815 (A. M. Z. XII S. 561ff.) ein »Schreiben Mozarts an den Baron von …« bekannt, welchem er folgende Worte vorausschickte:
»Dies Schreiben scheint uns nicht nur sehr anziehend, sondern auch in mehr als einer Hinsicht merkwürdig; ja, wahrhaft lehrreich, und eben für den Verständigen am meisten. Einige Ausdrücke Mozarts werden wohl Manche mit feineren vertauscht, einige derbe Urtheile gemildert wünschen; wir meinen aber: so etwas muß mit diplomatischer Genauigkeit gedruckt werden, oder gar nicht; und das Letzte schien uns Verlust für einen der werthesten Theile unseres Publicums. Wer Anstoß nehmen will, nehme ihn an uns; nur nicht an der kindlich offenen, kindlich zutraulichen Seele Mozarts.«
An wen der Brief gerichtet sei wurde nicht angegeben; später (für Freunde der Tonkunst II S. 282) erwähnt Rochlitz den »vortrefflichen Brief Mozarts an den Baron v. P.« Zum Schluß bemerkt Rochlitz: »Der Brief ist ohne Datum, wahrscheinlich aber im Herbst 1790 von Prag aus geschrieben.« Diese Vermuthung kann nicht richtig sein, weil Mozart im Jahre 1790 nicht in Prag war.
So oft dieser Brief auch in deutscher und in fremder Sprache wieder gedruckt worden ist (1), so scheint doch immer der Abdruck in der A. M. Z. direct oder indirect zu Grunde zu liegen und Niemand das Original wieder gesehen zu haben (2), auch meine Nachforschungen nach demselben sind vergeblich gewesen (3). Dies ist um so mehr zu bedauern, da allein das Autograph über die gewichtigen Bedenken, welche sich gegen dieses Document erheben, endgültig entscheiden kann. Gegenüber den so bestimmten Aeußerungen Rochlitzs, welche auch nicht den Schatten eines Zweifels zuzulassen scheinen, ist es Pflicht die sich bei schärferer Betrachtung aufdrängenden Verstöße gegen sicher überlieferte Facta genauer nachzuweisen.
Zunächst folgt hier das ganze Schreiben mit Rochlitzs Anmerkungen.
»Hier erhalten Sie, lieber, guter Herr Baron, Ihre Partituren zurück; und wenn Sie von mir mehr Fenster (A1) als Noten finden, so werden Sie wohl aus der Folge abnehmen, warum das so gekommen ist. Die Gedanken haben mir in der Symphonie am besten gefallen. Sie würde aber doch die wenigste Wirkung machen, denn es ist zu vielerley drin, und hört sich stückweis an, wie, avec permission, ein Ameisenhaufen sich ansieht; ich meyne: es ist Eppes (A2) der Teufel los darinne. Sie dürfen mir darüber kein Schippchen machen (A3), bester Freund, sonst wollte ich zehntausendmal, daß ichs nicht so ehrlich herausgesagt hätte. Und wundern darf es Sie auch nicht; denn es gehet ungefähr allen so, die nicht schon als Buben vom maestro Knippse oder Donnerwetter geschmeckt haben, und es hernach mit dem Talente und der Lust allein zwingen wollen. Manche machen es halt ordentlich, aber dann sinds andrer Leute Gedanken (sie haben selber keine); Andere, die eigene haben, können sie nicht Herr werden. So geht es Ihnen. Nur um der heiligen Cäcilia willen, nicht böse, daß ich so herausplatze! Aber das Lied hat ein schönes Cantabile, und soll Ihnen das die liebe Fränzl recht oft vorsingen, was ich schon hören mögte, aber auch sehen. Der Menuetto im Quatuor nimmt sich auch sein aus, besonders von da, wo ich das Schwänzlein dazu gemalen. Coda wird aber mehr klappen als klingen. Sapienti sat, und auch dem nicht – Sapienti, da meyne ich mich, der ich über solche Dinge nicht wohl schreiben kann. Unser einer macht’s lieber. Ihren Brief hab ich vor Freude vielmal geküßt.«
»Ihren Brief habe ich vor Freuden vielmal geküßt. Nur hätten Sie mich nicht so sehr loben sollen. Hören kann ich so was allenfalls, wo man’s gewohnt wird; aber nicht gut lesen. Ihr habt mich zu lieb, ihr guten Menschen: ich bin das nicht werth und meine Sachen auch nicht. Und was soll ich denn sagen von Ihrem Präsent mein allerbester Herr Baron? Das kam wie ein Stern in dunkler Nacht, oder wie eine Blume im Winter, oder wie ein Glas Madeira bey verdorbenem Magen, oder – oder – Sie werden das schon selber ausfüllen. Gott weiß, wie ich mich manchmal placken und schinden muß, um das arme Leben zu gewinnen, und Männel (A4) will doch auch was haben. Wer Ihnen gesagt hat, daß ich faul würde, dem (ich bitte Sie herzlich, und ein Baron kann das schon thun) dem versetzen Sie aus Liebe ein paar tüchtige Watschen (A5). Ich wollte ja immer, immerfort arbeiten, dürfte ich nur immer solche Musik machen, wie ich will und kann, und wie ich mir selbst was daraus mache. So habe ich vor drey Wochen eine Symphonie fertig gemacht (A6), und mit der Morgenpost schreibe ich schon wieder an Hofmeister, und biete ihm drey Klavierquatuor (A7) an, wenn er Geld hat. O Gott wär ich ein großer Herr, so spräch ich: Mozart, schreibe du mir, aber was du willst und so gut du kannst; eher kriegst du keinen Kreuzer von mir, bis du was fertig hast, hernach aber kaufe ich dir jedes Manuskript ab, und sollst nicht damit umgehen wie ein Gratschelweib (A8). O Gott, wie mich das alles zwischendurch traurig macht, und dann wieder wild und grimmig, wo dann freylich manches geschieht, was nicht geschehen sollte. Sehen Sie, guter lieber Freund und Gönner, so ist es, und nicht wie Ihnen dumme oder böse Lumpen mögen gesagt haben.«
»Doch dieses a casa del diavolo, und nun komme ich auf den allerschwersten Punkt in Ihrem Brief, und den ich lieber gar fallen ließ, weil mir die Feder für so was nicht zu Willen ist. Aber ich will es doch versuchen, und sollten Sie nur was zu lachen darin finden. Wie nämlich meine Art ist beym Schreiben und Ausarbeiten von großen und derben Sachen nämlich? – Ich kann darüber wahrlich nicht mehr sagen als das; denn ich weiß selbst nicht mehr, und kann auf weiter nichts kommen. Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, oder nach guter Mahlzeit beym Spatzieren, und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Kopf und summe sie wol auch vor mich hin, wie mir Andere wenigstens gesagt haben. Halt‘ ich das nun fest, so kömmt mir bald Eins nach dem Andern bey, wozu so ein Brocken zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen, nach Contrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente etc. etc. etc. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da wird es immer größer; und ich breite es immer weiter und heller aus; und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich’s hernach mit Einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen, im Geist übersehe, und es auch gar nicht nacheinander wie es hernach kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das ist nun ein Schmauß! Alles das Finden und Machen geht in mir nur wie in einem schönstarken Traume vor: aber das ueberhören, so alles zusammen, ist doch das Beste. Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser Herr Gott geschenkt hat. Wenn ich nun hernach einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hinein gesammelt ist. Darum kömmt es hernach auch ziemlich schnell aufs Papier; denn es ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig und wird auch selten viel anders, als es vorher im Kopf gewesen ist. Darum kann ich mich auch beym Schreiben stören lassen; und mag um mich herum mancherley vorgehen: ich schreibe doch; kann auch dabey plaudern, nämlich von Hühnern und Gänsen, oder von Gretel und Bärbel u. dgl. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier annehmen, daß sie mozartisch sind, und nicht in der Manier irgend eines Andern: das wird halt eben so zugehen, wie, daß meine Nase eben so groß und herausgebogen, daß sie mozartisch und nicht wie bey andern Leuten geworden ist! Denn ich lege es nicht auf Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal näher zu beschreiben; es ist ja aber wol blos natürlich, daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch verschieden von einander aussehen, wie von aussen, so von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das Eine so wenig, als das Andere gegeben habe.«
»Damit lassen Sie mich aus (A9) für immer und ewig, bester Freund, und glauben Sie ja nicht, daß ich aus andern ursachen abbreche, als weil ich nichts weiter weiß. Sie, ein Gelehrter, bilden sich nicht ein, wie sauer mir schon das geworden ist. Andern Leuten würde ich gar nicht geantwortet haben, sondern gedacht: mutschi, buochi, quittle? Etsche malappe Mumming!« (A10)
»In Dresden ist es mir nicht besonders gegangen. Sie glauben da, sie hätten noch jetzt alles Gute, weil sie vor Zeiten manches Gute gehabt haben (A11). Ein paar gute Leutchen abgerechnet, wußte man von mir kaum was, außer daß ich zu Paris und London in der Kinderkappe Concert gespielt habe. Die Oper hab ich nicht gehört, da der Hof im Sommer auf dem Lande ist. In der Kirche ließ mich Naumann eine seiner Messen hören; sie war schön, rein geführt und brav, aber wie Ihr E. spricht ›ä Bißle kühlig (A12) etwa wie Hasse, aber ohne Hassens Feuer und mit neuerer Cantilena. Ich habe den Herrn viel vorgespielt, aber warm konnte ich ihnen nicht machen, und außer Wischi Wäschi (A13) haben sie mir kein Wort gesagt. Sie baten mich auch Orgel zu spielen. Es sind über die Maßen herrliche Instrumente da. Ich sagte, wie es wahr ist: ich sey auf der Orgel wenig geübt; ging aber doch mit ihnen zur Kirche. Da zeigte sichs, daß sie einen andern fremden Künstler in Petto hatten, dessen Instrument eben die Orgel war, und der mich tod spielen sollte. Ich kannte ihn nicht gleich, und er spielte sehr gut, aber ohne viel Originales und Phantasie. Da legte ichs auf diese an und nahm mich tüchtig zusammen. Hernach beschloß ich mit einer Doppelfuge, ganz streng, und langsam gespielt, damit ich auskam und sie mir auch genau durch alle Stimmen folgen konnten. Da war’s aus, und niemand wollte mehr dran. Der Häßler (A14) aber (das war der Fremde: er hat gute Sachen in des Hamburger Bach Manier geschrieben) der war der Treuherzigste von Allen, obgleich ich’s eigentlich ihm versetzt hatte. Er sprang vor Freuden herum, und paukte, und wollte mich immer küssen. Dann ließ er sichs bey mir im Gasthaus wohl seyn. Die Andern deprecirten aber, als ich sie freundlich bat, worauf der muntere Häßler nichts sagte, als: Tausendsapperment!«
»Hier, bester Freund und Gönner, ist das Blatt bald voll, die Flasche Ihres Weins, die heute reichen muß, bald leer; ich aber habe seit dem Anhaltungsbrief um meine Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen ungeheuer langen Brief geschrieben. Nichts vor ungut! Ich muß im Reden und Schreiben bleiben, wie ich bin, oder das Maul zuhalten und die Feder wegwerfen. Mein letztes Wort soll seyn: mein allerbester Freund, behalten Sie mich lieb. O Gott, könnte ich Ihnen doch nur einmal eine Freude machen, wie Sie mir gemacht. Nun, ich klinge mit mir selbst an: Vivat mein guter treuer …! Amen.«
Mit Recht hat dieser Brief viel Aufsehen und Interesse erregt (4); es mag manchem leid thun daß die Kritik daran zu rütteln findet, allein ihre Bedenken dürfen darum nicht unerledigt bleiben.
Die Zeit, wann der Brief geschrieben sein muß, läßt sich durch die Erwähnung des Dresdner Aufenthalts und des Wettkampfs mit Häßler bestimmen. Dieser fand am 15 April 1789 statt, wie wir aus Mozarts Brief an seine Frau wissen (S. 479); da der Brief des Aufenthalts in Dresden als einer Neuigkeit gedenkt, die den Freund zunächst interessirt, kann er nicht lange nachher geschrieben sein; man sollte denken noch während der Reise, denn des Aufenthalts in Leipzig und Berlin zu gedenken wäre dem theilnehmenden Freund gegenüber nicht weniger Veranlassung gewesen. Indessen mag er in Leipzig, Berlin, Prag oder erst nach der Rückkehr in Wien geschrieben sein, Juni 1789 bleibt wohl der späteste Termin. Jede Annahme aber verwickelt, wie wir sehen werden, in unauflösliche Schwierigkeiten. Was den Abschnitt über Dresden anlangt, so ist Mozarts Bericht über jenen Tag an seine Frau so genau, daß wir dadurch eine genügende Controle für den vorliegenden haben: er stimmt aber mit jenem gewiß authentischen in den wesentlichen Punkten nicht überein.
»Die Oper hab ich nicht gehört«, heißt es, »da der Hof im Sommer auf dem Lande ist.« Wir wissen aber nicht nur daß Mozart schon im April in Dresden war, sondern wir erfahren von ihm ausdrücklich, daß der Hof zugegen war, daß er bei Hof spielte, daß Oper war und daß er sie besuchte. Ferner, wie ganz anders beschreibt Mozart die Begegnung mit Häßler seiner Frau als sie hier dargestellt ist! Schon der äußere umstand stimmt nicht, daß Mozart zuerst spielte und Häßler dann erst auf vieles Zureden Lichnowskys sich auch hören ließ, während es mit offenbarer Absichtlichkeit dem Baron umgekehrt dargestellt wird. Die Hauptpointe dieser Erzählung, daß Häßler im Gegensatz der kühlen Dresdner die Leistungen Mozarts so freudig anerkannte und die beiden ehrlichen Künstlerseelen sich verstanden, verschweigt der Brief an die Frau nicht allein, sondern sie widerspricht ihm. Man sieht daraus, daß Mozart Häßler vorher nicht kannte – schwerlich wußte er daß »er gute Sachen in des Hamburger Bach Manier geschrieben hatte« –, sondern nach dem urtheilt, was dieser ihm vorspielte; dies geschieht streng und abweisend ohne daß von einem gegenseitigen Entgegenkommen die Rede wäre. Daß er darauf Häßler mit der übrigen Gesellschaft zu sich ins Gasthaus einlud und dieser, nachdem die andern deprecirt hatten, es sich allein bei ihm wohl sein ließ – das kann wohl nicht richtig sein. Denn er schreibt ja seiner Frau, daß sie aus der Kirche zum russischen Gesandten, darauf in die Oper gingen und daß dann noch Neumanns mit der Duschek bei ihm waren. ueberhaupt die Leute, denen er mit seinem Spiel nicht warm machen konnte, die ihm nur Wischi Wäschi sagten und endlich seine Gäste zu sein refusirten, wer waren sie denn? Wir sehen es aus dem Brief an die Frau: es waren Neumanns, »die herrlichen Leute«, seine alte Freundin Duschek, sein Gönner und Schüler Lichnowsky, der russische Gesandte, der ihm alle Ehre erwies, und Naumann, der ihm allerdings nicht grade gewogen war – also kein Publicum, wie jene Darstellung es voraussetzt.
Es ist aus dem Bemerkten klar daß der Bericht über den Aufenthalt in Dresden und das Zusammentreffen mit Häßler in dem Brief an Baron P. so nicht von Mozart herrühren kann. Offenbar ist er der ersonnenen Pointe zu Liebe aus halbwahren und unklaren Reminiscenzen zurecht gemacht, und gleicht darin aufs Haar den meisten Anekdoten und Charakterzügen, welche Rochlitz erzählt, denen gewiß immer etwas Wahres zu Grunde liegt, das aber durch ausgedachte psychologische Motivirung und auf ungenauen Erinnerungen beruhende Ausschmückung meistens zu einem unhistorischen Phantasiebild entstellt ist. Jene Begegnung mit Häßler machte ihrer Zeit Aufsehen und gewiß sprach Mozart in Leipzig davon, Rochlitz kannte sie aber auch aus Mozarts Brief an seine Frau. Diese theilte ihm nämlich alle Briefe ihres Mannes nach seinem Tode zum Behufe einer Biographie mit – wie aus ihrer Correspondenz mit Härtel sich ergiebt –; Rochlitz aber scheint dieselben nach flüchtiger Lecture zurückgeschickt zu haben und berichtete später nach unzuverlässigen Reminiscenzen.
Es finden sich aber der historischen Unrichtigkeiten noch mehr. um den Vorwurf der Trägheit abzuwehren heißt es: »So habe ich vor drei Wochen eine Symphonie fertig gemacht.« Allein die letzte Symphonie, welche Mozart geschrieben hat, die in C-dur mit der Fuge ist seinem eigenen Verzeichniß zufolge am 10 August 1788 componirt –; die in G-moll, an welche Rochlitz denkt, schon am 25 Juli 1788 –, Mozart konnte sich also in einem frühestens im April 1789 geschriebenen Brief so nicht ausdrücken. Oder sollte Jemand annehmen wollen, Mozart habe auf jener Reise eine Symphonie componirt, die er vergessen habe in sein Verzeichniß einzutragen, während er die Variationen über einen Menuett von Duport und die kleine Gique für Klavier richtig eingetragen hat, und die dann völlig verschollen wäre? Unglaublich!
Ebenso unerklärlich ist was unmittelbar darauf folgt: »Mit der Morgenpost schreibe ich schon wieder an Hoffmeister und biete ihm 3 Klavierquatuor an, wenn er Geld hat.« Rochlitz bemerkt dazu, nur das erste herrliche in G-moll sei bald darauf erschienen. Sonderbar; denn das konnte Rochlitz wissen, daß das Klavierquartett in G-moll im Juli 1785, das zweite inEs-dur im Juni 1786 componirt und beyde um dieselbe Zeit in Hoffmeisters Verlag erschienen waren. Freilich konnten diese dann in einem 1789 geschriebenen Briefe nicht als eben vollendete und Hoffmeister zum Druck erst anzubietende angeführt sein. Und daß Mozart später noch drey Klavierquartetts geschrieben habe, die wiederum nicht in seinem Verzeichniß aufgeführt und spurlos verschollen wären, das ist ganz unmöglich. Auch sonst ist noch zweierlei dabei auffällig. Erstens daß Mozart wegen der Quartetts an Hoffmeister schreiben will; er war also nicht in Wien, wo dieser damals wohnhaft war, sondern noch auf der Reise. Geschrieben waren die drei Quartetts unterwegs doch sicher nicht, sondern sie mußten vorher fertig gewesen sein, und da ist es gewiß auffallend daß Mozart, wenn er vor der Reise dies Geschäft nicht mehr abmachen konnte, nicht die kurze Zeit wartete bis er wieder in Wien war; daß ihn augenblickliche Verlegenheit nicht dazu veranlaßte kann man nachweisen, wenn auch diese Reise ihm keinen großen Vortheil brachte. Sodann ist der Zusatz »wenn er Geld hat« bedenklich. Denn Hoffmeister hatte Mozart jene Quartetts honorirt, war ihm auch schon in Verlegenheiten beigesprungen (S. 222) und im Jahre 1790 wiederum bereit ihm durch einen Vorschuß auf später zu liefernde Arbeiten aus der Noth zu helfen (S. 435); es ist daher nicht wahrscheinlich daß Mozart sich über ihn in dieser Art ausgedrückt habe. Kurz man sieht, daß jene Tradition von dem Verhältniß Hoffmeisters zu Mozarts Klavierquartetts (S. 222) hier zu einem bestimmten Zweck verwandt worden ist.
Schließlich wird noch ein geringfügiger Umstand zum Verräther. »Ich habe« heißt es »seit dem Anhaltungsbrief um meine Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen ungeheuer langen Brief geschrieben.« Wir wissen aber daß Mozart um seine Frau weder mündlich noch schriftlich bei seinem Schwiegerpapa anhalten konnte, weil dieser todt war, als er sich mit Constanze verlobte. Aber dieser Schwiegerpapa spielt seine Rolle in dem Roman von Mozarts Verheirathung, den sich Rochlitz, wie wir sahen (S. 162ff.), ausgedacht hatte; und daher taucht er nun auch hier wieder auf.
Man steht (sieht ? JR) also daß sämmtliche Facta aus Mozarts Leben, welche in diesem Briefe berührt werden, durch den Widerspruch mit der sicher beglaubigten Ueberlieferung sich als unwahr oder entstellt ergeben, mithin von Mozart so nicht berichtet werden konnten. Dieser Umstand muß allerdings auch gegen den übrigen Inhalt des Briefes gewichtige Bedenken erregen, die dadurch noch verstärkt werden, daß derselbe in Stil und Ausdrucksweise offenbar nicht rein Mozartsch, sondern jedenfalls überarbeitet ist. Indessen möchte ich nicht behaupten daß der ganze Brief untergeschoben sei; wahrscheinlich war die Grundlage eines Mozartschen Briefes vorhanden, der etwas überarbeitet und durch Hinzufügen charakteristischer Züge, die für sicher beglaubigt galten, zu einem sprechenden Zeugniß ausgeprägt wurde. Bestimmt zu scheiden, was echt und ursprünglich, was geändert und zugesetzt sei, wird nicht möglich sein; unleugbar ist, daß der Brief, so wie er bekannt gemacht ist, nicht von Mozart geschrieben sein kann.
(1) Um nur einiges anzuführen, so ist dieser Brief wiederum abgedruckt in der allg. Wiener Theaterzeitung 1824 N. 138, und im Jahr 1852 in demselben Journal, im Salzburger Correspondenten, in der Brünner Zeitung. In englischer Uebersetzung erschien derselbe im Harmonicon, Nov. 1825; in französischer im Journal général d’annonces d’obiets d’arts et de librairie, Juni 1826 N. 47, 49; worauf er in deutscher Rückübersetzung in einem deutschen Journal zu lesen war (vgl. Cäcilia V S. 224ff.).
(2) Daß dem Abdruck in der rheinischen Morgenzeitung Charis (1823 N. 59), nach welchem der in der Muse (1856 N. 61) veranstaltet ist, das Original zu Grunde liege ist durchaus unglaubhaft.
(3) Holmes berichtet zwar (p. 320) das Original des Briefes sei im Besitze des Prof. Moscheles, allein leider ist dies ein Irrthum, wie ich von Prof. Moscheles selbst erfahren habe.
(A1)»Kreuzweis ausgestrichene Stellen.« R.
(A2) »Ausdruck gemeiner Juden statt Etwas, in der Bedeutung von ein wenig, einigermaßen.« R.
(A3) »Wärterinnen bezeichnen so die saure Miene kleiner Kinder, die zum Weinen einzuleiten pflegt.« R.
(A4) »Scherzhafte Abkürzung von Konstanze, Mozarts Frau.« R. [Männel ist wohl Druckfehler für Stanzerl, Stännerl od. ähnl.]
(A5) »Ohrfeigen.« R.
(A6) »Es war, besinne ich mich recht, die, noch von Keinem übertroffene, aus G-moll.« R.
(A7) »Nur das erste von diesen ist bald darauf erschienen; es ist das herrliche, ebenfalls aus G-moll.« R.
(A8) »So lesen wir wenigstens das uns unbekannte Wort. Vorher fehlen einige Worte. Das Blatt ist eben da vom Siegel verletzt.« R.
(A9) »Entlassen Sie mich.« R.
(A10) »Eine Posse selbstgemachter, nichts bedeutender Wörter, die aber, scheint es, im Klange eine Art Antwort ausdrücken sollen; und, die Situation vorausgesetzt, wol auch gewissermaßen ausdrücken.« R.
(A11) »In Hinsicht auf Musik nämlich.« R.
(A12) »Ein wenig kühl.« R.
(A13) »Allgemeine Lobsprüche u. dgl.« R.
(A14) »Damals noch Musikdirector in Erfurt, seitdem in Moskau, bekanntlich vormals ein sehr ausgezeichneter Orgelspieler.« R.
(4) Zelter schrieb an Goethe (Briefw. III S. 470f.): »Du hast wohl in der Wiener Theaterzeitung einen Brief von Mozart gefunden, an einen lieben, guten Baron der Compositionen übersendet, Rath und Lehre sucht; eigentlich aber in alter Kürze das Geheimniß lernen will: wie man’s doch macht, so recht was Schönes in die Welt zu setzen? Der Brief ist ein goldner Brief und versichert mir meine alte Lehrart, daß man mit den jungen Kunstweisen gar nicht zu viele Umstände zu machen habe. Wer was Rechts wissen will wirds erfahren, und wer gewinnen will wird setzen. Mehr weiß ich auch nicht und lerne fleißig dazu.« Und Goethe sagte zu Eckermann (Gespr. I S. 261): »Ich habe dieser Tage einen Brief von Mozart gelesen, wo er einem Baron, der ihm Compositionen gesendet hatte, etwa Folgendes schreibt: Euch Dilettanten muß man schelten, denn es finden bei Euch gewöhnlich zwei Dinge Statt: entweder Ihr habt keine eigene Gedanken und da nehmt Ihr fremde; oder wenn Ihr eigene Gedanken habt, so wißt Ihr nicht damit umzugehen. – Ist das nicht himmlisch? und gilt dieses große Wort, was Mozart von der Musik sagt, nicht von allen übrigen Künsten?«
Quelle Otto Jahn: W.A. Mozart, Band 3, Leipzig, Breitkopf und Härtel 1858, Seite 1
Im Internet: HIER bzw. unter http://www.zeno.org/nid/2000775289X
Zu Otto Jahn siehe Wiki HIER. Zufall: heute – 16. Juni – ist sein 205. Geburtstag
Übrigens: eigentlich lässt Goethes von Jahn zitierte Äußerung gar nicht erkennen, dass er von dem inhaltlichen Teil redet, um dessentwillen der Brief Furore gemacht hat. (JR)
* * *
Ulrich Konrad über Friedrich Rochlitz & Mozart:
Empfehlenswert auch der MGG-Artikel über Friedrich Rochlitz, – wenn auch in Zeiten der „Alternative Facts“, die Trump eingeführt hat, kaum noch relativistisch lesbar; ich glaube nicht, dass es dieser Mittel der Popularisierung Mozarts und Beethovens um 1810 bedurfte:
Mit mehreren in der AmZ publizierten Serien von Mozart-Anekdoten trug Rochlitz wesentlich zur Popularisierung Mozarts bei und prägte zugleich für lange Zeit das Mozart-Bild. Daß die Anekdoten zum Teil seine eigenen Erfindungen waren (was im Grunde jedoch zum literarischen Genre gehört) und daß Rochlitz einen fiktiven Brief Mozarts als authentisch publizierte, führte schon zu seinen Lebzeiten zu Kritik. Dabei wurde übersehen, daß solche Publikationen nicht einem wissenschaftlichen Interesse dienten, sondern von Rochlitz primär dazu eingesetzt wurden, Mozart in den Rang eines Klassikers der Tonkunst zu heben. Rochlitz ist ebenfalls maßgeblich daran beteiligt gewesen, daß Beethoven in den neuen Kanon der musikalischen Klassiker aufgenommen wurde. Dazu setzte er seinerseits publizistische Mittel ein und nutzte andererseits seinen Einfluß auf die Programmgestaltung des Leipziger Gewandhauses.
Quelle MGG Personenteil Band 14 Bärenreiter Kassel etc 2005 Artikel Friedrich Rochlitz Sp. 237f Autor: Lothar Schmidt.
Noch einmal der Mozart-Forscher Ulrich Konrad mit einigen Sätzen aus seinem im wahrsten Sinne des Wortes grundlegenden Mozart-Artikel im MGG-Lexikon:
Die Frage nach Mozarts Schaffensweise ist seit dem frühen 19. Jahrhundert in nahezu ungebrochener Linie bis in die jüngste Vergangenheit hinein mit Rekurs auf wenige isolierte Aussagen des Komponisten, postume anekdotische berichte und fragwürdige Dokumente begegnet worden (geradezu verhängnisvoll: das dubiose, in der publizierten Form jedenfalls unechte „Schreiben Mozarts an den Baron von…„; BriefeGA IV, S.527-531). Danach schien festzustehen, daß Mozart (1.) allein im Kopf, ohne Zuhilfenahme eines Instrumentes oder schriftlicher Notizen, komponiert habe, daß (2.) auf diesem Weg ein Werk in der Vorstellung des Komponisten schnell, in einem quasi vegetativen Vorgang, zu seiner vollendeten Gestalt geformt und als solche unverlierbar im Gedächtnis gespeichert worden sei, und daß (3.) sich die Niederschrift der Kompositionen auf Notenpapier in einem nur mehr mechanischen Akt, von äußeren Umständen unbeeinflußbar, vollzogen habe. Diese Anschauung, befördert und befestigt vom zunehmend trivialisierten Genie-Kult und der historiographischen Konstellation, die dem beethovenschen Künstlertyp des um das Werk ringenden „génie de la raison“ die Gestalt eines seraphischen „génie de la nature“ (Georges Bizet, 31. Dez. 1858; Lettres de Georges Bizet, P.o.J. [1908], S.118) entgegengestellt hatte, dieser Anschauung mußten forschende Bemühungen um Gewohnheiten und Ordnungen in der ‚Werkstatt‘ des Komponisten abwegig erscheinen. Es ist aber bei rationaler Betrachtung des Sachverhalts schlechterdings unvorstellbar, daß Mozart seine kompositorische Tätigkeit nicht als Arbeit in Bewußtheit selbst bestimmt habe.
Quelle MGG Musik in Geschichte und Gegenwart (neu) Personenteil Band 12 MOZART Sp. 723 / Autor: Ulrich Konrad / Bärenreiter Kassel Basel London etc. 2004
Wie Bach einmal zu sehr lachte und Mozart gar nichts gesagt hat
Ein Rezensent, der über das Bach-Fest Leipzig schreiben muss, das er als Wettbewerb missversteht, braucht einen Prügelknaben, schon um die Musterschüler besser ins Licht zu setzen. Und sich selbst natürlich. Sein Prügelknabe gehört allerdings zu den großartigsten Bach-Interpreten unserer Zeit, aber was heißt das schon, wenn man glaubt, zu den mächtigsten Schreiberlingen einer sehr sehr großen Zeitung zu gehören?
Es dürfte nur kein fachlicher Fehler passieren, sonst ist die Rolle als redlicher Rezensent, der sich lediglich um die branchenüblichen Übertreibungen bemüht, schnell ausgespielt. Er darf zum Beispiel Triolen nicht mit Sechzehntelbewegungen verwechseln, sonst vermuten die kundigsten Leser/innen, – sagen wir aus dem Umkreis des Münchener Bach-Chores -, dass er nicht einmal Noten lesen kann. Aber es ist leider nicht nur dies, sondern die offenkundig kompensatorische Angebersprache: er ist von manchen Darbietungen dermaßen angewidert, dass er auf der Unterlippe kaut und nach dem Notausgang schielt. Man kann also davon ausgehen, dass dort in Wahrheit brillant gesungen wurde, was dem ad hoc zugeschalteten bösen Blick aber nicht genügen kann: wenn im Eingangschor „Unser Mund sei voll Lachens“ – so wörtlich: – die Zwerchfälle der Sänger in munteren Sechzehntelbewegungen hüpfen und auf dem Vokal „a“ eine Maulsperre einsetzt, der Chor die Zähne bleckt und ins Publikum grinst. Dann sitzt man vor dieser Lachtherapiegruppe, kaut auf der Unterlippe etc etc … kurz: man leidet Qualen unter der singenden Soldateska da vorne…
Ja, hätte er doch vom Notausgang Gebrauch gemacht; eine solche Kritik kann man schreiben, ohne anwesend zu sein. Und für diese Wortfindungen bedarf es keiner konkreten Beobachtung, sondern nur der branchenüblichen Selbstverliebtheit. Noch zwei, drei Beispiele: „Koopman ist ein Energiebündel, das seinen Tatendrang letztlich vollständig in Klang-Zivilisation umsetzt.“ Meine Güte, war das Wort Klangkultur dem Kritiker schon zu gewöhnlich? Was zwinkert er uns zu? Er will damit sagen, dass er vielleicht noch etwas anderes meint als er sagen kann. Den Unterschied zwischen Kultur und Zivilisation hat man im Deutschen erfunden, um letztere zu kritisieren. Nichts Genaues weiß er nicht, aber ein bisschen Hintergründigkeit kann nicht schaden. „Die weltweit renommiertesten Bach-Dirigenten mit ihren Ensembles (…) sind geladen“, – nicht unbedingt zur höheren Ehre Bachs, in jedem Fall aber „auch in einen Wettstreit um die Gunst des Publikums, vielleicht auch um den Glauben an sich selbst als führende Bach-Apologeten.“ Wie bitte? Den Glauben an sich selbst? Und was sind sie? Was ist denn eine Apologie, was ein Apologet? Und wer steht unter Anklage? Vielleicht spricht der Kritiker unversehens von sich selbst. Da draußen aber herrscht blinde Magie: „Hier kommt der Dirigent ins Spiel, der in vielen Proben und schließlich in der Aufführung selbst jene Magie erzeugen muss, die aus einer anständigen Vorführung eines genialischen Werkes einen Geniestreich herbeizaubert.“
Anständigerweise hieße es: aus der anständigen Vorführung eines genialischen Werkes – worauf dann vielleicht ein anderes Wort für „Geniestreich“ folgen sollte, es sei denn, wir lesen immer noch Bücher wie „Magie des Taktstocks“, die ein kongenialer Worthülsenverbraucher mit der Münchner Muttermilch aufgesogen haben könnte.
Quelle: Süddeutsche Zeitung 13.06.2018 Seite 10 Vom Größten nur das Beste Der neue Intendant des Leipziger Bachfestes überrascht mit einem glamourös besetzten Kantaten-Ring, der in 18 Stunden durch den Kosmos des Thomaskantors führt / Von Helmut Mauró /
Siehe auch HIER.
Da wir uns mal wieder mit sogenannten Kleinigkeiten aufhalten, bitte ich das wirklich unschätzbare, riesige Musiklexikon MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart, neue Ausgabe) aufzuschlagen, Personenteil Band 8 Gri-Hil, Artikel Heidegger, Autor. Emmerich Hörmann. Was fällt Ihnen auf? Die einzige wichtige Aussage, die der Philosoph zur Musik gemacht hat, geht von Mozart aus. Aber nicht von der Musik, sondern (vom Prestige des Namens… neinnein) von einem Brief, nein, von einem Satz des Briefes, einem Satzteil, einem Wort. Eines Briefes, der den Nachteil hat, dass er mit höchster Wahrscheinlichkeit Mozart nur untergeschoben wurde. Hier ein Detail des MGG-Artikels:
Zum „Überhören“ siehe auch über Furtwänglers „Fernhören“ hier.
Mir ist der Mozart-Brief damals, als ich von dem Buch des Pianisten und Pädagogen Heinrich Neuhaus so begeistert war (Februar 1981), vielleicht nicht ganz unbekannt gewesen, aber als er mir dann im „Hölderlin“ von Bertaux wiederbegegnet ist, hatte ich wohl noch keine grundsätzlichen Zweifel an der Authentizität, jedenfalls sehe ich im Neuhaus-Text keine Spur eines Fragezeichens. Heute würde ich sagen: der mystizistische Inhalt widerspricht dem pragmatischen Charakter Mozarts derart grundsätzlich, – das ist eine glatte Fälschung, und zwar aus einer Zeit, in der sich romantische Strömungen mit theologischen Erinnerungen an die Gnosis verbanden. Mit Mozarts Zauberflöte und den Ideen der Freimaurerei hatte es wohl kaum zu tun. In den 90er Jahren lernte ich den amerikanischen Musikphilosophen Peter Kivy kennen, nicht ohne seinen Ideen kritisch zu begegnen, aber in diesem Punkt hatte er zweifellos recht. In seinem Buch „The Fine Art of Repetition. Essays in the Philosophy of Music“ (Cambridge University Press 1993) studierte ich mit Vergnügen den Text „Mozart and monotheism: An essay in spurious aesthetics“:
In einer späteren Fußnote weist Kivy darauf hin, dass schon 1858 Otto Jahn in seiner großen Mozart-Biographie darauf hingewiesen habe, dass der besagte Mozart-Brief unmöglich echt sein könne. Und über J.F.Rochlitz, der den Brief 1815 veröffentlicht hat, habe der Musikwissenschaftler Maynard Solomon jüngst festgestellt: „There is an extensive pattern of fabrication in Rochlitz’s contributions to the Mozart literature that would lead a prudent observer to reject the whole.“ Ich werde den Bericht von Otto Jahn in einem späteren Blog-Artikel vollständig wiedergeben, da er offenbar nicht so bekannt geworden ist wie der vielzitierte, dem Komponisten schlicht untergeschobene Brief. Und es ist kein Zufall, dass im Heideggerschen Umfeld niemand auf die Idee gekommen ist, ihn in Frage zu stellen; er ist so nützlich für eine mystizistische Weltanschauung, und sei es durch den Gebrauch des einen Wortes „Überhören“: ein Zustand, in dem es ihm (Mozart) scheine, er höre die ganze Sinfonie vom Anfang bis zum Ende auf einmal, gleichzeitig, in einem Augenblick! (Sie liegt vor ihm wie ein Apfel auf einer Handfläche.) So formulierte es Heinrich Neuhaus, und er ist überzeugt, „daß ihr eine Wahrheit zugrundeliegt, die Mozartsche Wahrheit, die dem Mozartbild, das sich auf Grund seines Schaffens und seines Lebens bei uns gebildet hat, nicht widerspricht, sondern es bestätigt und in höchstem Grade mit ihm übereinstimmt. Für jeden, der sich ein wenig in der Psychologie des Schaffens auskennt, ist das, wovon Mozart hier spricht, ein Beispiel der höchsten Fähigkeit des menschlichen Geistes, der Fähigkeit, von der in Worten zu sprechen unmöglich ist. Man kann sich nur mit gesenktem Haupt von ihr bezaubern lassen und sie anbeten.“ (Heinrich Neuhaus a.a. O. Seite 40)
Ich glaube, die Sätze haben mich einmal sehr beeindruckt, und das Neuhaus-Buch ist immer noch eine große Inspiration für mich. Aber von diesen Ideen, über die sich Zelter und Goethe positiv äußerten, muss man sich – Mozart zuliebe – ganz einfach verabschieden, nach dem Motto: auch große Geister irren! Die Wahrheit jedenfalls ist, dass Mozart nichts dergleichen gesagt oder in Worten niedergeschrieben hat. Und gerade durch das Anbeten kommt man in diesem Fall zu falschen Folgerungen, die – wenn wir Kivy glauben können – vom Gottesbild jener Zeit 1:1 auf den Künstlergott übertragen wurden.
Quelle Peter Kivy: The Fine Art of Repetition. Essays in the Philosophy of Music / Cambridge University Press 1993 / darin Chapter X (Seite 189-199) „Mozart and monotheism: An essay in spurious aesthetics“.
Streichquartett-Konzert
11.06.2018 Montag 20:00 Uhr
Kölner Philharmonie
Tetzlaff Quartett
Christian Tetzlaff Violine
Elisabeth Kufferath Violine
Hanna Weinmeister Viola
Tanja Tetzlaff Violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart
Streichquartett Es-Dur KV 428 (421b) (1783)
„4. Haydn-Quartett“
Jörg Widmann
Choralquartett (2003, rev. 2006)
(2. Streichquartett)
Pause
Ludwig van Beethoven
Streichquartett B-Dur op. 130 mit dem Streichquartettsatz op. 133 „Große Fuge“ (1825)
Pause gegen 20:45 | Ende gegen 22:00
Eine Melodie und eine Oper
Aber ich komme nur von dieser auf jene. Ich würde nie sagen: Mozarts Figaro ist die tollste Oper, die ich kenne. Was ich als erstes erwähnen würde, wäre vielleicht: die Handlung macht mich verrückt, ich habe keine Lust auf das Versteckspielen, den Kleidertausch und die Hosenrolle usw., ich muss mir mühsam wieder anlesen, dass der Inhalt damals als revolutionär erlebt werden konnte; dass die Oper vom Kaiser genehmigt werden musste! Und ich nehme jede Mühe auf mich, weil die Erinnerung an dieses eine Juwel auch das gesamte Umfeld erstrahlen lässt und das Bewusstsein, dass die gesamten Szenenfolge und alle Charaktere – Musik für Musik – einzigartig sind. Der Anlass, dies zu schreiben, ist die Aufführung morgen in Bonn. Ich weiß, dass alles eine Freude ist oder sein wird, und ahne, dass es wieder die eine Szene ist, wo ich nichts mehr auf der Bühne erkennen werde, wieder wird es mir peinlich sein, obwohl ich im dunklen Zuschauerraum sitze. Dieses eine Lied, das in seinen Modulationen ein Universum der Innerlichkeit öffnet. Nein, ich ziehe diesen Ausdruck zurück.) Ich erinnere mich, dass mehrere solcher Stellen mich schon mehrfach motiviert haben, den Eindruck zu konkretisieren oder nach außen zu vermitteln, und immer wieder diese eine, ich greife einfach auf das zurück, was ich damals versucht habe in Worte zu fassen:
Wie soll man so etwas singen? Zumal wenn es sich um eine der schönsten Melodien handelt, die Mozart ersonnen hat? Auf jedenfall knabenhaft grade heraus und nicht allzu kunstvoll vibriert; naiv, erregt, – aber nicht lächerlich.
So wie hier ganz bestimmt nicht, mit lauter einzeln auftremolierenden Tönen, als gelte es zu zeigen, dass die Stimme gut sitzt.
10) 5036382 Kuijken „Figaro“ CD 2 Tr. 2 ab 0’16“ bis 0’39“
So in der Gesamtaufnahme Sigiswald Kuijkens (Monika Groop). In Nikolaus Harnoncourts Züricher Gesamtaufnahme klingt es nach reifem, konzentriertem Einsatz von Stimmkunst (Petra Lang), also auch weniger nach einem unerfahrenen, von unbeschreiblichen Gefühlen erfüllten Knaben:
11) 5019923 Harnoncourt „Figaro“ CD 2 Tr. 2 ab 0’08“ (!) bis 1’16“
Ich habe eine andere Aufnahme mit Harnoncourt in Erinnerung: ……. da begann Cherubino schüchtern, aber mit wachsender Sicherheit, und zugleich schienen die beiden gut aufgelegten Frauen, die ihm zuhörten, von wachsendem Staunen ergriffen, sie wurden ganz still: man erlebte einen magischen Moment, vollkommen erfüllt vom Zauber dieser einen, reinen Melodie.
Und wenn die Gräfin gleich danach sagt: „Bravo, was für eine schöne Stimme! Ich wußte gar nicht, dass Sie so schön singen!“
Und Susanna: „O wirklich, was er macht, macht er alles gut“, so klang das nicht alsbald wieder übermütig und belustigt wie in manchen anderen Aufführungen, sondern so, als müssten sie sich mit Mühe von diesem magischen Zauber lösen. Susan Graham sang damals den Cherubino. Unvergesslich!
Können Sie verstehen, dass man dann geradezu sauer ist, wenn man erlebt, wie Cherubino in John Eliot Gardiners Gesamtaufnahme von der Darstellerin selbst (Pamela Helen Stephen) geradezu verspottet wird? Entsprechend oberflächlich ist das Tempo.
12) 5016 344 Gardiner „Figaro“ CD 1 Tr. 25 ab Anfang bis 1’22“
Natürlich – sie fasst sich, sie versucht zu sich und zu der Musik zu kommen, aber kann man ihr den Dumme-Jungen-Anfang vergessen? Ich nicht.
Weil die Schönheit der Melodie keinen solchen Spaß verträgt.
Auf der Suche nach einem idealen Cherubino hatte ich erwartet, bei den aktuellen Vertretern der „Aufführungspraxis“ am ehesten auf eine glaubwürdig knabenhafte Frauenstimme zu treffen.
Aber wissen Sie, wo ich nun glaube fündig geworden zu sein? Bei Sir Georg Solti, in der Gesamtaufnahme von 1982. Frederica von Stade singt.
13) 5000 098 Solti „Figaro“ CD 1 Tr. 12 „Voi che sapete“ 2’48“ (Achtung: kein Stop an dieser Stelle!)
So einfach ist das. Frederica von Stade sang, das London Philharmonic Orchestra spielte unter Sir Georg Solti. So einfach ist das, und wieviel Kunst gehört dazu! Wieviel Mut allein, den naiven Überschwang in einem einzigen Glissando überborden zu lassen:
(andeuten!)
Meine Damen und Herren, eine ähnlich rastlose Wanderschaft durch die verschiedenen Tonarten wie in Mozarts Cherubino-Arie erleben wir bei Franz Schubert, und ganz besonders, wenn von der Wanderschaft die Rede ist. Ich habe lange Zeit sein wunderbares Lied „Der Wanderer an den Mond“ missverstanden: ich fand die ersten beiden Strophen erschütternd, so tapfer dahinschreitend, zugleich von untergründiger Verzweiflung getrieben, und da erschien mir der Schluss als allzu billiger Trost. Mir war nicht aufgefallen, dass das Wort „ich“ verschwindet! Da ist nur noch der Mond und der Himmel, „endlos ausgespannt“, und die Vision des Glücks, das dem zuteil wird, der, „wohin er geht, doch auf der Heimat Boden steht“; die glückliche Musik, die dazu erklingt, hat nichts zu tun mit dem Befinden dieses Heimatlosen, der da wandert.
* * *
Welche Aufnahme war es, die ich damals verwendet habe? Gerade eine einzige hat sich bei den vorherigen Hör-Aktionen „herausgeschält“, mit Frederica von Stade natürlich, unter Solti, aber war es die, die auf youtube zu sehen ist?
Wunderschön. Aber war es diese Aufnahme? So langsam… und mit winzigen Intonationsschärfen? Irgendetwas fehlt mir. Die gutturale Kraft der tiefen Töne, das gewagte Abwärtsglissando in der Höhe.
Die Aufführung in Paris 1980 ist berühmt, man kann auch die ganze Oper abrufen: hier. ( Frederica von Stade bei 56:06). Ebenso eine Gesamtaufnahme unter John Pritchard beim Glyndebourne Festival Opera 1973 hier. „Voi che sapete“ ist auch in der frühen Fassung unter Karajan in Klang und Tempo (!) sehr gelungen. Aber die unverwechselbare, für alle Zeiten (das sagt sich nicht so leicht!) einzigartige Aufnahme mit Frederica von Stade ist die von 1982 unter Solti:
Leider nicht so leicht auffindbar; ein kurzer Eindruck ist vielleicht hier (Tr.7) möglich…
* * *
Versuch, die unverständlichen (oder ärgerlichen) Abschnitte der Figaro-Handlung im Umkreis der Cherubino-Lieder zu verstehen (nach Wikipedia hier):
Szene 5–8. Der Page Cherubino wurde vom Grafen entlassen, weil er bei einem Stelldichein mit der Gärtnertochter Barbarina ertappt wurde. Er will das Schloss aber nicht verlassen und bittet daher Susanna um Fürsprache beim Grafen. Besonders vermissen würde er die Mädchen (Nr. 6. Arie Cherubinos: „Non so più cosa son, cosa faccio“). Als der Graf erscheint, versteckt sich Cherubino. Der Graf macht Susanna den Hof. Kurz darauf kommt auch Basilio, der Musikmeister der Gräfin, und der Graf sucht ebenfalls nach einem Versteck. In dem Durcheinander springt Cherubino auf den Sessel und verbirgt sich unter einem Kleid Susannas. Basilio beschwert sich bei ihr über das unziemliche Verhalten des Pagen der Gräfin gegenüber. Der Graf kommt aus seinem Versteck, um Näheres zu erfahren (Nr. 7. Terzett Graf/Basilio/Susanna: „Cosa sento! Tosto andate“). Wenig später entdeckt er Cherubino unter Susannas Kleid. Der Page wird nur durch einen Huldigungsauftritt der Landleute vor einer Bestrafung des eifersüchtigen Schlossherrn bewahrt (Nr. 8. Chor: „Giovani liete, fiori spargete“). Der verzeiht ihm aber lediglich unter der Bedingung, dass er sich der Armee anschließt. Figaro gibt Cherubino gute Ratschläge mit (Nr. 10. Arie Figaros: „Non più andrai, farfallone amoroso“).
Zweiter Akt (Ein prächtiges Zimmer mit einem Alkoven, links im Hintergrund eine Tür zu den Zimmern der Bedienten, an der Seite ein Fenster)
Szene 1–3. Die Gräfin beklagt die Untreue des Grafen (Nr. 11. Cavatine der Gräfin: „Porgi, amor, qualche ristoro“). Susanna erzählt ihr von den Annäherungsversuchen des Grafen. Figaro kommt hinzu und berichtet ihnen von Marcellinas (gehört zu Basilio JR) Intrigen. Doch er hat einen Plan vorbereitet, um alles wieder zum Guten zu wenden: Um die Eifersucht des Grafen anzustacheln, hat er ihm durch Basilio die Nachricht zukommen lassen, dass die Gräfin sich am Abend mit einem Liebhaber treffen will. Im nächsten Schritt soll Susanna dem Grafen ein Rendezvous gewähren, zu dem dann aber der als Frau verkleidete Cherubino kommen wird. Die Gräfin soll die beiden ertappen und den Grafen dadurch zum Einlenken zwingen. Figaro geht, und die beiden Frauen lassen den Pagen herein. Susanna bittet ihn zunächst, ein selbstverfasstes Lied vorzutragen, dass er ihr am Morgen gezeigt hatte (Nr. 12. Arietta Cherubinos: „Voi che sapete che cosa è amor“). Susanna nimmt Cherubino den Mantel ab. Sie fängt an ihn zu kämmen und bringt ihm bei, sich wie eine Frau zu verhalten (Nr. 13. Arie Susannas: „Venite… inginocchiatevi“). Danach entfernt sie sich mit seinem Mantel durch eine Hintertür, um ihr Kleid für Cherubino zu holen.
Ich liebe die zugleich kindlich-pubertäre wie androgyne Gestalt des Cherubino, der von einer Sängerin gespielt wird, die bis hierher als Knabe aufgetreten ist und nun zur Frau verkleidet wird. Niemand außerhalb der Bühne glaubt daran, aber ohne den Glauben wäre diese wunderbare Figur nicht entstanden.
* * *
Ich kann mir alles weitere sparen, seit dem gestrigen Abend (10. Juni 2018) in der Bonner Oper. Eine Aufführung, in der alles (ALLES) gelungen ist, jede kleine Absurdität in der Handlung sich auflöst: Leichtigkeit, Witz und Augenblicke voller Tiefe (jawohl), lauter Entdeckungen, wie schön das alles instrumentiert ist, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, die Farben der Holzbläser, das Pizzicato der Streicher, die Brillanz und das Brio ihrer Läufe, die schauspielerischen Finessen der Bühnenfiguren, die Stimmen, die Phantasie in der Regie des Ganzen, im Bühnenbild, in den Aktionen, den Chören (was für ein „Bolero“!!!), drei Sternstunden der Oper an einem Stück! Ein Triumph Mozarts (und des Textdichters da Ponte), einer für alle – der Name des Dirigenten: Dirk Kaftan. Und was für ein Glück, solche Könner in der Stadt zu haben! Und auf einer einzigen Bühne und im Orchestergraben versammelt zu sehen!
(Der korrekte Name der Barbarina fehlt; das hätte die wunderbare Marie Heeschen nicht auch noch schaffen können…)
Zu allem was ich gestern in der Aufführung erlebt habe, passt haargenau, was ich (erst heute) vom Regisseur und vom Dirigenten darüber gelesen habe: Aron Stiehl und Dirk Kaftan. Was für eine Wohltat in einer Zeit, wo man sich darüber ärgert, wie wenig die aktuellen Inszenierungen den Besuchern an Mündigkeit und Abstraktionsvermögen zutrauen. Freundlicherweise erhielt ich die Erlaubnis, den Text wiederzugeben. Dank an Tilmann Böttcher!
Über Leute, die dahinterstehen
Zum Laaber-Verlag HIER
In der Autorenliste: Reichow & Schneider
Thema Weltkulturen auf den Seiten 618-622
Prof. Christian Schneider 2017 (Foto: ER)
Werbung von Atemtechnik bis Zippelfagottist:
Kooperation Reichow/Schneider vor 30 Jahren:
WDR Oboenfestival & Ausstellung Oktober 1988 – INDIEN HÖREN HIER.
* * *
Wer einmal versucht hat, ein sehr komplexes Thema in einen sehr kleinen Artikel zu zwingen, der auch noch gut zu lesen sein soll, wird sich dieser Arbeit nur noch selten unterziehen. Sie ist schwierig und mit viel Frust verbunden. Andererseits zwingt einen ja auch niemand – um ein ganz anderes Thema anzuschlagen – etwa den Ausdruck „Zippelfagottist“ als Höhepunkt zu servieren; zumindest die gesamte Bach-Forschung weiß, dass es zu den frühesten authentisch überlieferten Worten Johann Sebastian Bachs gehört. Desgleichen könnte man wissen, dass der junge Arnstädter Organist neben seiner Tabakspfeife kein Schwert, sondern einen Degen mit sich getragen hat. Zur Erinnerung sei aus dem Dokument zitiert, das den Bachschen Gebrauch des Wortes „Zippel Fagottist“ untermauert, nicht aber den einer schärferen Waffe als damals üblich.
Nachtrag 23.07.2021
Ein bürgerliches Trauerspiel?
Es ist meine Marotte, möglichst festzuhalten oder zu eruieren, wann ich etwas Bestimmtes kennengelernt habe, um die Erinnerung mit dem persönlichen Umfeld zu ergänzen. Aber auch dieses Datum zeigt, – wenn ich es mit allen Assoziationen jener Zeit verbinde – , dass ich das Kennengelernte durchaus nicht begriffen habe. Ich habe die George-Lieder auch damals nie gehört, vielleicht habe ich das Büchlein wegen des Adorno-Nachwortes gekauft, wegen Adorno, dessen „Philosophie der Neuen Musik“ ich aus der Bielefelder Stadtbücherei entliehen hatte und im Bielefelder Freibad zu verstehen suchte (Ich bin nie vom Zehner gesprungen). Gekauft habe ich sie mir im Jahr darauf in Berlin und dort im Café Kranzler mit Rot- und Blaustift gelesen. Habe in dieser Zeit auch „Moses und Aron“ in der Oper erlebt und das Buch von Karl H. Wörner studiert, das 1959 in Heidelberg erschienen war. Ende der Einleitung.
Und jetzt ist mir etwas Furchtbares passiert: ich habe mir das Buch von Albrecht Dümling über Schönbergs George-Lieder antiquarisch besorgt, ohne zu wissen, dass es seit vielen Jahren in meinem Bücherschrank steht, – praktisch ungelesen. Gestern kam es an, und ich habe mich sehr gefreut.
Der Anlass für diese neue Beschäftigung mit den „fremden Klängen“, dem Buch der hängenden Gärten bzw. Schönbergs Opus 15, ist zufälliger oder rein privater Natur. Man sieht es hier. Aber solche Zufälle oder rein privaten Anlässe sind eigentlich immer von zwingendem Charakter oder nehmen ihn an, sobald man sich mental einmal darauf eingelassen hat – und es sich nicht nur, sagen wir, um ein Fußballspiel handelt…
Zunächst zitiere ich, was ich mir heute morgen aus dem Dümling-Buch abgeschrieben habe, um unmittelbar an meine Adorno-Erfahrung anzuknüpfen (weggelassen habe ich die im Original angegebenen Seitenangaben):
In seinem Aufsatz von 1928 über die Situation des Liedes formulierte Adorno Gedanken, die er später auf seine Einschätzung aller für ihn relevanten modernen Kunst übertrug. Der seiner gesamten Kunsttheorie zugrundeliegende Gedanke vom Kunstwerk als Monade, das der Gesellschaft gegenüber im Verhältnis der Negation steht, ließe sich aus seiner frühen, durch Schönbergs George-Lieder inspirierten Wesensbestimmung des Lyrisch-Liedhaften herleiten. Der Abbruch der Kommunikation mit der Gesellschaft wurde ihm zum Grundzug jeglicher „moderner“ Kunst. Adornos Begriff von moderner Kunst, den er in den zwanziger Jahren nicht zuletzt an Schönbergs George-Liedern op. 15 entwickelte, ist, wie deutlich werden sollte, ein spezifisch bürgerlicher Kunstbegriff. Ihm liegt ein Ideal zugrunde, das zuerst in der Idee des Liedes angelegt war – das Ideal subjektiven Ausdrucks. War die Idee der Subjektivität bei Schubert noch eingebettet in die Solidarität des Freundeskreises, hatte sie sich im Konzertlied der Jahrhundertwende einem gleichgesinnten Publikum als „öffentliche Einsamkeit“ präsentiert, so wurde im 20. Jahrhundert die Subjektivität des bürgerlichen Künstlers als Selbstbehauptung nur noch möglich in der Form des Widerstands des Individuums gegen das Kollektiv. In diesem Punkt korrespondiert Adornos Begriff von moderner Kunst durchaus mit demjenigen Hugo Friedrichs von „moderner Lyrik“. Die Negativität der modernen Kunst, die für den Gundolf-Schüler Friedrich ein Moment des Zerfalls darstellt, ist für Adorno hingegen schon ein Moment des Widerstands. Die Widerstandshaltung der modernen Kunst deduzierte Adorno aus eben dem, was Friedrich ihre Nicht-Assimilierbarkeit genannt hatte. „Fast wäre zu glauben, daß die Kunstwerke, die den Stand eines radikal veränderten Bewußtseins und damit einer veränderten Gesellschaft anzeigen, von der bestehenden Gesellschaft kaum ohne weiteres akzeptiert werden können, da das oberste Interesse jener Gesellschaft gerade dahin geht, sich vor jeder Veränderung zu schützen und ihr gegenwärtiges Befinden als vital notwendig und naturgegeben zu verherrlichen. Diese Gesellschaft akzeptiert aber, indem sie ‚versteht‘ und lehnt ab, indem sie ’nicht versteht‘.“
Die Nicht-Assimilierbarkeit der modernen Kunst war als Konsequenz der Nicht-Anpassung des Individuums für Adorno nicht zufällig gerade im Lied, dem medium unmittelbarer individueller Kundgabe, ausgeprägt. „Es kann als soziologisch so wenig erstaunen wie in immanent-musikalischer Analyse, daß die Objektivation des Liedcharakters im personellen Komponieren und nicht einer innermusikalischen zufälligen und soziologisch suspekten Zuwendung zum Gebrauchsbedürfnis des Publikums zu suchen ist und das Lied, musikalisch von allen Formen die, die am engsten an der Person haftet, stellt eben dies schwierige Verhältnis klar dar.“ Adorno vertraute nur noch der radikalen Subjektivität. In der Abwehr jeglicher kollektiver Funktionen von Musik, in der die Verweigerung ihrer Funktionalisierung, gerade in einer Zeit, in der die funktionsgebundene und „Gebrauchs-Musik“ wieder eine beträchtliche Rolle spielte, ließ Adorno aber neben der Widerstandshaltung vor allem eine Funktion der Kunst stärker hervortreten: zur Selbstreflexion des Künstlers zu dienen. Diese Funktion teilt das moderne Lied mit der modernen Lyrik.
Die Einsamkeit des modernen Liedes ist also die Konsequenz eines genuin bürgerlichen Gedankens, nämlich der zum Wesensbegriff des Kunstliedes gehörenden Subjektivität. Die von Bekker und Adorno zunächst im Gegenzug zur Jugendbewegung formulierte Verabsolutierung des Subjektivitätsgedankens gehört allerdings schon der Spätphase des Liedes an. Daß gerade das aus dem Volkslied entwickelte Lied zum Inbegriff der Nicht-Assimilierbarkeit der modernen Kunst werden konnte, so daß Adorno im Liedcharakter deren Leitbild sah, zeigt den grundsätzlichen Wandel der Gattung wie auch der Gesellschaft an. Innerhalb von 100 Jahren verwandelte sich die Ästhetik des bürgerlichen Humanitäts- und Menschheitsgedankens kraft des subjektiven Moments in ihr Gegenteil. Schönbergs George-Lieder, die die seit Schubert beständig gewachsene Kluft zwischen den Klassen dokumentieren, enthalten mehr gesellschaftliche Wahrheit als Lieder anderer bürgerlicher Künstler, die durch künstliche Volkstümlichkeit diesen Zwiespalt schlicht leugnen. Die George-Lieder Schönbergs sind wohl die ersten Lieder der Moderne, in der die radikale, der Selbstbehauptung dienende Setzung von Subjektivität gegen die Normen der Gesellschaft stattfand. Deshalb eigneten sie sich zum Modell moderner Kunst.
Quelle Albrecht Dümling: Die fremden Klänge der hängenden Gärten / Die öffentliche Einsamkeit der Neuen Musik am Beispiel von Arnold Schönberg und Stefan George / verlegt bei Kindler, München 1981/ Zitat Seite 253f.
Damals zu Anfang meiner Studienzeit (in Berlin), als ich mich begann ernsthaft mit Schönberg und seiner Schule (die Gesamtaufnahme der Werke Weberns mit Robert Craft war gerade herausgekommen, ich hörte einige Wochen lang täglich Schönbergs „Erwartung“), tobte im Theorieunterricht ein heftiger Streit um serielle Musik, der die Zukunft zu gehören schien, – jedenfalls nicht den Adepten Strawinskys oder Bartóks. Allerdings lernte ich beizeiten – gerade auch bei Adorno – mit Widersprüchen zu leben. Auch völlig unvereinbaren! Den von Adorno entwickelten Antagonismus zwischen Schönberg und Strawinsky zu akzeptieren, verweigerte ich guten Gewissens; und manche seiner Anmerkungen waren mir wichtiger als lang ausgeführte Theorien: für mich lag auf der Hand, dass man sich nicht von 95% der Menschheit kulturell verabschieden kann. Die Enklave der bürgerlichen abendländischen Musikkultur ist Exotik schlechthin, nicht die angeblich fremden Musikkulturen in Indien, Indonesien, Ägypten, Zimbabwe, die Adorno unter den Begriff „exterritorial“ gefasst hätte, absurderweise. (Ich empfehle, einmal in Vietnam nach einer „Melodie“ im traditionellen Sinne zu suchen.) In Abwandlung seines eigenen Textes sollte gelten: „Über die Wahrheit und Falschheit von Musikkulturen entscheidet nicht deren isoliertes Vorkommen. Sie ist nicht meßbar, und erst recht nicht am Stand einer künstlich normierten Technik.“ (JR)
 Adorno: Philosophie der Neuen Musik
Adorno: Philosophie der Neuen Musik Europ.Verlagsanstalt Frankfurt a.M. 1958
Europ.Verlagsanstalt Frankfurt a.M. 1958
Schönberg über das Nachzählen von Reihen in seinen Kompositionen:
(…) die ästhetischen Qualitäten erschließen sich von da aus nicht, oder höchstens nebebei. Ich kann nicht oft genug davor warnen, diese Analysen zu überschätzen, da sie ja doch nur zu dem führen, was ich immer bekämpft habe: zur Erkenntnis, wie es gemacht ist, während ich immer nur erkennen geholfen habe: was es ist! …Für mich kommt als Analyse nur eine solche in Betracht, die den Gedanken heraushebt und seine Darstellung und Durchführung zeigt. Selbsverständlich wird man hier auch artistische Feinheiten nicht zu übersehen haben.
Quelle Karl H. Wörner: Gotteswort und Magie / Verlag Lambert Schneider Heidelberg 1959 (Seite 79)
Wie Helmut Lachenmann der Routine entkommen ist
ZITAT (Hervorhebungen in roter Schrift JR)
Jahrelang hatte er sich mit den Schattenseiten des „schönen Tons“ beschäftigt und den Instrumenten lauter Geräusche und Geräuschklänge entlockt – ein Tabubruch und zugleich Kritik an einem Schönheitsbegriff, der nach dem Missbrauch der großen klassischen Werke im Nationalsozialismus leer und unglaubwürdig geworden war.
Und dann muss er eines Tages erschreckt feststellen, dass er ungebetene Nachahmer hat: In den Kompositionsunterricht an den Hochschulen hält der „Lachenmann-Stil“ Einzug, das ehemals skandalöse Schaben auf den Saiten und tonlose Blasen in die Mundstücke ist zum approbierten Merkmal kompositorischer Fortschrittlichkeit verkommen. Die Kritik an der Gewohnheit ist selbst zur Gewohnheit geworden.
Nun war es für Lachenmann höchste Zeit, sich vom zweifelhaften Ruf eines Geräuschpapstes zu befreien, und er begann sich schrittweise mit der lange vernachlässigten Melodie zu befassen. Auch das ein Tabubruch, diesmal mehr persönlicher Art, hatte doch Melodie für den schwäbischen Pastorensohn stets etwas ungemütlich Magisches, dem er mit kritischem Verstand zu Leibe rücken wollte. Eine Art intellektueller Gegenzauber? Die Abwehr saß tief, denn um 1960 hatte ihm schon sein Lehrer Nono eingeschärft: „Melodie ist eine bourgeoise Angelegenheit.“ So etwas macht misstrauisch.
Quelle Max Nyffeler in http://www.beckmesser.info/ist-helmut-lachenmann-melophob/
* * *
Zurück zu Schönberg
Das Buch von Albrecht Dümling (hervorgegangen aus seiner Dissertation 1978) ist tatsächlich immer noch ein Schlüsselwerk, das geeignet ist, den Weg zur Atonalität ebenso wie in die moderne Lyrik verstehen zu lassen. Und für das Studium der Lieder ist es hilfreich zu wissen, dass Schönberg mit dem vierten begonnen hat, danach das fünfte, dritte und das achte Lied komponierte. Genau in dieser Reihenfolge würde ich jetzt auch das Studium ablaufen lassen und dabei den analytischen Hinweisen Dümlings folgen:
Quelle Albrecht Dümling: Die fremden Klänge der hängenden Gärten / Die öffentliche Einsamkeit der Neuen Musik am Beispiel von Arnold Schönberg und Stefan George / Kindler Verlag 1981 / ISBN 3-463-00829-7
Dieses Buch ist also (s.o.) noch bei Drittanbietern preiswert zu erwerben (um 10.- €).
Eine ausgezeichnete Beschreibung und Analyse des Schönbergschen Liederzyklus op.15 von Siglind Bruhn findet man online als pdf HIER . (Als Bestandteil des Buches „Schönbergs Musik 1899-1914 im Spiegel des kulturellen Umbruchs in der Edition Gorz Hier.)
Zum Erarbeiten der Musik (mit dem Ohre) verwende ich die Youtube-Version mit Susanne Lange, Mezzosopran, da diese Stimmlage der Notation entspricht. Als Ergänzung wähle ich die sehr intensive Interpretation von Christian Gerhaher, dessen Verzicht auf Vibrato der Durchhörbarkeit der Harmonik (und Melodik) sehr zugutekommt.
Susanne Lange (Tove Lonskov, Klavier) im externen Fenster hier (oder direkt zu den Einzelliedern wie folgt:)
01 – 0:18 02 – 2:41 03 – 4:19 04 – 6:14 05 – 8:08 06 – 9:34 07 – 11:01 08 – 12:21 09 – 13:23 10 – 15:25 11 – 17:50 12 – 20:25 13 – 22:47 14 – 24:41 15 – 25:39
Aufnahme mit Helen Vanni (Glenn Gould, Klavier) HIER.
IV. Da meine lippen reglos sind und brennen [5:35] V. Saget mir auf mir auf welchem pfade [7:05] III. Als neuling trat Ich ein in dein gehege [3:55] VIII. Wenn Ich heut nicht deinen leib berühre [10:30]
Lied 4 ab 5:04 Da meine Lippen reglos sind und brennen / Lied 5 ab 6:30 Saget mir, auf welchem Pfade heute sie vorüber schreite / Lied 3 ab 3:23 Als Neuling trat ich ein in dein Gehege / Lied 8 ab 9:29 Wenn ich heut nicht deinen Leib berühre.
Alle George-Texte zum Mitlesen (im externen Fenster) bei ZENO !
So schön, ja wunderbar die Gerhaher-Version auch ist, – ich möchte dennoch ganz leise Zweifel säen, ob es eigentlich erlaubt ist, die Singstimme eine Oktave tiefer als notiert zu singen. Nehmen wir die ersten Töne des Liedes 4, deren Melodie genau im Einklang mit dem Klavier „gedacht“ ist. Wenn sie in der Mitte des Klaviersatzes verläuft, ergibt sich eine ganz andere Mischung, nicht wahr? Es gibt auch Stellen, wo sie unmittelbar unter den Klavierbass gerät…
* * *
Ich glaube, es ist auch notwendig darüber zu sprechen, was an manchen Versen Stefan Georges heute schwer erträglich ist: das gestelzt Pretiöse, das nicht selten wie die Parodie seiner selbst klingt. Es ist gewiss legitim, statt des Wortes Warten das Wort Harren zu verwenden, zur Not auch statt Farn (um des Reimes willen) Farren; aber der Satz, dass man trotz eines Regentropfens Guss „neue Labung missen muss“, klingt doch eher nach angestrengter Sprachspielerei als nach hoher Stilkunst. Zur Schau gestellte Feinsinnigkeit, wie zuweilen bei Rilke („Wir beide stumm zu beben begannen / Wenn wir leis nur an uns rührten“). Man versteht, warum Schönberg seine Texte verwendet und nicht mehr solche von Dehmel… Wie behandelt Adorno die Verse Georges inhaltlich? Herrlich böse, was Bert Brecht schreibt: „Ich selber wende gegen die Dichtungen Georges nicht ein, daß sie leer erscheinen: ich habe nichts gegen Leere. Aber ihre Form ist zu selbstgefällig. Seine Ansichten scheinen mir belanglos und zufällig, lediglich originell. Er hat wohl einen Haufen Bücher in sich hineingelesen, die nur gut eingebunden sind, und mit Leuten verkehrt, die von Renten leben. So bietet er den Anblick eines Müßiggängers, statt den vielleicht erstrebten eines Schauenden.“ (Agora Darmstadt 1961 Seite 125)
* * *
Ein Grund mehr:
Handyfotos: Dominique Mayr
 Betriebswerk Heidelberg 1.Juli
Betriebswerk Heidelberg 1.Juli
ZITAT
Jetzt konnte man den Zyklus im Rahmenprogramm der Heidelberger George-Ausstellung im Betriebswerk des TankTurms hören und wurde gleichzeitig von Albrecht Dümling höchst kompetent über die Entstehungshintergründe beider Zyklen, des lyrischen wie des musikalischen, informiert.Die fabelhaft intonationssichere Mezzosopranistin Truike van der Poel und der Pianist J. Marc Reichow interpretierten diese Lieder ebenso klanglich nuanciert wie rhythmisch und dynamisch pointiert. Die bisweilen schwülstige Rhetorik des Dichters, selbst mehr vokale Klangkunst als sprachliche Beschreibung eines Gefühls, wurde höchst artifiziell in Musik übertragen, die Wagners „Tristan“ ebenso wenig leugnet wie den Wunsch nach der „luft von anderem planeten“ (ein weiteres George-Gedicht, das Schönberg in seinem Streichquartett op. 10 vertonte). Lieder von Conrad Ansorge, Theodor W. Adorno und Anton Webern umrahmten Dümlings Vortrag.
Quelle Rhein-Neckar-Zeitung 3.7.2018 „Wenn ich heut nicht deinen leib berühre“ Stefan Georges „Buch der Hängenden Gärten“ in Arnold Schönbergs Vertonung und anderes im Betriebswerk des TankTurms / Von Matthias Roth / online HIER.
Nachtrag
Sendung abrufbar (bis ?) HIER.
Aus einer Besprechung in der Süddeutschen Zeitung vom 29. Sept.1995, bemerkenswert wegen der Zeilen zu Gadamer, Vortragston, Sexualität.
Die George-Biographie von Thomas Karlauf bei Perlentaucher HIER.
Heute (12. Juli 2018) DIE ZEIT Seite 37 Artikel von Thomas Karlauf: Großes Abakadabra im zweiten Stock / In jüngster Zeit wurden Missbrauchsvorwürfe gegen Wolfgang Frommel laut, den früheren Leiter der Amsterdamer Stiftung Castrum Peregrini. Er gehörte zu den Verehrern des Dichters George. Muss man die Geschichte des George-Kreises nun neu schreiben? Online HIER.
Vorschau
Deutschlandfunk Kultur 15. Juli 2018 22.00 Uhr hier
| 22:00 Uhr |
MusikfeuilletonDie Wendung zum Musikfeind Ermutigt durch die französischen Symbolisten, begann Stefan George als Wagnerianer. Dann aber kehrte er sich abrupt von der Musik ab und propagierte eine nur aus Worten bestehende Tonkunst, die eher mit Skulptur und Architektur verwandt war. Trotz dieser Wendung, deren Hintergründen die Sendung nachgeht, beeindruckte seine artifizielle Lyrik Komponisten wie Arnold Schönberg und Anton Webern. |
In der Sendung 1 Ausschnitt aus dem Konzert vom 1. Juli in Heidelberg.
Ein Interpretationsvergleich
Es funktioniert so: man stellt die zweite Aufnahme (Aufnahme B) auf Anfang ein (bei 0:25), und zwar unterhalb des Youtube-Bildes auf „Hier“, so dass sich ein externes Fenster auftut, und richtet sich darauf ein, dass man von der Blogansicht problemlos ins externe Fenster wechseln kann und zurück. Wir nehmen das Blogfenster als Basis, weil man dort die Noten verfolgen kann. (Übrigens auch dann, wenn man keine Noten lesen kann, die Ohren sind die Hauptsache!) Vor jedem Wechsel schalten wir auf Stop, damit nicht beide Aufnahmen gleichzeitig zu hören sind. Wir stoppen immer nach einem sinnvollen (wenigstens halb-) geschlossenen Zusammenhang, den man im Sinn behalten kann, aber auch nicht allzu gestückelt. Wir beginnen etwa Aufnahme A mit 0:00 bis 0:22… Stop (beim nächsten Mal von hier bis 0:38). Üben und hören! In der Analyse spreche ich nicht von ihm oder ihr (Geiger oder Geigerin), sondern von Geige A und Geige B, Klavier A und Klavier B. Beide Geigen sind technisch hervorragend, es geht uns aber nicht um das geigerische Können, sondern um das Wollen, die Interpretation.
Aufnahme A
Aufnahme B
Dieselbe Aufnahme im externen Fenster: HIER – – – Achtung: einstellen auf 0:25 (unmittelbar vor Musikbeginn) und Stop! (Dann zurück auf internes Blogbild!) Beim nächsten Mal wieder extern von hier bis 0:52. Üben und hören!
* * *
Selbstverständlich gehört zur ordentlichen Interpretation eines großen Werkes auch eine gründliche gedankliche Vorarbeit. Ich will nicht das abschreckende Wort „Analyse“ verwenden, aber es ist doch ein Wissen um den Aufbau und bestimmte begleitende Überlegungen, was eigentlich den Komponisten bewogen hat, gerade dieses Werk zu schreiben. Ein Beethoven schreibt keine Sonate „nur so zum Spaß“, und die Instrumentalisten spielen nicht „nur so zum Spaß“. Auch nicht, um ihre Virtuosität vorzuführen oder um zu zeigen, wie großartig ihre Instrumente klingen. Ich verwende und zitiere ausschließlich einen Artikel des folgenden Buches, der vielleicht etwas karg formal klingt, aber doch Übersicht schafft; als Autor firmiert dort „Michael Maier“ (Info unter Franz Michael Maier hier). Wenn ich die vorgesehenen Zitate mit genauen Zeitangaben (in roter Farbe!) versehe, beziehen sie sich – wegen des mitlaufenden Notentextes – immer auf die Aufnahme A.
Für völlig unbrauchbar würde ich bei einer solchen Betrachtung bloße Geschmacksurteile wie „gefällt mir“ oder „gefällt mir nicht“ halten, es geht also um Begründungen. Und keine Interpretation ist sakrosankt, nur weil ein großer Name dahinter steht. Die berühmtesten Künstler können erstaunlich gedankenlos sein.
ZITAT Bd I Seite 248f:
Die drei Sätze bieten drei Blicke auf die Möglichkeiten des Zusammenspiels von Violine und Klavier. Den ersten Satz könnte man überschreiben „Das wiedergefundene Unisono“. Es handelt sich um einen Satz von klarstem, auf Sonderwege durchaus verzichtenden Bau: Das Hauptthema wendet sich im vierten Takt nach der Dominante und im achten Takt nach der Tonika; die weiteren Themen sind kontrastierend angelegt, ohne daß dadurch der rasche Ablauf des Satzes auch nur im geringsten stockte. Auffällig dagegen und durchaus folgenreich für den Satz ist die Art, wie das Hauptthema nach kurzem Anlauf in einem Fluge den Raum vom kleinen d bis zum dreigestrichenen g durchmißt, wobei Vorder- und Nachsatz im Unisono beginnen: (Notenbeispiel). Ob das erste Seitenthema in einem Sechzehntellauf ausschwingend in die Anfangsbewegung zurückkehrt oder ob diese in einem Überleitungsteil einem Akkordgang gegenübergestellt wird – zweimal kommt der Satz längst vor der Wiederholung der Exposition auf dieses Kopfmotiv in unisono rollenden Sechzehnteln zurück. Im Mittelteil der Sonate mischen sich in dieses Spiel von einstimmigem Beginn, Auseinanderlaufen und Zurückfinden die Unterschiede der Instrumente nach Klang und Lage hinein. Der in die Wiederholung der Exposition zurückleitende Abwärtsgang wird am Beginn der Durchführung sequenziert; den Sechzehntelrepetitionen des Klaviers treten dabei Violintriller gegenüber. Diese Sequenz mündet in eine Form der Ausgangsfigur, welche, in cis-Moll, das Unisono des Anfangs durch ein Alternieren der Kontra-Oktave des Klaviers und der zweigestrichenen Oktave ersetzt. Mit der vierten sequenzierenden Wiederholung ist mit der Grundtonart G-Dur auch die gemeinsame mittlere Lage wieder erreicht, in der das Unisono der Reprise eintritt. In dieser Weise exponiert der erste Satz die Frage des Zusammenspiels der beiden Instrumente; daß es in ihm um diese Exposition ging, muß die Behandlung der Frage in den folgenden Sätzen zeigen.
Ich möchte den atemlosen Gang der Dinge, während wir ihm vergnügt folgen, etwas einfacher beschreiben:
Es fällt wahrhaftig schwer, das Treiben zu unterbrechen und prüfend innezuhalten: der Drive des ersten Satzes ist hinreißend und duldet kaum eine Atempause. Wenn das zweite Thema einen Moment des Bedenkens anzumahnen scheint (0:38), – auch dadurch, dass es nach Abbruch der wirbelnden Sechzehntel modulierend ansetzt -, so kann es doch keinen Zweifel geben, dass es ähnlich weitergehen muss, und der Augenblick des Aufmerkens keine Schwächung bedeutet. Nicht umsonst bleibt das Sechzehntelmotiv als Einwurf präsent, ehe sich der geschmeidige Fluss des neuen Themas durchsetzt. Aber die Sechzehntel kehren unbeirrt wieder, angereichert durch Triller, Sforzati und abschließende Passagen, um endlich in die Rückkehr des Anfangs zu drängen (1:47) oder in weitere Aktionen zu münden (3:32). Man wird gewahr, dass schon im ersten Teil des Satzes mit dem übermütig exponierten Material gespielt wurde (um nicht von motivischer „Arbeit“ zu sprechen). In diesem Sinne geht es in der Durchführung weiter mit Läufen, Trillern und Sforzati, bis die Reprise dem scheinbar ungeplanten Treiben ein Ende macht und – neu beginnt (4:00).
Was soll die Interpretation anderes tun, als diese ganze Jagd unbeirrbar und perfekt abzubilden? Nur nicht stocken, ebensowenig eilen, nur nichts problematisieren, alles ist Spiel. Und wenn wir es nicht fertig bringen die Aufnahme A zu stoppen (5:41), dürfen wir es ihr und uns als Plus anrechnen, – um dann, wenn ohne jedes Zögern auch der zweite Satz beginnt (5:43), auszurufen: Stimmungswechsel! das kommt zu früh, da muss man doch länger warten, es muss wohl ein Schnittfehler sein!
Die Aufnahme B – die Live-Aufnahme eines Konzertes – lässt eine Pause von 7:12 bis 7:17, nicht zu lang, nicht zu kurz.
An dieser Aufnahme fällt von Anfang an auf, dass sie sich nicht damit begnügt stattzufinden: sie will uns vielmehr fortwährend etwas zeigen. Nehmen wir gleich nach den Sechzehnteln den Aufstieg zum höchsten Ton: er ist ebenso wie die aufsteigenden Achtel mit einem Punkt markiert, es soll ein kurzer Ton sein. Geige B gibt ihm ein besonderes Vibrato, das ihn verschönert, beim zweiten Mal noch auffälliger, er soll intensiv süß klingen. Womit zugleich eine Tendenz zum Auskosten, Innehalten angezeigt wird, – die dem Charakter des Satzes strikt widerspricht. Das Klavier antwortet mit der gesanglichen Fortspinnung, die von der Geige aufgenommen wird, bemerkenswerterweise aber nicht ohne Zögern; die beiden Auftaktachtel samt nachfolgender Dreiergruppe demonstrieren, dass sie den Stab übernehmen wollen. Warum tun sie es nicht einfach? Der Zielton bekommt ein besonderes Vibrato, ja, hier soll nun wohl gesungen werden, oder nein, es kommt allmählich in Fahrt, das Crescendo der aufsteigenden Sequenz scheint sinnvoll, aber das schwungvolle „Anhacken“ des höchsten Tones (0:58) doch übertrieben: sind wir schon so weit, dass es eines solchen Effektes bedarf? Wenn man begriffen hat, dass der Drive des Satzes in erster Linie mit einem steten Tempo Allegro assai zu tun hat, das mit dem Sechzehntel-Motiv des ersten Taktes gegeben ist und bei der Wiederkehr – einen Ton höher in A-dur (Aufnahme B bei 1:07) – keine weichere Tempovariante anbieten sollte, dann liegt es auf der Hand, dass dies auch für die nächsten Takte gelten soll. Was tut Klavier B? Es kostet den Fis-dur-Akkord über Gebühr aus. Was tut die Geige B? Sie lässt den gehaltenen Ton wild aufblühen und verzögert die nachschlagenden beiden Achtel. Und bei der nachfolgenden, ähnlich lautenden Phrase, wird der gleiche Vorgang noch einmal inszeniert und in den nachschlagenden Achteln sogar unmäßig übertrieben (bis 1:20). Da Klavier B das eingefügte Sechzehntelmotiv eigentlich nicht langsamer spielen kann, stottert der Motor spürbar, und Geige B eilt zu Hilfe mit einem entschlossenen Jammervibrato, das offenbar auf ein winziges crescendo reagiert, das von Beethoven eingezeichnet wurde. Die dreistimmige polyphone Passage schließt sich in gedrosseltem Tempo an; man ahnt bereits, dass ein neuer Tempo-vorwärts-Ruck bevorsteht, den Geige B (ab 1:29) tatsächlich mit einem reißerischen Impetus angeht. Zumindest wenn man die Aufnahme A kennt, wird man allmählich ärgerlich. Viel zu viele Ideen auf kurzer Strecke, und die Wiederholung der Exposition bietet haargenau das gleiche Bild, – unsteter kann es nicht werden. In der Durchführung (nach dem Doppelstrich) überrascht Geige B in dem Ping-Pong-Spiel der Kurztriller mit einer seltsamen Ausführung: ein engräumiges „Meckern“, das entsteht, wenn man weniger mit der Fingerbewegung als mit dem Vibratoschlag trillert, man nennt das auch „Bockstriller“, der allerdings im Wechsel mit der echten Trillerfigur des Klaviers leicht parodistisch klingt, – ist halt so eine Idee…
Nun wird man fragen: wenn die Geige B in diesem rasanten Satz schon so viele (überflüssige) Ideen unterbringt, was wird sie erst investieren im folgenden langsamen Satz? Man könnte ihn gar für eintönig halten und argwöhnen, Beethoven habe sich mit seiner Ausschmückung nicht genug Mühe gegeben.
Zitat (wie oben) Bd I Seite 249 / bitte mit Aufnahme A (Zeitangaben!) synchronisieren:
Den zweiten Satz (ab 5:42), Tempo di Minuetto ma molto moderato e grazioso, trägt eine Melodie von jener Art, die Beethoven nicht im Lauf der Komposition verändert und die er nicht variiert, sondern die er unverändert wiederholt. Anders aber als im Fall der Melodie des zweiten Satzes der Klaviersonate op. 90, in deren acht Wiederholungen nur einmal die Tenorlage der Melodie für klangliche Abwechslung sorgt, steht hier ein Reichtum von Kombinationen zur Verfügung. Der Satz beginnt getragen; zur Melodiestimme in der rechten und zum Baß in der linken Hand des Klaviers tritt in der Violine eine dritte Stimme, die wie der Baß in Vierteln geht, als höre man eine Begleitvioline. Die Violinstimme entfaltet sich zur Triostimme, die bald in Terzen mit der Oberstimme, bald in Gegenbewegung mit dem Baß geht. In den zweiten acht Takten (6:01) entfaltet sie sich zur Melodiestimme, die vom Klavier begleitet wird. In den folgenden (6:20), nach vier Takten gegliederten Abschnitten des Satzes wechseln sich die beiden Instrumente meist in eben diesem Rhythmus ab. Am Ende des Satzes (12:27) wird der Vortrag der unveränderten Melodie (über unverändertem Baß) einer Wechselrede der beiden Instrumente (Violine und rechte Hand des Klaviers) anvertraut. Durch die unüberbrückbare Verschiedenheit des Klanges und der Tonerzeugung wird die Aufmerksamkeit des Zuhörers auf die Art des geschehenden Aufeinandereingehens gelenkt. Die Melodie, die so schön ist, daß man sie in den 177 vergangenen Takten gerne wieder und wieder hörte, wird in dieser Form des Vortrags zur Darstellung des Seltenen, daß Menschen, und wäre es nur beim Spielen von Musik, übereinstimmen wollen. Weniger das den Abschnitten des Satzes entsprechende Abwechseln der vortragenden Instrumente nach vier und vier Takten bereitet diese Wirkung vor als das Unregelmäßige, daß etwa die Violine, über die Zäsur hinweg, in den Takten 59 (7:57) und 149 (11:22) fortsetzt (das Klavier wäre „dran“), und es ist der Nachklang dieser in dem wiederholungsreichen Satz nicht wiederholten, unwiederholbaren Stelle, daß Beethoven den schließenden Terzgang g – f – es sechsmal (variiert siebenmal gezählt ab 12:42) wiederholen läßt.
Man muss diesen etwas papierenen Text geduldig an der Musik abarbeiten und durch die Vorstellung der „wahren“ klanglichen Abläufe ersetzen, um ihn im Nachhinein schätzen zu lernen.
Man höre anschließend die Aufnahme B ( der Satz beginnt dort bei 7:15 ). Ich erspare mir einstweilen aufzuweisen, wieviel an Schmalz von Anfang bis Ende die reine Linienführung verdirbt; es betrifft vor allem die Geige. Aber mit einer ganz furchtbaren Nuance, vielleicht angezettelt durch Klavier B, müssen wohl beide einverstanden sein. Es ist die Stelle, die wir eben in Aufnahme A herausgegriffen haben („über die Zäsur hinweg“), hier in Aufnahme B auffindbar bei 10:01 und 14:23; ich meine die Auffassung der triolischen Klavierbegleitung als „Walzertakt“, samt Verzögerung auf dem jeweils zweiten Achtel, damit es auch der Dümmste merkt (Achtung Wien!!!!), selbst gestisch noch ganz unangenehm unterstrichen (bis hin zur Andeutung eines leichten Mitschunkelns!). So disqualifiziert man sich auch als Pianist in einem der unschuldig-schönsten Sätze, die Beethoven je geschrieben hat. Und wenn die Geigerin dazu ein Gesicht macht, als wälze der ganze Satz ausdruckstechnische Probleme – oder löse sie gar: mir ist es unmöglich, alle Details der Fehldeutung aufzuzählen. Das vergisst sich nicht und kann im letzten Satz durch virtuose Glätte und Schein-Übermut nicht wettgemacht werden.
Der Vollständigkeit halber soll aber auch die den letzten Satz betreffende verbale Deutung nicht fehlen:
ZITAT (a.a.O. Seite 249f Anmerkungen sind weggelassen JR) dazu: Aufnahme A
Der dritte Satz (ab 13:14) hat die Interpreten nachgerade verlegen gemacht durch seine Spielfreude. Thayer spricht von einem „Rondo à la musette“, in dem „ein gut Teil Naturalismus“ stecke, und noch die Beilage zu den Schallplattenaufnahmen mit Clara Haskil und Arthur Grumiaux weiß von dem Jahrmarktstreiben, das man einmal aus dem Satz herausgehört habe. Zu dem für einen Schlußsatz obligatorischen Stimmungswechsel tritt jedenfalls eindrucksvoll bis zum Erstaunenmachen der Wechsel der Stilhöhe. Fast könnte man von einer Parodie, fast von Spott auf die Wiederholungen und auf das Verzärtelnde des zweiten Satzes sprechen, denn auch das Sechzehntelthema dieses Satzes wird oft genug wiederholt und ruft oft genug seine Gegenstimme herbei. Und auch die hervorgehobenen Stellen fehlen nicht: In Exkursen nach H-Dur (15:02) und nach Es-Dur (15:40) wird es als letzte in diesem Werk vorgestellte Form des Zusammenspielens gezeigt, daß ein Instrument die Richtung weist und daß das andere sich so einstimmt und nachfolgt, wie Onkel Toby den Vorschlägen seines Dieners Trim nicht widerstehen kann. Das „till-ready-accompaniment“ des Klaviers ab Takt 177 (15:40) ist ein solcher unwiderstehlicher Vorschlag, und die mit der linken Hand des Klaviers parallel laufende Begleitfigur der Geige in Takt 133-136 (15:02) ist ein solches Folgeleisten.
Quelle Michael Maier: Violinsonate op.30 Nr.1 / in: Beethoven Interpretationen seiner Werke / Herausgegeben von Albrecht Riethmüller, Carl Dahlhaus, Alexander L. Ringer / Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt Band I / 1996 / Laaber Verlag Laaber 1994
Noch ein Wort zum gelegentlichen Vibratoverzicht (vor dem Hintergrund der jederzeit drohenden Vibrato-Exzesse. (folgt)
Dank an Klaus Giersch für den Hinweis auf Kristóf Baráti !