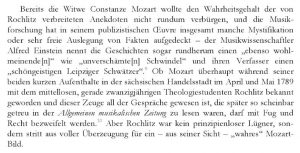Was Otto Jahn schon 1858 wusste
Vorbemerkung J.R.: Den folgenden Text habe ich im Wesentlichen unverändert aus der ganz unten angegebenen Quelle übernommen. Ich habe lediglich die Hinweise auf die originalen Seitenzahlen in Otto Jahns großer Mozart-Biographie entfernt und die Anmerkungen vom Internet gelöst; man darf sich also durchaus der Mühe unterziehen, jeweils ans Ende des Textes zu scrollen, oder sich von dort aus ganz zur Zeno-Wiedergabe ins Internet begeben. (Anmerkungen, die Rochlitz selbst dem fraglichen Mozartbrief beigefügt hat, erscheinen als A1, A2 etc.) Einige in Klammern gesetzte Seitenzahlen verweisen auf bestimmte Stellen in Otto Jahns großer Biographie und sind bei uns hier ohne Bedeutung. Mir ging es ja im übrigen nur um den bloßen Text, der im vorigen Blog-Artikel angesprochen wurde. Ich habe mir auch erlaubt, einzelne Passagen rot zu kennzeichnen.
 Friedrich Rochlitz (1820) nach Wikipedia
Friedrich Rochlitz (1820) nach Wikipedia
* * *
TEXT OTTO JAHN (1858)
Rochlitz machte im Jahre 1815 (A. M. Z. XII S. 561ff.) ein »Schreiben Mozarts an den Baron von …« bekannt, welchem er folgende Worte vorausschickte:
»Dies Schreiben scheint uns nicht nur sehr anziehend, sondern auch in mehr als einer Hinsicht merkwürdig; ja, wahrhaft lehrreich, und eben für den Verständigen am meisten. Einige Ausdrücke Mozarts werden wohl Manche mit feineren vertauscht, einige derbe Urtheile gemildert wünschen; wir meinen aber: so etwas muß mit diplomatischer Genauigkeit gedruckt werden, oder gar nicht; und das Letzte schien uns Verlust für einen der werthesten Theile unseres Publicums. Wer Anstoß nehmen will, nehme ihn an uns; nur nicht an der kindlich offenen, kindlich zutraulichen Seele Mozarts.«
An wen der Brief gerichtet sei wurde nicht angegeben; später (für Freunde der Tonkunst II S. 282) erwähnt Rochlitz den »vortrefflichen Brief Mozarts an den Baron v. P.« Zum Schluß bemerkt Rochlitz: »Der Brief ist ohne Datum, wahrscheinlich aber im Herbst 1790 von Prag aus geschrieben.« Diese Vermuthung kann nicht richtig sein, weil Mozart im Jahre 1790 nicht in Prag war.
So oft dieser Brief auch in deutscher und in fremder Sprache wieder gedruckt worden ist (1), so scheint doch immer der Abdruck in der A. M. Z. direct oder indirect zu Grunde zu liegen und Niemand das Original wieder gesehen zu haben (2), auch meine Nachforschungen nach demselben sind vergeblich gewesen (3). Dies ist um so mehr zu bedauern, da allein das Autograph über die gewichtigen Bedenken, welche sich gegen dieses Document erheben, endgültig entscheiden kann. Gegenüber den so bestimmten Aeußerungen Rochlitzs, welche auch nicht den Schatten eines Zweifels zuzulassen scheinen, ist es Pflicht die sich bei schärferer Betrachtung aufdrängenden Verstöße gegen sicher überlieferte Facta genauer nachzuweisen.
Zunächst folgt hier das ganze Schreiben mit Rochlitzs Anmerkungen.
»Hier erhalten Sie, lieber, guter Herr Baron, Ihre Partituren zurück; und wenn Sie von mir mehr Fenster (A1) als Noten finden, so werden Sie wohl aus der Folge abnehmen, warum das so gekommen ist. Die Gedanken haben mir in der Symphonie am besten gefallen. Sie würde aber doch die wenigste Wirkung machen, denn es ist zu vielerley drin, und hört sich stückweis an, wie, avec permission, ein Ameisenhaufen sich ansieht; ich meyne: es ist Eppes (A2) der Teufel los darinne. Sie dürfen mir darüber kein Schippchen machen (A3), bester Freund, sonst wollte ich zehntausendmal, daß ichs nicht so ehrlich herausgesagt hätte. Und wundern darf es Sie auch nicht; denn es gehet ungefähr allen so, die nicht schon als Buben vom maestro Knippse oder Donnerwetter geschmeckt haben, und es hernach mit dem Talente und der Lust allein zwingen wollen. Manche machen es halt ordentlich, aber dann sinds andrer Leute Gedanken (sie haben selber keine); Andere, die eigene haben, können sie nicht Herr werden. So geht es Ihnen. Nur um der heiligen Cäcilia willen, nicht böse, daß ich so herausplatze! Aber das Lied hat ein schönes Cantabile, und soll Ihnen das die liebe Fränzl recht oft vorsingen, was ich schon hören mögte, aber auch sehen. Der Menuetto im Quatuor nimmt sich auch sein aus, besonders von da, wo ich das Schwänzlein dazu gemalen. Coda wird aber mehr klappen als klingen. Sapienti sat, und auch dem nicht – Sapienti, da meyne ich mich, der ich über solche Dinge nicht wohl schreiben kann. Unser einer macht’s lieber. Ihren Brief hab ich vor Freude vielmal geküßt.«
»Ihren Brief habe ich vor Freuden vielmal geküßt. Nur hätten Sie mich nicht so sehr loben sollen. Hören kann ich so was allenfalls, wo man’s gewohnt wird; aber nicht gut lesen. Ihr habt mich zu lieb, ihr guten Menschen: ich bin das nicht werth und meine Sachen auch nicht. Und was soll ich denn sagen von Ihrem Präsent mein allerbester Herr Baron? Das kam wie ein Stern in dunkler Nacht, oder wie eine Blume im Winter, oder wie ein Glas Madeira bey verdorbenem Magen, oder – oder – Sie werden das schon selber ausfüllen. Gott weiß, wie ich mich manchmal placken und schinden muß, um das arme Leben zu gewinnen, und Männel (A4) will doch auch was haben. Wer Ihnen gesagt hat, daß ich faul würde, dem (ich bitte Sie herzlich, und ein Baron kann das schon thun) dem versetzen Sie aus Liebe ein paar tüchtige Watschen (A5). Ich wollte ja immer, immerfort arbeiten, dürfte ich nur immer solche Musik machen, wie ich will und kann, und wie ich mir selbst was daraus mache. So habe ich vor drey Wochen eine Symphonie fertig gemacht (A6), und mit der Morgenpost schreibe ich schon wieder an Hofmeister, und biete ihm drey Klavierquatuor (A7) an, wenn er Geld hat. O Gott wär ich ein großer Herr, so spräch ich: Mozart, schreibe du mir, aber was du willst und so gut du kannst; eher kriegst du keinen Kreuzer von mir, bis du was fertig hast, hernach aber kaufe ich dir jedes Manuskript ab, und sollst nicht damit umgehen wie ein Gratschelweib (A8). O Gott, wie mich das alles zwischendurch traurig macht, und dann wieder wild und grimmig, wo dann freylich manches geschieht, was nicht geschehen sollte. Sehen Sie, guter lieber Freund und Gönner, so ist es, und nicht wie Ihnen dumme oder böse Lumpen mögen gesagt haben.«
»Doch dieses a casa del diavolo, und nun komme ich auf den allerschwersten Punkt in Ihrem Brief, und den ich lieber gar fallen ließ, weil mir die Feder für so was nicht zu Willen ist. Aber ich will es doch versuchen, und sollten Sie nur was zu lachen darin finden. Wie nämlich meine Art ist beym Schreiben und Ausarbeiten von großen und derben Sachen nämlich? – Ich kann darüber wahrlich nicht mehr sagen als das; denn ich weiß selbst nicht mehr, und kann auf weiter nichts kommen. Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, oder nach guter Mahlzeit beym Spatzieren, und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Kopf und summe sie wol auch vor mich hin, wie mir Andere wenigstens gesagt haben. Halt‘ ich das nun fest, so kömmt mir bald Eins nach dem Andern bey, wozu so ein Brocken zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen, nach Contrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente etc. etc. etc. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da wird es immer größer; und ich breite es immer weiter und heller aus; und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich’s hernach mit Einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen, im Geist übersehe, und es auch gar nicht nacheinander wie es hernach kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das ist nun ein Schmauß! Alles das Finden und Machen geht in mir nur wie in einem schönstarken Traume vor: aber das ueberhören, so alles zusammen, ist doch das Beste. Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser Herr Gott geschenkt hat. Wenn ich nun hernach einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hinein gesammelt ist. Darum kömmt es hernach auch ziemlich schnell aufs Papier; denn es ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig und wird auch selten viel anders, als es vorher im Kopf gewesen ist. Darum kann ich mich auch beym Schreiben stören lassen; und mag um mich herum mancherley vorgehen: ich schreibe doch; kann auch dabey plaudern, nämlich von Hühnern und Gänsen, oder von Gretel und Bärbel u. dgl. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier annehmen, daß sie mozartisch sind, und nicht in der Manier irgend eines Andern: das wird halt eben so zugehen, wie, daß meine Nase eben so groß und herausgebogen, daß sie mozartisch und nicht wie bey andern Leuten geworden ist! Denn ich lege es nicht auf Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal näher zu beschreiben; es ist ja aber wol blos natürlich, daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch verschieden von einander aussehen, wie von aussen, so von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das Eine so wenig, als das Andere gegeben habe.«
»Damit lassen Sie mich aus (A9) für immer und ewig, bester Freund, und glauben Sie ja nicht, daß ich aus andern ursachen abbreche, als weil ich nichts weiter weiß. Sie, ein Gelehrter, bilden sich nicht ein, wie sauer mir schon das geworden ist. Andern Leuten würde ich gar nicht geantwortet haben, sondern gedacht: mutschi, buochi, quittle? Etsche malappe Mumming!« (A10)
»In Dresden ist es mir nicht besonders gegangen. Sie glauben da, sie hätten noch jetzt alles Gute, weil sie vor Zeiten manches Gute gehabt haben (A11). Ein paar gute Leutchen abgerechnet, wußte man von mir kaum was, außer daß ich zu Paris und London in der Kinderkappe Concert gespielt habe. Die Oper hab ich nicht gehört, da der Hof im Sommer auf dem Lande ist. In der Kirche ließ mich Naumann eine seiner Messen hören; sie war schön, rein geführt und brav, aber wie Ihr E. spricht ›ä Bißle kühlig (A12) etwa wie Hasse, aber ohne Hassens Feuer und mit neuerer Cantilena. Ich habe den Herrn viel vorgespielt, aber warm konnte ich ihnen nicht machen, und außer Wischi Wäschi (A13) haben sie mir kein Wort gesagt. Sie baten mich auch Orgel zu spielen. Es sind über die Maßen herrliche Instrumente da. Ich sagte, wie es wahr ist: ich sey auf der Orgel wenig geübt; ging aber doch mit ihnen zur Kirche. Da zeigte sichs, daß sie einen andern fremden Künstler in Petto hatten, dessen Instrument eben die Orgel war, und der mich tod spielen sollte. Ich kannte ihn nicht gleich, und er spielte sehr gut, aber ohne viel Originales und Phantasie. Da legte ichs auf diese an und nahm mich tüchtig zusammen. Hernach beschloß ich mit einer Doppelfuge, ganz streng, und langsam gespielt, damit ich auskam und sie mir auch genau durch alle Stimmen folgen konnten. Da war’s aus, und niemand wollte mehr dran. Der Häßler (A14) aber (das war der Fremde: er hat gute Sachen in des Hamburger Bach Manier geschrieben) der war der Treuherzigste von Allen, obgleich ich’s eigentlich ihm versetzt hatte. Er sprang vor Freuden herum, und paukte, und wollte mich immer küssen. Dann ließ er sichs bey mir im Gasthaus wohl seyn. Die Andern deprecirten aber, als ich sie freundlich bat, worauf der muntere Häßler nichts sagte, als: Tausendsapperment!«
»Hier, bester Freund und Gönner, ist das Blatt bald voll, die Flasche Ihres Weins, die heute reichen muß, bald leer; ich aber habe seit dem Anhaltungsbrief um meine Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen ungeheuer langen Brief geschrieben. Nichts vor ungut! Ich muß im Reden und Schreiben bleiben, wie ich bin, oder das Maul zuhalten und die Feder wegwerfen. Mein letztes Wort soll seyn: mein allerbester Freund, behalten Sie mich lieb. O Gott, könnte ich Ihnen doch nur einmal eine Freude machen, wie Sie mir gemacht. Nun, ich klinge mit mir selbst an: Vivat mein guter treuer …! Amen.«
Mit Recht hat dieser Brief viel Aufsehen und Interesse erregt (4); es mag manchem leid thun daß die Kritik daran zu rütteln findet, allein ihre Bedenken dürfen darum nicht unerledigt bleiben.
Die Zeit, wann der Brief geschrieben sein muß, läßt sich durch die Erwähnung des Dresdner Aufenthalts und des Wettkampfs mit Häßler bestimmen. Dieser fand am 15 April 1789 statt, wie wir aus Mozarts Brief an seine Frau wissen (S. 479); da der Brief des Aufenthalts in Dresden als einer Neuigkeit gedenkt, die den Freund zunächst interessirt, kann er nicht lange nachher geschrieben sein; man sollte denken noch während der Reise, denn des Aufenthalts in Leipzig und Berlin zu gedenken wäre dem theilnehmenden Freund gegenüber nicht weniger Veranlassung gewesen. Indessen mag er in Leipzig, Berlin, Prag oder erst nach der Rückkehr in Wien geschrieben sein, Juni 1789 bleibt wohl der späteste Termin. Jede Annahme aber verwickelt, wie wir sehen werden, in unauflösliche Schwierigkeiten. Was den Abschnitt über Dresden anlangt, so ist Mozarts Bericht über jenen Tag an seine Frau so genau, daß wir dadurch eine genügende Controle für den vorliegenden haben: er stimmt aber mit jenem gewiß authentischen in den wesentlichen Punkten nicht überein.
»Die Oper hab ich nicht gehört«, heißt es, »da der Hof im Sommer auf dem Lande ist.« Wir wissen aber nicht nur daß Mozart schon im April in Dresden war, sondern wir erfahren von ihm ausdrücklich, daß der Hof zugegen war, daß er bei Hof spielte, daß Oper war und daß er sie besuchte. Ferner, wie ganz anders beschreibt Mozart die Begegnung mit Häßler seiner Frau als sie hier dargestellt ist! Schon der äußere umstand stimmt nicht, daß Mozart zuerst spielte und Häßler dann erst auf vieles Zureden Lichnowskys sich auch hören ließ, während es mit offenbarer Absichtlichkeit dem Baron umgekehrt dargestellt wird. Die Hauptpointe dieser Erzählung, daß Häßler im Gegensatz der kühlen Dresdner die Leistungen Mozarts so freudig anerkannte und die beiden ehrlichen Künstlerseelen sich verstanden, verschweigt der Brief an die Frau nicht allein, sondern sie widerspricht ihm. Man sieht daraus, daß Mozart Häßler vorher nicht kannte – schwerlich wußte er daß »er gute Sachen in des Hamburger Bach Manier geschrieben hatte« –, sondern nach dem urtheilt, was dieser ihm vorspielte; dies geschieht streng und abweisend ohne daß von einem gegenseitigen Entgegenkommen die Rede wäre. Daß er darauf Häßler mit der übrigen Gesellschaft zu sich ins Gasthaus einlud und dieser, nachdem die andern deprecirt hatten, es sich allein bei ihm wohl sein ließ – das kann wohl nicht richtig sein. Denn er schreibt ja seiner Frau, daß sie aus der Kirche zum russischen Gesandten, darauf in die Oper gingen und daß dann noch Neumanns mit der Duschek bei ihm waren. ueberhaupt die Leute, denen er mit seinem Spiel nicht warm machen konnte, die ihm nur Wischi Wäschi sagten und endlich seine Gäste zu sein refusirten, wer waren sie denn? Wir sehen es aus dem Brief an die Frau: es waren Neumanns, »die herrlichen Leute«, seine alte Freundin Duschek, sein Gönner und Schüler Lichnowsky, der russische Gesandte, der ihm alle Ehre erwies, und Naumann, der ihm allerdings nicht grade gewogen war – also kein Publicum, wie jene Darstellung es voraussetzt.
Es ist aus dem Bemerkten klar daß der Bericht über den Aufenthalt in Dresden und das Zusammentreffen mit Häßler in dem Brief an Baron P. so nicht von Mozart herrühren kann. Offenbar ist er der ersonnenen Pointe zu Liebe aus halbwahren und unklaren Reminiscenzen zurecht gemacht, und gleicht darin aufs Haar den meisten Anekdoten und Charakterzügen, welche Rochlitz erzählt, denen gewiß immer etwas Wahres zu Grunde liegt, das aber durch ausgedachte psychologische Motivirung und auf ungenauen Erinnerungen beruhende Ausschmückung meistens zu einem unhistorischen Phantasiebild entstellt ist. Jene Begegnung mit Häßler machte ihrer Zeit Aufsehen und gewiß sprach Mozart in Leipzig davon, Rochlitz kannte sie aber auch aus Mozarts Brief an seine Frau. Diese theilte ihm nämlich alle Briefe ihres Mannes nach seinem Tode zum Behufe einer Biographie mit – wie aus ihrer Correspondenz mit Härtel sich ergiebt –; Rochlitz aber scheint dieselben nach flüchtiger Lecture zurückgeschickt zu haben und berichtete später nach unzuverlässigen Reminiscenzen.
Es finden sich aber der historischen Unrichtigkeiten noch mehr. um den Vorwurf der Trägheit abzuwehren heißt es: »So habe ich vor drei Wochen eine Symphonie fertig gemacht.« Allein die letzte Symphonie, welche Mozart geschrieben hat, die in C-dur mit der Fuge ist seinem eigenen Verzeichniß zufolge am 10 August 1788 componirt –; die in G-moll, an welche Rochlitz denkt, schon am 25 Juli 1788 –, Mozart konnte sich also in einem frühestens im April 1789 geschriebenen Brief so nicht ausdrücken. Oder sollte Jemand annehmen wollen, Mozart habe auf jener Reise eine Symphonie componirt, die er vergessen habe in sein Verzeichniß einzutragen, während er die Variationen über einen Menuett von Duport und die kleine Gique für Klavier richtig eingetragen hat, und die dann völlig verschollen wäre? Unglaublich!
Ebenso unerklärlich ist was unmittelbar darauf folgt: »Mit der Morgenpost schreibe ich schon wieder an Hoffmeister und biete ihm 3 Klavierquatuor an, wenn er Geld hat.« Rochlitz bemerkt dazu, nur das erste herrliche in G-moll sei bald darauf erschienen. Sonderbar; denn das konnte Rochlitz wissen, daß das Klavierquartett in G-moll im Juli 1785, das zweite inEs-dur im Juni 1786 componirt und beyde um dieselbe Zeit in Hoffmeisters Verlag erschienen waren. Freilich konnten diese dann in einem 1789 geschriebenen Briefe nicht als eben vollendete und Hoffmeister zum Druck erst anzubietende angeführt sein. Und daß Mozart später noch drey Klavierquartetts geschrieben habe, die wiederum nicht in seinem Verzeichniß aufgeführt und spurlos verschollen wären, das ist ganz unmöglich. Auch sonst ist noch zweierlei dabei auffällig. Erstens daß Mozart wegen der Quartetts an Hoffmeister schreiben will; er war also nicht in Wien, wo dieser damals wohnhaft war, sondern noch auf der Reise. Geschrieben waren die drei Quartetts unterwegs doch sicher nicht, sondern sie mußten vorher fertig gewesen sein, und da ist es gewiß auffallend daß Mozart, wenn er vor der Reise dies Geschäft nicht mehr abmachen konnte, nicht die kurze Zeit wartete bis er wieder in Wien war; daß ihn augenblickliche Verlegenheit nicht dazu veranlaßte kann man nachweisen, wenn auch diese Reise ihm keinen großen Vortheil brachte. Sodann ist der Zusatz »wenn er Geld hat« bedenklich. Denn Hoffmeister hatte Mozart jene Quartetts honorirt, war ihm auch schon in Verlegenheiten beigesprungen (S. 222) und im Jahre 1790 wiederum bereit ihm durch einen Vorschuß auf später zu liefernde Arbeiten aus der Noth zu helfen (S. 435); es ist daher nicht wahrscheinlich daß Mozart sich über ihn in dieser Art ausgedrückt habe. Kurz man sieht, daß jene Tradition von dem Verhältniß Hoffmeisters zu Mozarts Klavierquartetts (S. 222) hier zu einem bestimmten Zweck verwandt worden ist.
Schließlich wird noch ein geringfügiger Umstand zum Verräther. »Ich habe« heißt es »seit dem Anhaltungsbrief um meine Frau beym Schwiegerpapa kaum so einen ungeheuer langen Brief geschrieben.« Wir wissen aber daß Mozart um seine Frau weder mündlich noch schriftlich bei seinem Schwiegerpapa anhalten konnte, weil dieser todt war, als er sich mit Constanze verlobte. Aber dieser Schwiegerpapa spielt seine Rolle in dem Roman von Mozarts Verheirathung, den sich Rochlitz, wie wir sahen (S. 162ff.), ausgedacht hatte; und daher taucht er nun auch hier wieder auf.
Man steht (sieht ? JR) also daß sämmtliche Facta aus Mozarts Leben, welche in diesem Briefe berührt werden, durch den Widerspruch mit der sicher beglaubigten Ueberlieferung sich als unwahr oder entstellt ergeben, mithin von Mozart so nicht berichtet werden konnten. Dieser Umstand muß allerdings auch gegen den übrigen Inhalt des Briefes gewichtige Bedenken erregen, die dadurch noch verstärkt werden, daß derselbe in Stil und Ausdrucksweise offenbar nicht rein Mozartsch, sondern jedenfalls überarbeitet ist. Indessen möchte ich nicht behaupten daß der ganze Brief untergeschoben sei; wahrscheinlich war die Grundlage eines Mozartschen Briefes vorhanden, der etwas überarbeitet und durch Hinzufügen charakteristischer Züge, die für sicher beglaubigt galten, zu einem sprechenden Zeugniß ausgeprägt wurde. Bestimmt zu scheiden, was echt und ursprünglich, was geändert und zugesetzt sei, wird nicht möglich sein; unleugbar ist, daß der Brief, so wie er bekannt gemacht ist, nicht von Mozart geschrieben sein kann.
Fußnoten
(1) Um nur einiges anzuführen, so ist dieser Brief wiederum abgedruckt in der allg. Wiener Theaterzeitung 1824 N. 138, und im Jahr 1852 in demselben Journal, im Salzburger Correspondenten, in der Brünner Zeitung. In englischer Uebersetzung erschien derselbe im Harmonicon, Nov. 1825; in französischer im Journal général d’annonces d’obiets d’arts et de librairie, Juni 1826 N. 47, 49; worauf er in deutscher Rückübersetzung in einem deutschen Journal zu lesen war (vgl. Cäcilia V S. 224ff.).
(2) Daß dem Abdruck in der rheinischen Morgenzeitung Charis (1823 N. 59), nach welchem der in der Muse (1856 N. 61) veranstaltet ist, das Original zu Grunde liege ist durchaus unglaubhaft.
(3) Holmes berichtet zwar (p. 320) das Original des Briefes sei im Besitze des Prof. Moscheles, allein leider ist dies ein Irrthum, wie ich von Prof. Moscheles selbst erfahren habe.
(A1)»Kreuzweis ausgestrichene Stellen.« R.
(A2) »Ausdruck gemeiner Juden statt Etwas, in der Bedeutung von ein wenig, einigermaßen.« R.
(A3) »Wärterinnen bezeichnen so die saure Miene kleiner Kinder, die zum Weinen einzuleiten pflegt.« R.
(A4) »Scherzhafte Abkürzung von Konstanze, Mozarts Frau.« R. [Männel ist wohl Druckfehler für Stanzerl, Stännerl od. ähnl.]
(A5) »Ohrfeigen.« R.
(A6) »Es war, besinne ich mich recht, die, noch von Keinem übertroffene, aus G-moll.« R.
(A7) »Nur das erste von diesen ist bald darauf erschienen; es ist das herrliche, ebenfalls aus G-moll.« R.
(A8) »So lesen wir wenigstens das uns unbekannte Wort. Vorher fehlen einige Worte. Das Blatt ist eben da vom Siegel verletzt.« R.
(A9) »Entlassen Sie mich.« R.
(A10) »Eine Posse selbstgemachter, nichts bedeutender Wörter, die aber, scheint es, im Klange eine Art Antwort ausdrücken sollen; und, die Situation vorausgesetzt, wol auch gewissermaßen ausdrücken.« R.
(A11) »In Hinsicht auf Musik nämlich.« R.
(A12) »Ein wenig kühl.« R.
(A13) »Allgemeine Lobsprüche u. dgl.« R.
(A14) »Damals noch Musikdirector in Erfurt, seitdem in Moskau, bekanntlich vormals ein sehr ausgezeichneter Orgelspieler.« R.
(4) Zelter schrieb an Goethe (Briefw. III S. 470f.): »Du hast wohl in der Wiener Theaterzeitung einen Brief von Mozart gefunden, an einen lieben, guten Baron der Compositionen übersendet, Rath und Lehre sucht; eigentlich aber in alter Kürze das Geheimniß lernen will: wie man’s doch macht, so recht was Schönes in die Welt zu setzen? Der Brief ist ein goldner Brief und versichert mir meine alte Lehrart, daß man mit den jungen Kunstweisen gar nicht zu viele Umstände zu machen habe. Wer was Rechts wissen will wirds erfahren, und wer gewinnen will wird setzen. Mehr weiß ich auch nicht und lerne fleißig dazu.« Und Goethe sagte zu Eckermann (Gespr. I S. 261): »Ich habe dieser Tage einen Brief von Mozart gelesen, wo er einem Baron, der ihm Compositionen gesendet hatte, etwa Folgendes schreibt: Euch Dilettanten muß man schelten, denn es finden bei Euch gewöhnlich zwei Dinge Statt: entweder Ihr habt keine eigene Gedanken und da nehmt Ihr fremde; oder wenn Ihr eigene Gedanken habt, so wißt Ihr nicht damit umzugehen. – Ist das nicht himmlisch? und gilt dieses große Wort, was Mozart von der Musik sagt, nicht von allen übrigen Künsten?«
Quelle Otto Jahn: W.A. Mozart, Band 3, Leipzig, Breitkopf und Härtel 1858, Seite 1
Im Internet: HIER bzw. unter http://www.zeno.org/nid/2000775289X
Zu Otto Jahn siehe Wiki HIER. Zufall: heute – 16. Juni – ist sein 205. Geburtstag
Übrigens: eigentlich lässt Goethes von Jahn zitierte Äußerung gar nicht erkennen, dass er von dem inhaltlichen Teil redet, um dessentwillen der Brief Furore gemacht hat. (JR)
* * *
Ulrich Konrad über Friedrich Rochlitz & Mozart:
Empfehlenswert auch der MGG-Artikel über Friedrich Rochlitz, – wenn auch in Zeiten der „Alternative Facts“, die Trump eingeführt hat, kaum noch relativistisch lesbar; ich glaube nicht, dass es dieser Mittel der Popularisierung Mozarts und Beethovens um 1810 bedurfte:
Mit mehreren in der AmZ publizierten Serien von Mozart-Anekdoten trug Rochlitz wesentlich zur Popularisierung Mozarts bei und prägte zugleich für lange Zeit das Mozart-Bild. Daß die Anekdoten zum Teil seine eigenen Erfindungen waren (was im Grunde jedoch zum literarischen Genre gehört) und daß Rochlitz einen fiktiven Brief Mozarts als authentisch publizierte, führte schon zu seinen Lebzeiten zu Kritik. Dabei wurde übersehen, daß solche Publikationen nicht einem wissenschaftlichen Interesse dienten, sondern von Rochlitz primär dazu eingesetzt wurden, Mozart in den Rang eines Klassikers der Tonkunst zu heben. Rochlitz ist ebenfalls maßgeblich daran beteiligt gewesen, daß Beethoven in den neuen Kanon der musikalischen Klassiker aufgenommen wurde. Dazu setzte er seinerseits publizistische Mittel ein und nutzte andererseits seinen Einfluß auf die Programmgestaltung des Leipziger Gewandhauses.
Quelle MGG Personenteil Band 14 Bärenreiter Kassel etc 2005 Artikel Friedrich Rochlitz Sp. 237f Autor: Lothar Schmidt.
Noch einmal der Mozart-Forscher Ulrich Konrad mit einigen Sätzen aus seinem im wahrsten Sinne des Wortes grundlegenden Mozart-Artikel im MGG-Lexikon:
Die Frage nach Mozarts Schaffensweise ist seit dem frühen 19. Jahrhundert in nahezu ungebrochener Linie bis in die jüngste Vergangenheit hinein mit Rekurs auf wenige isolierte Aussagen des Komponisten, postume anekdotische berichte und fragwürdige Dokumente begegnet worden (geradezu verhängnisvoll: das dubiose, in der publizierten Form jedenfalls unechte „Schreiben Mozarts an den Baron von…„; BriefeGA IV, S.527-531). Danach schien festzustehen, daß Mozart (1.) allein im Kopf, ohne Zuhilfenahme eines Instrumentes oder schriftlicher Notizen, komponiert habe, daß (2.) auf diesem Weg ein Werk in der Vorstellung des Komponisten schnell, in einem quasi vegetativen Vorgang, zu seiner vollendeten Gestalt geformt und als solche unverlierbar im Gedächtnis gespeichert worden sei, und daß (3.) sich die Niederschrift der Kompositionen auf Notenpapier in einem nur mehr mechanischen Akt, von äußeren Umständen unbeeinflußbar, vollzogen habe. Diese Anschauung, befördert und befestigt vom zunehmend trivialisierten Genie-Kult und der historiographischen Konstellation, die dem beethovenschen Künstlertyp des um das Werk ringenden „génie de la raison“ die Gestalt eines seraphischen „génie de la nature“ (Georges Bizet, 31. Dez. 1858; Lettres de Georges Bizet, P.o.J. [1908], S.118) entgegengestellt hatte, dieser Anschauung mußten forschende Bemühungen um Gewohnheiten und Ordnungen in der ‚Werkstatt‘ des Komponisten abwegig erscheinen. Es ist aber bei rationaler Betrachtung des Sachverhalts schlechterdings unvorstellbar, daß Mozart seine kompositorische Tätigkeit nicht als Arbeit in Bewußtheit selbst bestimmt habe.
Quelle MGG Musik in Geschichte und Gegenwart (neu) Personenteil Band 12 MOZART Sp. 723 / Autor: Ulrich Konrad / Bärenreiter Kassel Basel London etc. 2004