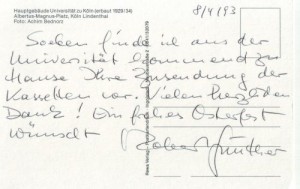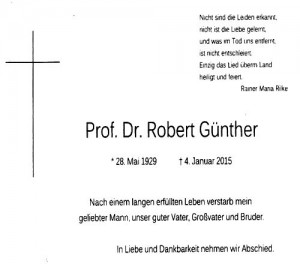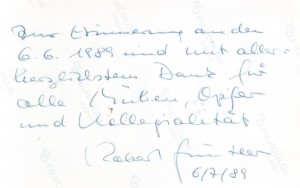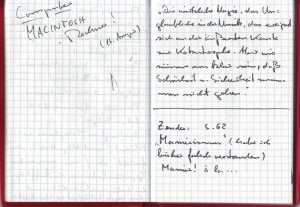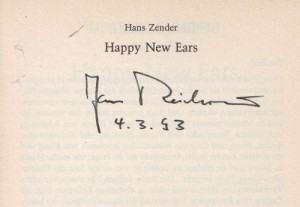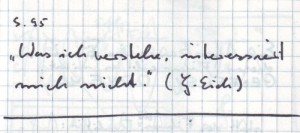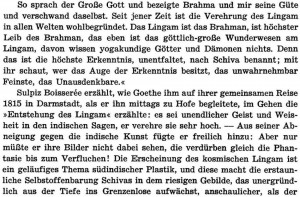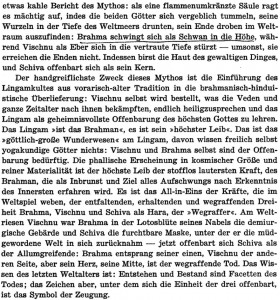Zwei Einleitungen
Handzettel zum Lesen bitte anklicken!
Es sind die Anfänge der beiden unten angekündigten Vorträge, die ich hier zum Nachlesen hinterlegen möchte, um sie an Ort und Stelle überspringen zu können; es genügt, nachher neugierig darauf zu sein. Der eine hat mehr mit Jerusalem und dem kulturellen Dilemma (oder Trilemma?) im Nahen Osten zu tun, der andere mit der Rolle der Vögel und „indischer“ Rhythmen in Messiaens Werk „Couleurs de la cité céleste“.
I
Man könnte meinen, das Bewusstsein der Alterität entstehe durch Entzweiung, durch Abtrennung des Anderen vom Eigenen, man triff eine Unterscheidung, sieht das Andere als Gegenüber, als Gegner, als Objekt, und schon hat man ein Problem. Simone de Beauvoir schrieb 1949 „Le deuxième sexe“, es wurde nie anders übersetzt als mit den Worten „Das andere Geschlecht“.
Und dann entdeckte man, dass das Andere im Eigenen steckt, selbst das Böse ist nicht außen, sondern in uns. Über Jahrhunderte wollte man lieber Gott allein in uns sehen, oder wenigstens auf der eigenen Oberfläche, auf uns als seinem Ebenbild.
West-östliche Weltgegensätzlichkeit, Denken in Ost und West, – man kam zum Beispiel nicht auf die Idee, den Süden einzubeziehen, ich glaube, Jan-Heinz Jahn war 1949 mit seinem Buch „Muntu – Umrisse einer neoafrikanischen Kultur“ der erste, der auch „die“ afrikanische Kultur als Komplex eigener Art behandelte, zwar auf zwei Komponenten aufbauend, jedoch nicht Ost und West, – der Osten spielt in diesem Buch keine Rolle -, sondern auf der europäischen und der traditionell-afrikanischen.
Ich spare mir an dieser Stelle weitere Ausführungen über theologische Trinität (und ihre Rolle bis in die Philosophie Hegels) oder über die umstrittene Realität der Heiligen Drei Könige, von denen angeblich einer schwarz war. (Die Bibel weiß davon nichts.) Die Rolle der Königin von Saba, – wer ist das weibliche Wesen, das in Monteverdis Marienvesper sagt: „Nigra sum sed formosa“. Oder nehmen wir Monteverdis „Combattimento die Tancredi e Clorinda“, textlich ein Ausschnitt aus Torquato Tassos „La Gerusalemme liberata“. Wenn Sie sich den Gesamtzusammenhang der Geschichte in diesem Epos anschauen, sehen Sie, was für eine Mühe sich der Dichter gegeben hat, aus der Frau, die auf sarazenischer Seite kämpfte (und Tancreds Geliebte war), um jeden Preis – jedenfalls auch um den Preis einer mit unglaubwürdigen Wundern durchsetzten Vorgeschichte – eine Weiße zu machen, obwohl sie aus äthiopischem Königshaus stammte und somit – dank der (schwarzen) koptischen Kirche – gewissermaßen von Geburt aus eine (wenn auch verhinderte) Christin war.
Es ist ein schwieriges philosophisches Umfeld. Mit Blick auf Rousseau, Kleist und Nietzsche sagte Rüdiger Safranski: „Die Verinnerlichung soll die bedrohliche Macht des Äußeren brechen. Das ‚Äußere‘ ist für Rousseau, Kleist und Nietzsche jeweils etwas anderes. Aber für alle drei ist es jene ‚Welt‘ dort draußen, in der sie sich mit ihren innerlichen Selbstverhältnissen gänzlich fremd fühlen.“ („Wieviel Wahrheit braucht der Mensch?“ 1993 Seite 86)
Heute, sagt der Philosoph Byung-Chul Han, gebürtiger Koreaner, in Berlin lebend, heute befinden wir uns in einer ganz anderen gesellschaftlichen Konstellation:
„Sie zeichnet sich durch das Verschwinden der Andersheit und Fremdheit aus. Die Andersheit ist die Grundkategorie der Immunologie. Jede Immunreaktion ist eine Reaktion auf die Andersheit. Heutzutage aber tritt an die Stelle der Andersheit die Differenz, die keine Immunreaktion hervorruft. Die postimmunologische, ja postmoderne Differenz macht nicht mehr krank. Auf der immunologischen Ebene ist sie das Gleiche. Der Differenz fehlt gleichsam der Stachel der Fremdheit, der eine heftige Immunreaktion auslösen würde. Auch die Fremdheit entschärft sich zu einer Konsumformel. Das Fremde weicht dem Exotischen. Der Tourist bereist es. Der Tourist oder der Konsument ist kein immunologisches Subjekt mehr.“ (Müdigkeitsgesellschaft 2010 Seite 9)
Ich glaube aber nicht, dass das Fremde dem Exotischen weicht. Es verlagert seinen Standort und ist nicht mehr deutlich identifizierbar. Es heißt dann Naivität, Banalität, Langeweile, Missverständnis, Schweigen. Und sowieso liegt der Fall ganz anders, wenn es um Musik geht: das Auge können Sie abwenden und wandern lassen, mit deutenden projizierenden Gedanken vermischen, das Ohr können Sie letztlich nur physisch außer Hörweite tragen. 5 – 10 Minuten funktioniert Ihr Exotismus vielleicht einwandfrei, dann aber nervt die reale Präsenz. Schwieriger wäre es vielleicht nur noch, eine Speise zu akzeptieren, die Sie ekelhaft finden. Toleranz genügt nicht: Sie sollen ja – unter dem bedrohlichen Blick der Gastfreundschaft – genießen!
II
Wenn Sie sich an Beethovens Fünfte erinnern und an die Zeiten, als über das Anfangsmotiv noch gesagt wurde, „so schlägt das Schicksal an die Pforte“, – hat es Sie da gestört oder gefreut zu erfahren: es war ein Meisenruf, der ihn inspiriert hat? Er hat nur eine winzige Veränderung vorgenommen: aus zi-zi-bä hat er zi-zi-zi-bä gemacht und eine Portion Pathos dazugegeben.
Angenommen es war so: hat es noch irgendeinen Sinn, an die Meise zu erinnern?
Glauben Sie, dass sich Beethoven an einen Bach setzen musste um zu wissen, wie man das Gemurmel in Töne fasst? Sie kennen die bekannte Zeichnung von Johann Peter Lyser, und die danach mit bunten Details angereicherte Schweizer Lithographie, Phantasiegebilde, Mythenbildung übrigens 30 Jahre nach der Komposition, ebenso wie Anton Schindlers Hinweis auf einen bestimmten Bach zwischen Nussdorf und Grinzing, von dem Beethoven erzählt habe:
„Hier habe ich die Szene am Bach geschrieben, und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert.“ Phantasiegebilde. Dank Händel, Gluck, u.a. wusste damals wohl jeder, welche musikalischen Elemente zu einer friedlichen Landschaft passen.
Wenn Sie beliebige Bemerkungen von Olivier Messiaen zum Vogelgesang lesen, wissen Sie: er meint es ernst, er meint es geradezu ornithologisch. Und letztlich ist es diese Haltung, die ihn im Kontext der Neuen Musik diskutabel machte. Sagen wir: die gründliche Methodik, die hinter die bloß abbildbare Erscheinung zu führen schien. Um das rein Illustrative konnte es nicht gehen. Sagen wir – so wie in Ottorino Respighis „Pini di Roma“, deren dritter Satz überschrieben ist: I Pini del Gianicolo. Ich zitiere: „Ein Zittern geht durch die Luft: in klarer Vollmondnacht wiegen sanft ihre Wipfel die Pinien des Janiculums. In den Zweigen singt eine Nachtigall.“ Und dazu verlangte er die Schallplatte Nr. 6105 der Firma Deutsche Grammophon „Il canto dell‘ usignolo“. Ich vermute, dass den meisten von uns dabei unbehaglich zumute wird; man verlangt nach Kunst oder der reinen unvermischten Natur. Man kann sich auch vorstellen, ein Touristikunternehmen führt Sie im Spätherbst durch die Herrenhäuser Gärten und lässt aus allen Büschen per Lautsprecher Nachtigallen tönen. (Wie Fahrstuhlmusik in Tokioter Hotel-Giganten.) Aber auch wenn die Jahreszeit stimmen würde, wäre es noch längst nicht das, was uns Natur unmittelbar zu sagen hätte. Paul Valéry meinte: „Keine Anschauung ist naiver als diejenige, die alle dreißig Jahre zur Entdeckung der Natur führt. Es gibt keine Natur.“
Es heißt, die literarische Moderne begann in Frankreich mit einer „durch den Siegeszug von Technik und Naturwissenschaft verursachten ‚Abwertung des Natürlichen‘ zugunsten einer ästhetischen Aufwertung des Artifiziellen. Charles Baudelaire hatte seine „Fleurs du Mal“, die ihm ein Gerichtsverfahren wegen Verletzung der öffentlichen Moral einbrachten, noch nicht herausgebracht, als er Ende 1853 einen provokativen Brief an den Schriftsteller und Kunstkritiker Fernand Desnoyers schrieb:
„Mein lieber Desnoyers, Sie erbitten sich Verse für ihren kleinen Band, Verse über die Natur, nicht wahr? Über die Wälder, die großen Eichen, das Grün, die Insekten, – über die Sonne gewiß auch? Aber Sie wissen doch, daß ich unfähig bin, mich an pflanzlichen Gewächsen zu erbauen und daß meine Seele gegen die merkwürdige neue Religion revoltiert, die – wie mir scheint – für jedes spirituelle Wesen immer etwas Schockierendes hat. Ich werde niemals glauben, daß ‚die Seele der Götter in den Pflanzen wohnt‘, und selbst wenn sie dort wohnte, würde mich das nicht sonderlich beeindrucken und würde ich meine eigene Religion als ein höheres Gut schätzen als die der geheiligten Gemüse. Ich habe vielmehr immer gedacht, daß die blühende und sich erneuernde Natur etwas Schamloses und Widerwärtiges an sich habe.“ (Nach Roland Schmenner „Pastorale“ 1998 , dieser nach Hans Robert Jauß “Kunst als Anti-Natur“ 1989 S.133-154 s.a. )
Es ist wahrscheinlich, dass Baudelaire hier gegen eine Haltung polemisiert, – eine „neue Religion“ wie er sagt – , die heute niemand im Ernst proklamieren oder verteidigen will, [vor allem nicht in den Grenzen der Neuen Musik].
Um es ganz genau zu wissen, habe ich seit den 90er Jahren immer wieder versucht, das grundlegende Buch „Eine Ästhetik der Natur“ (1991) von Martin Seel zu Rate zu ziehen, der allerdings auch sofort den Gegenstand an sich in Frage stellt: „die Natur“ – was ist das denn? Oder – anders gefragt: „Die Natur als Gegenstand ästhetischer Wahrnehmung“ – können wir das leichter definieren? Seel: „Ihr Gegenstand ist derjenige sinnlich wahrnehmbare Bereich der lebensweltlichen Wirklichkeit des Menschen, der ohne sein beständiges Zutun entstanden ist und entsteht.“ (Seite 20)
Ich will die grundsätzlichen Erörterungen nicht weiter ausbreiten, nur dies noch: Drei Aspekte hebt Seels Bestimmung hervor: „erstens die dynamische Eigenmächtigkeit, zweitens die sinnliche Wahrnehmbarkeit, drittens die lebensweltliche Anwesenheit der Natur.“ Und nun arbeitet Seel alle Bereiche ab, „Natur als Raum der Kontemplation“, „Natur als korrespondierender Ort“, „Natur als Schauplatz der Imagination“ undsoweiter, – irgendwann frage ich: wo ist die akustische Natur repräsentiert, von der man nicht unbedingt Abstand gewinnen kann, wie von visuellen Gegebenheiten? Ich meine nicht das Rauschen des Meeres oder den Wind in den Zweigen. Seel ist sich natürlich bewusst, dass man die Natur nicht nur wie durch ein Fenster als Bild betrachten kann. „Auch müssen es gar nicht Werke der Malerei sein, deren Kunst die scheinbare Kunst der Seelandschaft zum Vorschein bringt. Erneut kann ich das Fenster öffnen – und diesmal ein aus Naturlauten (und den von den Terrassen der Mensa herklingenden) menschlichen Stimmen komponiertes Hörspiel vernehmen oder aber, bei kühlerem Wetter und anderer Windrichtung, mich in das Außengeräusch versenken als wäre es meditative Musik.“ (Seite 235)
Dies ist fast das einzige Mal, wo diese Laute, die für Messiaen ALLES bedeuten, in Seels Theorie eine Rolle spielen. Zweimal ist von einem Vogellaut die Rede, auf Seite 248 am Beispiel eines Satzes von Peter Handke:
„Für einen Augenblick kann es sein, als sei dieser Himmel sogar das Lebens-feindliche hier, so sehr, daß der winzige Vogel, kaum fingerkuppengroß, der jetzt aus dem Gestrüpp in die Höhe schießt, auf der Stelle, angstquiekend, kopfüber, zurück in sein Obdach taucht.“ (Handke Die Abwesenheit 1987, 129)
Das andere Mal, auf Seite 203 verweist Seel auf die Atmosphäre um eine blühende Hecke bei Marcel Proust: „Inmitten der von leiser Komik durchwirkten, von züngelnder Unfaßlichkeit bedrohten, von melancholischer Erinnerung wachgehaltenen Idylle ertönt plötzlich der Laut eines Vogels, der seine Stimme bei Proust wie bei Handke vergeblich gegen die Leere des Pascalschen Raumes erhebt: ‚In halber Höhe eines nicht zu ermittelnden Baumes war ein unsichtbarer Vogel bemüht, sich den Tag zu verkürzen; mit einem lang angehaltenen Ton versuchte er die Einsamkeit auszuloten, aber er erhielt eine so klare Antwort, eine Resonanz aus nichts als Schweigen und tiefer Ruhe, daß es schien, als hielte er nun für immer den Augenblick fest, den er eben noch versucht hatte, schnell zum Enteilen zu bringen.‘
Die Stimme des unsichtbaren Vogels bringt in der vorwiegend schönen Einheit der Natur jene Raumunsicherheit zur Geltung, die das Kennzeichen einer vorwiegend erhabenen Gesamtnatur ist.“ …konstatiert Martin Seel.
(Seel Seite 203, Proust Combrai 1967,184)
Um es kurz zu machen: das ist zu wenig! Ich finde nur noch eine Fußnote, die in Richtung des Problems weist, das Messiaens Vogelmusik betrifft. Martin Seel spricht über die „Heiterkeit“ einer Seenlandschaft und weiß natürlich, dass die Landschaft kein heiter gestimmtes Subjekt ist, also fügt er hinzu: „Trotzdem können einzelne Naturgegenstände so wahrgenommen werden, als ob sie ‚Charaktere‘ im engeren Sinne wären. Aber diese Wahrnehmung ist nur eine unter anderen Formen der Korrespondenz und keine, die konstitutiv für sie wäre. Ihr Gegebensein ist nicht an die Fiktion einer kommunikativen Beziehung zur Natur gebunden.“
Ich will das gar nicht im Detail interpretieren, bemerkenswert, dass der Einwand, den ich bringen würde, nur in einer Fußnote berührt wird: die Tiere nämlich, – er räumt ein: dass „das kommunikative Verhältnis zu Tieren nicht notwendigerweise eine Fiktion ist. Wir können mit Tieren in einer ganz unmetaphorischen (allerdings der zwischenmenschlichen Verständigung gegenüber abkünftigen) Bedeutung kommunizieren – freilich nur mit denen, die mit uns leben.“ (Seel Anm.37 S.118f)
Ein Satz, der ganz und gar nicht einleuchten muss. Von der Kommunikation mit Tieren ist die Rede – und zwar im nicht metaphorischen Sinn -, sie sei von der zwischenmenschlichen Verständigung ableitbar bzw. rückgeschlossen (das ist offenbar mit dem Wort „abkünftig“ gemeint). Und dann folgt die äußerst merkwürdige Einschränkung: „freilich nur mit denen [also Kommunikation nur mit den Tieren], die mit uns leben“. Sind jetzt nur Haustiere gemeint, mit denen wir kommunikativ abgestimmt sind? Nicht aber die draußen im Baum singende Schwarzdrossel, deren Kommunikation ich zweifelsfrei erkenne, wenn sie auch nicht mir persönlich gilt, sondern Wesen ihresgleichen?
Verschiedene Zeitungen berichteten kürzlich (12.12.2014) über die Ergebnisse eines international koordinierten Forschungsunternehmens. Ich zitiere die Süddeutsche:
Ausgangspunkt für das genetische Riesenprojekt war die Frage, welche Gene Vögel brauchen, um singen zu lernen. Eine der großen Überraschungen ist nun die Erkenntnis, dass sich der Gesang wohl gleich dreimal in den verschiedenen Entwicklungslinien der Singvögel, der Kolibris und der Papageien ausgebildet hat. Die dafür zuständigen Gene sorgen beim Menschen für das Sprachvermögen und könnten auch bei anderen Tieren an unterschiedlichen Lernvorgängen beteiligt sein. Bislang war bereits klar, dass sich auch die Hirnstrukturen, die für das Singen bei Vögeln und das Sprechen beim Menschen zuständig sind, stark ähneln. Eine weitere Studie zeigt zudem, dass das Singen einen steuernden Einfluss auf 10 Prozent der Vogelgene hat – und liefert damit einen Hinweis darauf, wie das Verhalten eines Tieres und seine Erbanlage sich gegenseitig beeinflussen können.
Aber ich will nicht versuchen, die möglichen Folgerungen zu durchdenken, nur soviel, dass der Graben zwischen Mensch und Tier, den die Philosophie und die Theologie zwischen Mensch und Tier sieht, sich zunehmend abflacht, wenn man die moderne Evolutionswissenschaft und – sagen wir – unsere ’natürliche‘ Empathie ernst nimmt. (Marian Stamp Dawkins: Die Entdeckung des tierischen Bewusstseins, 1994).
Ich bin hier nicht zur Verteidigung der Natur und der Tiere angetreten. Sondern im Zeichen des Vogelfreundes und Komponisten Olivier Messiaen.
(Irreführende) Darstellung Beethovens bei der Komposition der Pastorale; Lithographie aus dem Zürcher Almanach der Musikgesellschaft, 1834 (hier nach Wikipedia)
Zu den Abbildungen ganz oben: Titelfoto „Himmlisches Jerusalem“, Kirchenfenster in St. Michael Marl, Entwurf: Trude Dinnendahl-Benning, Foto: Hubert Decker
Vorgespräch mit Prof. Walter Nußbaum

Tragetasche einer unbekannten Zuhörerin
Einstimmung auf Messiaens Vogelstimmen
Fotos: E.Reichow