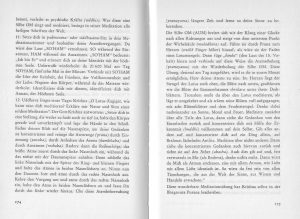Übungen + Gedanken
Folgender Artikel in der ZEIT 27. Januar 2022 Seite 34f
Wie hält man das aus? Vier Leistungssportler und Profimusiker sprechen über Druck, ihre Ängste und mentale Stärke (ZEIT-Interview: Christiane Grefe, Stefanie Kara)
(Musik: Andre Schoch, 34, Trompeter Berliner Philharmoniker / Tabea Zimmermann, 55, Bratschistin)
Was machen Sie, wenn die Anspannung vor einem Spiel zu groß wird?
THOLE (Beachvolley): Mir helfen Bewegung und Atmung. Beim Aufwärmen bewege ich zum Beispiel meine Beine richtig schnell, in ganz kleinen Schritten, das verringert meine Nervosität. Und ich atme besonders tief, um in der Brust nicht fest zu werden. Für einenTrompeter wie Sie, Herr Schoch, muss Nervosität ja die absolute Katastrophe sein!
SCHOCH: Die Atmung ist für mein Spiel natürlich extrem wichtig. Ich kann sie aber auch nutzen, um mit Nervosität zu umzugehen. Für die Kondition mache ich ohnehin regelmäßig Ausgleichssport… ZIMMERMANN: Ich glaube, ich bin die Einzige in diesem Raum, die keinen Sport treibt. SCHOCH:…und vor dem Konzert mache ich gezielte Atemübungen, um eine bessere Körperkontrolle zu entwickeln und ein bisschen herunterzukommen. Die kann keiner sehen. ZIMMERMANN: Wie gehen die? Schoch: Ich atme zum Beispiel ganz simpel länger aus. Acht Schläge aus, vier Schläge ein, durch die Nase. Nach einer Weile beruhigt mich das. BREMER (25) Fußballerin: Das habe ich früher auch gemacht, als ich vor dem Spiel noch nervöser war. ZEIT: Kann sich der Büromensch davon etwas abgucken, wenn er zum Beispiel vor einer Präsentation aufgeregt ist? THOLE: Auf jeden Fall! Durch solche Atemtechniken verändert sich sofort etwas. Zum Beispiel bei hoher Anspannung kurz die Schultern hochziehen und dann fallen lassen. Das ist eine Blitzversion der progressiven Muskelentspannung, das ist so eine Entspannungstechnik. Mir hilft das, den Muskeltonus runterzufahren. BREMER: Ich glaube, bei einer Präsentation oder einem Referat an der Uni kommt es genauso wie bei einem großen Spiel darauf an, bei sich zu bleiben; also nicht auf das Außen, auf die Leute zu schauen, sondern seinen eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Wir machen zum Beispiel Meditationsübungen, um diese innere Stärke zu entwickeln. ZIMMERMANN: Bei Musikern finde ich es problematisch, wenn sie »ganz bei sich« sind. Wenn ich als Erstes an mich denke, hat der arme Beethoven schon verloren. Ich sage meinen Studenten deshalb: Lenk dich ab, indem du das tust, was du zu tun hast – nämlich das Stück spielen. Übrigens finde ich, dass auch Routine ein wichtiges Werkzeug für mentale Stärke ist, vor allem am Konzerttag. (…) Früh aufstehen, gut frühstücken, viel spielen. Mittags schlafen. Dann diese eine Stunde Einspielzeit vor dem Konzert, die ist absolut heilig. Da arbeite ich ein Werk rückwärts durch. Letzte Seite, vorletzte Seite … So wie ein Chirurg sein Operationsbesteck bereitlegt. Das alles hilft, nicht daran zu denken, was bei dem Stück schon mal schiefgelaufen ist. Solche Gedanken sollte man absolut vermeiden. THOLE: Das kriegen Sie hin? Wenn ich versuche, nicht an etwas zu denken, geht es erst richtig los! ZIMMERMANN: Ich weiß genau, was Sie meinen! Es gab Phasen in meinem Leben, da fand ich schon den Gang von der Bühnentür zu meiner Position vor dem Orchester so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich stolpere. Es gibt ja tausend Sachen, die passieren können: Die Saite kann reißen oder der Bogen zittern, besonders wenn man einen langen Ton ganz, ganz leise spielen soll. Da fühlt man sich, als müsse man auf einem dünnen Faden in hundert Metern Höhe laufen. Womöglich ist es auch noch ein Livemitschnitt, und man weiß: Das Mikrofon verzeiht nicht mal den kleinsten Kratzer. Mittlerweile habe ich gelernt, in solchen Situationen kurz die Augen zu schließen und mir ein gelungenes Konzert vorzustellen. Das gibt ein gutes Bühnengefühl. SCHOCH: Mir hilft es, am Konzerttag alles was langsamer anzugehen und Hektik zu vermeiden. Wenn mir der Erwartungsdruck trotzdem zu viel wird, suche ich mir im Publikum eine Person und denke mir: Für sie will ich jetzt ein schönes Konzert spielen. …
ZIMMERMANN: Ich gehe davon aus, dass jeder seine Ängste und schwachen Momente hat. Wir haben in der Musik aber noch eine Herausforderung, die ihr im Sport überhaupt nicht kennt. THOLE: Welche denn? ZIMMERMANN: Wir müssen ganz anders mit Gefühlen umgehen und von einer Minute auf die andere Fröhlichkeit, Trauer oder Verspieltheit ausdrücken. Es erfordert große mentale Stärke, den besonderen Ausdruck des Werkes mit seinen persönlichen Gefühlen in Einklang zu bringen, während man zugleich mit handwerklichen Problemen zu tun hat. ZEIT: Und was macht man mit seinen eigenen Gefühlen? Kann man zum Beispiel seine Freude zeigen, wenn etwas gelingt? Das könnte einem ja auch mentale Kraft geben, ein gutes Gefühl fürs nächste Mal. ZIMMERMANN: Ein tolles Konzert muss schon nachklingen können, vielleicht bei einem Bier mit Kollegen oder Freunden. Aber jubeln? BREMER: Also, mir hilft das Jubeln nach einem Tor schon, mentale Stärke aufzubauen, gerade mit dem Team. ZEIT: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schoch? Ein gelungenes Solo im Orchestere ist ja ein bisschen wie ein Tor, aber Sie können sich dann nicht das Smokinghemd vom Leib reißen und feiern. SCHOCH: Natürlich freut ich man sich. Nur: Wenn man eine Stelle gut gespielt hat, kommt gleich die nächste. Ich versuche lieber, in der Musik zu bleiben.
THOLE: Wir nutzen Gefühle sogar bewusst, wenn wir Probleme im Spiel haben. Wir jubeln dann absichtlich über Kleinigkeiten, um uns aus dem Tief rauszuholen. ZEIT: Wird man eigentlich mental stärker, wenn man älter wird? SCHOCH (34): Schon, wenn man mehr Erfahrung hat, kann man mit bestimmten Erfahrungen besser umgehen. ZIMMERMANN (55): Für mich werden jetzt verschiedene Dinge körperlich schwerer. Das kann auch auf die Psyche drücken. ZEIT: Als Laie denkt man bei Musikern nie so recht an körperliche Probleme… ZIMMERMANN: Oh – das ist das, was mich jeden Tag stundenlang beschäftigt: Nacken, Arme und Hände beweglich zu halten! Um diese feinsten Nuancen spielen zu können.
Nachwort (JR)
Die Aussage Tabea Zimmermanns über Gefühle könnte zu der Fehleinschätzung veranlassen, dass man als Musiker fortwährend die in der Musik ausgedrückten Gefühle auch wirklich empfinden müsse. Das ist leicht gesagt, aber unmöglich zu realisieren, wäre auch nicht einmal im Blick auf „Realismus“ wünschenswert. Z.B. eigene Todesangst, Schmerz über das Sterben eines Kindes, Ekstase beim Anblick einer entsprechenden Rodin-Plastik: natürlich ist nicht die Realisierung eines solchen Gefühls verlangt, noch weniger die Simulation: ich muss nur wissen, wie das reale Gefühl „sich anfühlt“, um es ausdrücken zu können. Nein: einfließen zu lassen. Ich kann das leidende Gesicht einer Pianistin missverstehen, indem ich glaube, dass sie wirklich leidet. Ich konzediere aber, dass sie dieses Gesicht annimmt, weil sie sich das Gefühl vorstellt, vorstellen will, und dazu gehört es, dass sie die Miene, die gestische Form des Ausdrucks mimetisch nachbildet, wobei die reale Imagination sich unwillkürlich einstellt bzw. hinzugesellt.
Es ist nicht anders bei einem Komponisten wie Bach, der die „Erbarme dich“-Arie schreiben will und wenig später „Gebt mir meinen Jesum wieder“: er liest den Text und kennt die dem entspechenden Affekte, die Ausdrucksmittel. Er muss nicht weinen oder rasen, er muss wissen wissen, wie das ist. Selbst wer einen Betrunkenen auf der Bühne darstellen will, darf nicht betrunken sein. Ich habe einen Fehlgriff des großen Sängers (und Darstellers) Fischer-Dieskau in Erinnerung, wenn er in Haydns Jahreszeiten das Wort „fahl“ mit irgendwie hohler Stimme intoniert, es ist und bleibt aber – nur das Wort, ein Symbol, nicht das Symbolisierte selbst.
Ich denke an das „Paradox des Schauspielers“, schaue auch nach, wo ich es selbst zu verstehen gelernt habe (glaube gelernt zu haben): hier.
Und noch zwei Rückblenden, die mit Gefühl und – Atmen zu tun haben: hier und hier.