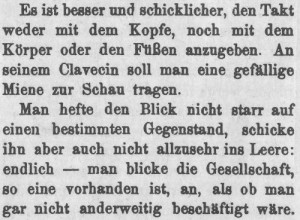Musik – Bühne – Film
Kürzlich las ich ein Interview mit dem Regisseur François Ozon und es geriet einiges in Bewegung: was sind die Gefühle des Künstlers, wenn er eine Rolle spielt? Im Film ganz anders als auf der Bühne? Spielt er auch Rollen, wenn er am Klavier sitzt? Oder – geigend – die Augen schließt? Auch unglaubwürdig schnell wechselnde Gefühle nach Maßgabe des Komponisten? Wie sehr muss er übertreiben, damit es alle merken? Oder soll er lieber zeigen, dass er den äußeren Ausdruck der Gefühle nur „abruft“? Man will keinen Schauspieler, sondern einen Menschen sehen, der sich erinnert. Wie? Ist denn Schauspieler zu sein ehrenrührig? Nein, aber ein Musiker „spielt“ auf einer anderen Ebene; es passt zu ihm, dass er cool bleibt, während er Leidenschaften entfesselt. Aber bei wem? Darf man auch als Zeuge seiner Entfesselungskünste – betont cool bleiben?
Man lacht, wenn man sich die Situation vorstellt. Aber ich habe das bei Friedrich Gulda erlebt: er spielte Mozarts A-dur-Sonate in vollkommener Weise, und er schaute dabei ins Publikum: von einem zum andern, mit unbeweglicher Miene, man fühlte sich als Einzelner persönlich gemeint (oder sogar geprüft) , vielleicht weniger von ihm als vom Kunstwerk. „Du musst dein Leben ändern.“
Was ist Leben, was ist Fiktion? Was Wunschdenken? Was Scharlatanerie?
François Ozon wurde gefragt, ob er die Vermischung von Realität und Fiktion auch im wahren Leben schon einmal erlebt habe:
Ja, bei den Dreharbeiten für einen meiner ersten Filme, einen Kurzfilm, ist etwas sehr Dramatisches passiert. Eine der Schauspielerinnen durchlebte eine heftige Krise. Sie verletzte sich während der Dreharbeiten selbst, sie drehte wirklich durch, beschmierte die Wände mit ihrem Blut und kritzelte damit herum. Sie spielte in dem Film eine Frau, die jemanden umbringt, und plötzlich wurde mir klar, dass ich sie als Regisseur so gut auf ihre Rolle vorbereitet und die Geschichte so gut entwickelt hatte, dass sie selbst glaubte, dieser Charakter zu sein. Das machte mir sehr, sehr große Angst.
Quelle Zeitmagazin Nr. 13 26. März 2015 (letzte Seite) „Das war meine Rettung.“ Als eine Schauspielerin durchdrehte, wurde Regisseur François Ozon zu ihrem Psychologen. (Interview: Louis Lewitan)
Soll ich das glauben? Der Regisseur betont auffälligerweise, dass er seine Sache vorher „so gut“ gemacht habe. So gut, dass die Frau nicht mehr weiß, dass sie spielt? An dieser Stelle fing ich an zu begreifen, dass es offenbar einen Riesenunterschied gibt zwischen Theater und Leben, Bühne und Film.
Ich stoße auf folgendes Zitat von Richard Blank („Schauspielkunst in Theater und Film“ Berlin 2001):
Der Alltag ist nicht die Bühne, nicht der Film, und wie verhält sich die Person in diesen Bereichen, die nicht identisch sind? Was ist ‚eine Person als Ganzes‘? Marianne Hoppe machte mich auf einen Aspekt aufmerksam, den ich vorher nicht bedacht hatte. Die Hoppe ist außerordentlich klar im Kopf, hat ein umfangreiches intellektuelles Wissen und die seltene Gabe einer exakten, kühlen Selbsteinschätzung. Als Hannelore Schroth 1987 gestorben war, versuchte ich Marianne Hoppe für eine Rolle zu gewinnen. Sie hat mit fortschreitendem Alter nur noch wenig gedreht und galt als sehr wählerisch. Sie kam in mein Haus, um sich fünf Stunden lang meine Filme mit ihrer verstorbenen Kollegin anzuschauen. Dann sagte sie: „Ich mache die Rolle, okay.“ Als ich mein Entzücken äußerte, unterbrach sie mich: „Aber glauben Sie nicht, dass ich das leisten kann, was die Schroth da bei Ihnen macht!“ Ich war verblüfft. Etwas ratlos erinnerte ich sie daran, dass sie immerhin als die bedeutendste deutsche Schauspielerin der Nachkriegszeit gelte. Sie schien das überhört zu haben, dachte eine Weile nach und sagte dann: „Sie müssen in Ihrem Buch etwas ändern. Streichen Sie alles, wo ich deprimiert oder traurig sein soll!“ Ich glaubte, mich verhört zu haben und antwortete nichts. „Ich kann es nicht“, sagte sie. „Aber gnädige Frau, Sie haben unter Gründgens, in Düsseldorf, auf der Bühne …“ „Die Bühne“, unterbrach sie, „hat nichts mit Film zu tun, rein gar nichts! Auf der Bühne kann ich allerhand darstellen, deklamieren, spielen – aber Film!, da merken Sie doch zumindest bei jeder Großaufnahme, ob einer etwas vortäuscht oder nicht! Im Film muss ich das, was ich spiele, immer auch sein.“ Mir verschlug es die Sprache, und als ich nichts sagte, insistierte sie: „Ich bin weder traurig noch deprimiert. Das mag ein Mangel sein oder ein Tick, aber ich bin es nicht, niemals, basta!“ Ihr Geständnis der Unvollkommenheit war für mich wie eine Offenbarung.
Und ich erinnere mich an einen Text, den ich neuerdings einmal im Zusammenhang mit Diderots Schrift „Paradox über den Schauspieler“ abgeschrieben habe. Ich kannte ihn seit meiner Schulzeit, und zwar aus dem „Deutschen Lesebuch“ (Walter Killy 1958): „Der beseelte und der psychologische Mensch“ von Paul Kornfeld, geschrieben 1918. (Da spielte der Film also noch keine Rolle.) Es ist nirgendwo ersichtlich, ob Kornfeld sich auf den Diderot-Essay bezog; mir war er damals, als ich Kornfeld zum erstenmal las, ohnehin nicht bekannt. (Heute ist das Paradox des Schauspielers für mich ein Fass ohne Boden geworden.)
Der Mensch des Dramas, wie der jeder Kunst, und wie alle Kunst, ist, losgelöst von den Bedingungen der Wirklichkeit und von allen Beschränkungen, Hemmungen und Zufälligkeiten, in Parallelität zu seinem Wesen und Inhalt, pathetisch, und Schauspieler, die Dramengestalten so darstellen, wie diese wären, wenn sie unserem Leben angehören würden, spielen nicht Theater und stellen nicht Kunst dar, sondern verstellen sich nur. Dem Menschen nachzumachen, genügt nicht, um den Menschen darzustellen. So befreie sich also der Schauspieler von der Wirklichkeit und abstrahiere von den Attributen der Realität und sei nichts als der Vertreter des Gedankens, Gefühls oder Schicksals! Muss er auf der Bühne sterben, so gehe er nicht vorher ins Krankenhaus, um sterben zu lernen, und nicht in die Kneipe, um zu sehen, wie man’s macht, wenn man betrunken ist. Er wage es, groß die Arme auszubreiten und an einer sich aufschwingenden Stelle so zu sprechen, wie er es im Leben niemals täte; er sei also nicht Imitator und suche seine Vorbilder nicht in einer dem Schauspieler fremden Welt, kurz: er schäme sich nicht, daß er spielt, er verleugne das Theater nicht und soll nicht eine Wirklichkeit vorzutäuschen suchen, die ihm einerseits niemals voll gelingen könnte, die andererseits aber auch nur dann aufs Theater zu stellen wäre, wenn die dramatische Kunst sich so heruntergebracht hätte, nur eine mehr oder weniger gelungene, und sei es mit Empfindungen, sei es mit moralischen Forderungen, sei es mit Aphorismen durchtränkte Imitation der körperlichen Realität und Psyche des Alltags zu sein.
Wenn der Schauspieler die Gestalten im Erlebnis der Empfindungen oder des Schicksals, das er darzustellen hat, und mit diesem Erlebnis adäquaten Gesten, und nicht in der Erinnerung an Menschen, die er von dieser Empfindung erfüllt oder diesem Schicksal verfallen gesehen hat, formen, ja, sogar diese Erinnerung vollkommen aus seinem Gedächtnis bannen wird, dann wird er erfahren, daß gerade sein Ausdruck eines Gefühls, das doch nicht wirklich und dessen Anlaß nur fingiert ist, reiner, eindeutiger und stärker sein wird, als der jenes Menschen, dessen Gefühl aus wirklichem Anlaß wirklich ist; denn des Menschen Ausdruck kann nie eindeutig sein, weil er selbst nie eindeutig, indem er niemals nur Eines und, wäre er nur Eines, es immer in anderer Beleuchtung ist. Glaubt er nur einem Erlebnis hingegeben zu sein, so sind es doch unzählige psychische Tatsachen, die in ihm existieren und manches verfälschen: der Schatten der gegenwärtigen Umgebung, der Schatten der Vergangenheit fällt auf ihn.
Quelle Das Junge Deutschland / Jahrgang 1 / Nr.1, Berlin 1918 (Rowohlt), zitiert nach „Zeichen der Zeit“ Herausgegeben von Walther Killy Ein Deutsches Lesebuch 4 Fischer Bücherei Frankfurt am Main und Hamburg 1958 (Seite 154)
Eine Erweiterung des Arbeitsfeldes ergibt sich aus der Lektüre von Lee Strasberg’s „Einführung zu Denis Diderots Das Paradox über den Schauspieler“ (1957). Siehe auch den Wikipedia-Artikel über Strasberg, insbesondere über seine „Method of Acting“. – Desgleichen aus dem Nachwort der Insel-Ausgabe 1964 von Reinhold Grimm.
… und der Text einer SWR2-Radiosendung von Christian Schärf über das Thema „Denis Diderot und das Paradox des Schauspielers“ vom 8.9.2013. Bemerkenswert hier besonders die Verknüpfung mit Rousseau und mit Hegel (!).
(Hinweise in dieser Thematik verdanke ich Kirsten Lindenau und JMR)
Reinhold Grimm:
Es ist freilich ein dialektischer Zusammenhang. Ursprünglich stand Diderot, der Vorkämpfer einer natürlichen Spielweise, durchaus auf der Seite der sensibilité, die man mit Recht eine ‚Zeitkrankheit‘ des 18. Jahrhunderts genannt hat. Erst allmählich löste er sich von dieser Auffassung, und man wird Dieckmann gern zustimmen, wenn er in diesem Vorgang eine Reaktion Diderots ‚gegen eigene Schwächen oder das, was ihm nun als Schwäche erschien‘, zu erkennen glaubt. Der erste Unterredner im ‚Paradoxe‘ erklärt ausdrücklich: ‚Wenn die Natur je eine gefühlvolle Seele erschaffen hat, so ist es die meinige.‘ Aber bereits ‚Le neveu de Rameau‘, begonnen 1761, zeigt die Wendung an. Am Beispiel des krankhaft reizbaren Neffen, dem das doppelte Attribut des comédien und der sensibilité beigelegt wird, demonstriert Diderot in einer zentralen Szene dieses anderen großen Dialogs, was zu geschehen pflegt, wenn ein Schauspieler von der Gewalt seiner Empfindung übermannt wird. Der Unglückliche nimmt nichts mehr wahr; er verzerrt die Züge, verdreht seinen Leib; ein Strom von Tränen entstürzt ihm, ja Schaum tritt ihm vor den Mund. Dieser Zustand, sagt Diderot, grenze so nahe an den Wahnsinn, daß es stets ungewiß bleibe, ob einer daraus wieder zurückfinde. Auf den Zuschauer wirke eine solche ‚aliénation d’esprit‘, bei aller Bewunderung für den Darsteller, eher peinlich und lächerlich als genial.
Quelle Nachwort von Reinhold Grimm zu Denis Diderot „Paradox über den Schauspieler“ Insel-Bücherei Nr.820 Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Leipzig 1964 (Seite 73f)
Folgendermaßen beschrieb Abbé Raguenet im Jahre 1702 einen italienischen Geiger, der eine Symphonie der Furien interpretierte:
Der Violinist / welcher dergleichen spielet / kann nicht umhin / er muß dadurch aus sich selbst gesetzet und grimmig werden; da martert er gleichsam sein Instrument sowohl / als seinen ganzen Leib / ist sein selbst nicht mehr Meister / drehet und windet sich / als ein Besessener / und kann solches nicht ändern.
Und wie ging die Sache mit François Ozon und seiner Schauspielerin aus?
Ich sagte ihr dann ganz vehement: Du hast kein Recht, das zu tun. Du bist Schauspielerin und spielst bitte nur deine Rolle. Du kaufst jetzt Farbe und streichst die Wände. Das hat sie dann auch getan, mehrfach, weil das Blut nach dem ersten Anstrich wieder durchkam. Es war wie in einem Film. Ich habe mich um sie gekümmert und ihr klargemacht: Es gibt die Fiktion des Films, und es gibt die Realität. Ich wurde im Grunde zu ihrem Psychologen.
Quelle Zeitmagazin (a.a.O. siehe oben)
Nachtrag 5. Juli 2015
Als ich diesen Beitrag vor einigen Monaten schrieb, habe ich nicht bedacht, dass mir darüber eigentlich das Klügste, was es zum Thema gibt, entfallen sein könnte: es steht bei Walter Benjamin.
Definitiv wird die Kunstleistung des Bühnenschauspielers dem Publikum durch diesen selbst in eigener Person präsentiert; dagegen wird die Kunstleistung des Filmdarstellers dem Publikum durch eine Apparatur präsentiert. Das letztere hat zweierlei zur Folge. Die Apparatur, die die Leistung des Filmdarstellers vor das Publikum bringt, ist nicht gehalten, diese Leistung als Totalität zu respektieren. Sie nimmt unter Führung des Kameramannes laufend zu dieser Leistung Stellung. Die Folge von Stellungnahmen, die der Cutter aus dem ihm abgelieferten Material komponiert, bildet den fertig montierten Film. Er umfaßt eine gewisse Anzahl von Bewegungsmomenten, die als solche der Kamera erkannt werden müssen – von Spezialeinstellungen wie Großaufnahmen zu schweigen. So wird die Leistung des Darstellers einer Reihe von optischen Tests unterworfen. Dies ist die erste Folge des Umstands, daß die Leistung des Filmdarstellers durch die Apparate vorgeführt wird. Die zweite Folge beruht darauf, daß der Filmdarsteller, da er nicht selbst seine Leistung dem Publikum präsentiert, die dem Bühnenschauspieler vorbehaltene Möglichkeit einbüßt, die Leistung während der Darbietung dem Publikum anzupassen. Dieses kommt dadurch in die Haltung eines durch keinerlei persönlichen Kontakt mit dem Darsteller gestörten Begutachters. Das Publikum fühlt sich in den Darsteller nur ein, indem es sich in den Apparat einfühlt. Es übernimmt also dessen Haltung: es testet. [Hier bezieht sich Benjamin auf Brecht, den er in einer Fußnote zitiert und bedenkt.] Das ist keine Haltung, der Kultwerte ausgesetzt werden können. (Seite 23 f)
Im nächsten Kapitel setzt Benjamin bei einem Pirandello-Zitat zum Stummfilm an und fährt fort:
Man kann den gleichen Tatbestand folgendermaßen kennzeichnen: zum ersten Mal – und das ist das Werk des Films – kommt der Mensch in die Lage, zwar mit seiner gesamten lebendigen Person aber unter Verzicht auf deren Aura wirken zu müssen. Denn die Aura ist an sein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von ihr. Die Aura, die auf der Bühne um Macbeth ist, kann von der nicht abgelöst werden, die für das lebendige Publikum um den Schauspieler ist, welcher ihn spielt. Das Eigentümliche der Aufnahme im Filmatelier aber besteht darin, daß sie an die Stelle des Publikums die Apparatur setzt. So muß die Aura, die um den Darstellenden ist, fortfallen – und damit zugleich die um den Dargestellten. (Seite 25)
Ich zitiere nur das, was mir im Moment hilfreich ist,- das Umfeld im Original ist aber letztlich unentbehrlich. Zu „Aura“ siehe hier.
Quelle Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie edition suhrkamp SV Frankfurt am Main 1966, 1974, 1977. ISBN 3-518-10028-9