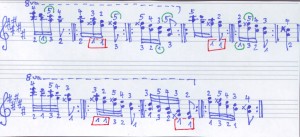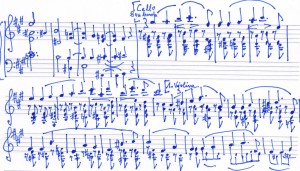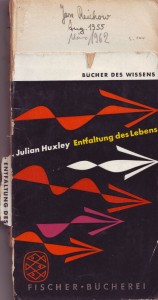Beginnt die Wahrheit mit einer Entschleierung?
Es gibt verschiedene Wege, die sogenannte Realität zu unterwandern. Zum Beispiel auch diesen: von einer sogenannten Realität zu sprechen, so als wisse man von vornherein, dass dahinter noch etwas ganz anderes steckt als Realität. Ja „dahinter“ natürlich, nicht etwa seitlich davon, oder davor, was ja möglich wäre, als täuschende Folie etwa, das farbige Glas wird da gern als Beispiel genommen, auch die rosarote Brille. Aber da bietet sich der gleiche Vorgang an: die Folie abziehen, die Durchsichtigkeit der Dinge erhöhen. Und seitlich? Wer sagt denn, dass es nur ein Ding, eine Sache zu ergründen gibt, ich muss die Relation zur Nachbarschaft beachten, schon um die Höhe und Breite des von mir herausgegriffenen Phänomens zu erfassen.
Die Analogien liegen so nah, dass wir schon nicken, ehe sie ausgesprochen sind. Man muss eine Oberfläche durchstoßen, man muss zum Kern der Sache kommen, sieben Schleier müssen abgelegt werden – und dann kommt was zum Vorschein? Hinter dem verschleierten Bild zu Sais befand sich – ja was nun? – die Götterstatue, die Jungfrau oder die Wahrheit. Die sogenannte Wahrheit, möglichst in handlicher, mit der Hand begreifbaren Form. Oder nur sichtbar? Aber wer daran rührt, wird seines Lebens nicht mehr froh.
Wer nach innen will, hat immer recht. Aber ob er wirklich dort war, ist schwer nachweisbar. Was erfährt man durch bloße Innenschau, was erfährt der andere durch meine verbale Beichte? Ist es ein Entblößungsmechanismus, ist da etwas, oder entdeckt man, was man vorher oder zugleich hineingelegt hat. Wieviel Pubertäres steckt in dem Vorgang, Unaufgeklärtes? Im Mittelpunkt der Liebesmystik des Novalis stand ein 12jähriges Mädchen (sie starb mit 15).
Novalis: Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft.
Ist das ein Glaubenssatz? Oder etwa Realität? Eine Tatsachenbehauptung wie „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Man kann Realität auch bei Google eingeben und hat reiche Auswahl. (Eine Schülerin meinte: „Denken ist wie googeln, nur krasser.“) Am Ende eines ZEIT-Artikels steht der schöne Merksatz: Realität ist stets das, was wir dafür halten.
Als Wahrheit gilt vielen das grobe Benennen der angeblichen Fakten, die schiere Taktlosigkeit.
Wer bin ich? Der, der ich damals war (mit 25) oder der, der ich nächstes Jahr (nach all den Arbeiten, die ich mir vorgenommen habe) sein werde. Ob eine Frau diesen Satz immer noch anders beantwortet als ein Mann? Sie will so sein wie sie früher mal war, aber mit dem Bewusstsein von heute. Er will so sein wie er ist, aber nicht sterben.
Thomas Mann münzte auf den alten Fontane, was dieser über seinen Vater geschrieben hatte: „So wie er ganz zuletzt war, so war er eigentlich.“
Was bedeutet der Rilke-Satz aus den ‚Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge‘:
Sieh dir die Liebenden an,
wenn erst das Bekennen begann,
wie bald sie lügen.
Sobald du (im Überschwang) ein Bekenntnis abgelegt hast, hast du eine Marke gesetzt, an der deine Liebe fortan gemessen wird. Ebbe und Flut wirst du durch Täuschungsmanöver ausgleichen müssen.
***
ZITAT
Und jetzt ist dieser enthemmte Alles-muss-mitgeteilt werden-Narzissmus aus der Pöbelmaschine [Facebook, Twitter JR] ins Real Life geschwappt. Die Psychologen konstatieren vor allem in der Beziehungskommunikation eine Art Quantensprung in die Geheimnislosigkeit. Der infantile und hemmungslose Zwang, sich ununterbrochen erklären zu müssen, wird mit absoluter Liebe und Ehrlichkeit verwechselt. Bei „Honestyexperiment.com“ können Paare eine dreißigtägige Ehrlichkeitskur buchen mit „Tipps, die einander näherbringen“. [Siehe hier .JR]
Liebe wird aber doch nicht besser oder näher, wenn man keine Geheimnisse mehr voreinander hat. Keine Frau muss sich zur Dokumentation von Vertrautheit und Wertschätzung die Zähne putzen, während er auf dem Klo sitzt, jedenfalls nicht im selben Zimmer. (…)
Etwa mit vier Jahren fangen Kinder an zu verstehen, dass sie Dinge über sich selbst wissen, die Eltern nicht wissen. Das ist der Anfang der Selbstabgrenzung, ein enorm wichtiger Moment zur Identitätsfindung. Mit fünf begreifen sie dann, dass sie darüberhinaus andere Informationen besitzen, die Eltern nicht haben. Mit dem Geheimnis beginnt die Autonomie. beides kann man zerstören. Eltern, die sagen, ihre Kinder haben keine Geheimnisse vor ihnen, werden von Psychologen als problematisch eingestuft. Sie lesen neuerdings – das gehört zum Helikoptern* offenbar dazu – sogar die Tagebücher ihrer Teenager, die sie „zufällig“ beim Aufräumen gefunden haben. Teenager, die Geheimnisse vor ihren Eltern haben können, sind autonomer, disziplinierter, besser im Abgrenzen, und, das vor allem: Sie haben schweigen gelernt. Wenn sie Anwälte werden wollen, oder Ärzte, Journalisten oder gute Ehepartner, werden sie diese Fähigkeiten brauchen können. Als Politiker übrigens auch.
Quelle Süddeutsche Zeitung 6./7. August 2016 Seite 49 Alles muss raus / Diskretion ist aus der Mode gekommen. Paare leben unter dem Diktat permanenter Offenheit – dabei brauchen wir das Geheimnis. Von Evelyn Roll.
* Zu dem Begriff „Helikoptern“ siehe hier.
***
In der Zeit, als ich mich viel mit Mystik beschäftigte, auch mit C.G.Jung, und in der Musik als Geiger „Zen in der Kunst des Bogenschießens“ auf die Kunst der Bogenführung übertragen wollte, begann ich ebenso intensiv Marcel Proust zu lesen. Alles schien zusammenzufließen in ein Leben, das mit Wahrheitsfindung zu tun hatte, ein Wort wiederum, das in derselben Zeit durch Fritz Teufel einen urkomisch ironischen Klang bekommen hatte. Ich fühlte mich Proust nahe, wenn ich am Ebertplatz in Köln die Rotdornbäume blühen sah, ich besuchte regelmäßig den botanischen Garten, die Flora, vertiefte mich in exotische Blüten. Ich sah entfernte Kirchtürme, besonders im Abendlicht, mit seinen Augen, – habe ich etwa darauf gewartet, dass sich sich aufklappen und ein Inneres, die Wirklichkeit, preisgeben? Es war ja nicht ganz naiv, was ich erwartete, durchaus nicht.
Da der Kutscher, der nicht zum Reden aufgelegt schien, auf meine Bemerkungen kaum eine Antwort gab, blieb mir nichts anderes übrig als mangels anderer Gesellschaft mich ganz meiner eigenen zu überlassen und zu versuchen, mir meine Kirchtürme nochmals vorzustellen. Bald darauf war es, als ob ihre Umrißlinien und besonnten Flächen wie eine Schale sich öffneten und etwas, was mir in ihnen verborgen geblieben war, nunmehr erkennen ließen; es kam mir ein Gedanke, der einen Augenblick zuvor noch nicht in meinem Bewußtsein war und der sich in meinem Hirn zu Worten gestaltete, und die Lust, die mir soeben der Anblick der Türme bereitet hatte, war so gesteigert dadurch, daß ich, von einer Art Rausch erfaßt, an nichts anderes dachte. In diesem Augenblick – wir waren schon weit von Martinville entfernt – erkannte ich sie von neuem, diesmal ganz schwarz, denn die Sonne war untergegangen. Durch eine Wendung des Weges wurden sie mir für Sekunden entzogen, dann zeugten sie sich ein letztes Mal, dann sah ich sie nicht mehr.
Die besonnten Flächen öffneten sich wie eine Schale, – war es bei dem Mystiker Jacob Böhme nicht der Widerschein des Sonnenlichtes in einer goldenen Schale, der die Ekstase auslöste? Der entscheidende Punkt bei Proust jedoch kommt erst wenige Zeilen später: die Macht der Wörter – jenseits aller ersehnten Ekstasen:
Ohne mir zu sagen, daß das, was hinter den Türmen von Martinville verborgen war, einem wohlgeklungenen Satz entsprechen mußte, da es mir ja in Gestalt von Worten, die mir Freude machten, aufgegangen war, bat ich den Doktor um Bleistift und Papier, und trotz der Stöße des Wagens verfaßte ich, um mein Bewußtsein zu entlasten und aus Begeisterung das folgende kleine Stück Prosa, das ich später wiederfand (….).
Quelle Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Swanns Welt I / werkausgabe edition suhrkamp / Übersetzt von Eva Rechel-Mertens / Frankfurt am Main 1964 (Seite 240)
Der neunjährige Jean-Paul Sartre entdeckt das Schreiben:
Die Schreiberei, meine Schwarzarbeit, hatte kein Ziel, und plötzlich wurde sie zum Selbstzweck. Ich schrieb, um zu schreiben. Ich bedauere es nicht. Hätte man mich nämlich gelesen, so wäre ich in Versuchung geraten, Wohlgefallen zu erregen, ich wäre wieder bezaubernd geworden. Dank meiner Heimlichkeit wurde ich wahr.
Und schließlich gründete sich der Idealismus des Intellektuellen auf den Realismus des Kindes. Ich habe es oben bereits gesagt: da ich die Welt durch die Sprache entdeckt hatte, nahm ich lange Zeit die Sprache für die Welt. Existieren bedeutete den Besitz einer Approbation irgendwo in den unendlichen Verzeichnissen des Wortes; Schreiben bedeutete, daß man dort neue Wesen einschrieb oder daß man – dies war meine hartnäckigste Illusion – die lebenden Dinge mit der Schlinge der Sätze einfing. Wenn ich die Wörter geschickt kombinierte, so verfing sich das Objekt in den Zeichen, und ich konnte es halten. Ich begann damit, mich im Luxembourg durch das glänzende Scheinbild einer Platane faszinieren zu lassen: ich beobachtete sie nicht, ganz im Gegenteil, ich vertraute der Leere, ich wartete; nach einem Augenblick kam ihr echtes Blattwerk hervor unter dem Aspekt eines einfachen Eigenschaftswortes oder bisweilen eines ganzen Satzes. Dann hatte ich das Universum um eine wahrhaft schwingende Art von Grün bereichert. Meine Entdeckungen brachte ich niemals aufs Papier; sie sammelten sich, wie ich dachte, in meinem Gedächtnis. In Wirklichkeit vergaß ich sie. Allein sie gaben mir eine Vorahnung meiner künftigen Rolle: ich würde es sein, der Namen vergibt. Seit vielen Jahrhunderten warteten in Aurillac vage Ansammlungen von Weiß darauf, feste Umrisse und einen Sinn zu erhalten; ich würde aus ihnen richtige Monumente machen. Als Terrorist kam es mir nur auf ihr Sein an: durch die Sprache würde ich es erschaffen. Als Rhetoriker liebte ich nur die Wörter: ich würde Wortkathedralen errichten unter dem blauen Auge des Wortes Himmel. Ich würde für die Jahrtausende bauen. Nahm ich ein Buch, so konnte ich es zwanzigmal öffnen und schließen, sah aber sehr wohl, daß es sich nicht veränderte. Indem er über die unverwüstliche Substanz des Textes glitt, war mein Blick bloß ein winziger Zwischenfall an der Oberfläche, er störte nichts, er nutzte nichts ab. Ich hingegen, passiv und vergänglich, war ein geblendetes Insekt, das in die Lichter eines Leuchtturms geraten war; wenn ich das Arbeitszimmer verließ, so erlosch ich, während das Buch, unsichtbar in der Finsternis, nach wie vor glänzte: für sich allein. ich würde meinen Werken die Heftigkeit dieser verzehrenden Lichtstrahlen geben, und so würden sie später, in zerstörten Bibliotheken, den Menschen überleben.
Quelle Jean-Paul Sartre: Die Wörter / Rowohlt Reinbek bei Hamburg 1965 Aus dem Französischen mit einer Nachbemerkung von Hans Mayer (Zitat Seite 139 f)
Was haben diese philosophischen Ansätze mit unserer (!) aktuellen Situation zu tun? Es ist nicht nur mein privates Problem. Man könnte ja auch fragen, ob nicht der entscheidende Punkt darin liegt, wieviele Menschen beteiligt sind. Der einzelne Mensch mit seinem Weg ins eigene Innere dürfte uns äußerst suspekt sein. Alles, was er sagt, bedarf der Wechselwirkung mit anderen Perspektiven. Die Selbsttäuschung muss ausgeschlossen werden. In redlicher Auseinandersetzung.
Vielleicht scheint es wirklich nur so, als ob die Unwahrheit, die Unsachlichkeit, die Lüge im öffentlichen Leben, in der Politik ein ganz anderes Gewicht hat. Sie arbeitet durchaus nicht mit glänzenden Visionen, sondern mit der realen Angst. Was nach der Lektüre des folgenden SZ-Artikels zunächst weiterwirkte, war der Satz: „Angst, zumal wenn sie partiell begründet ist, kann man schüren, Realismus nicht. Das ist der strategische Nachteil aller Sachlichkeit.“ (A.Zielcke) Und noch ein anderer Satz: „Die Demokratie ist stärker als jedes andere politische System auf Realismus aufgebaut.“
Aber: der Nachweis einer Lüge, das Beharren auf den realen Fakten, ist bei einem bestimmten Typus von Lügen oft wirkungslos, nämlich bei Lügen nationalistischer Tonart. Sie verbinden sich mit wahrheitsresistenten Parolen, wie z.B. „take back control“, – wer will die Lage nicht im Griff haben? -, da erübrigt sich ein Faktencheck. Mehr Kontrolle unsererseits kann doch nicht schaden.
ZITAT
Natürlich stehen in jedem politischen System Wahrheitsfragen in einem Spannungsverhältnis zu Wertefragen. Programmatische Ziele wie Imperium, nationale Glorie, Volksherrschaft, Gerechtigkeit, Europa oder sonst eine politische Vision erheben sich über nackte Tatsachen, auch wenn sie sich nicht völlig von der Realität lösen können. Umgekehrt, das lehrt uns die moderne Erkenntniskritik, sind selbst „reine“ Tatsachenaussagen nicht frei von subjektiven Vor-Annahmen und Interpretationen. Aber trotz dieses unvermeidlichen Dunkelfelds zwischen Faktum und Wertung wusste man zu allen Zeiten, politische Lügen von Meinung oder Irrtum zu unterscheiden.
Die Lüge zielt auf einen absichtlich herbeigefrührten Wahrnehmungsfehler ihres Adressaten. Wenn Wissen Macht ist, dann ist Lüge Machtmissbrauch. Sie funktioniert nur, wenn der Adressat sich auf die Wahrhaftigkeit seines Gegenüber verlässt. „Die Lüge muss, um erfolgreich zu sein“, sagte schon Augustinus, „das Vertrauen in die Wahrheit der menschlichen Rede voraussetzen, das sie zugleich zerstört.“
Und in Demokratien zerstört die politische Lüge die Wahrheit der öffentlichen Rede. Wahrscheinlich ist die Demokratie bei allen ihren ideellen Werten stärker als jedes andere System auf Realismus aufgebaut. Keiner weiß das besser als der lügende Volksvertreter.
Quelle Süddeutsche Zeitung 2. August 2016 Seite 9 Zeit der Lügen Stimmt es, dass Politiker immer öfter die Unwahrheit sagen? Oder ist das nur der Eindruck, weil das die allgegenwärtigen Faktenchecks behaupten? Von Andreas Zielcke.
***
Die große Gemeinschaft ist das eine. Darüber kann man sich täuschen. Aber welches ist das erwünschte nahe, überschaubare Umfeld? Nur die Familie, der enge Freundeskreis? Genügt der direkte Austausch mit wenigen „Auserwählten“, oder gar mit imaginären Personen, mit Büchern, mit Heiligen oder heiligen Schriften, oder: mit dem Internet?
„Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet…“
Wäre es denkbar, sich abzuschließen, sich ganz auf sich selbst zurückzuziehen? Wie ein Mönch? (Das Wort Mönch kommt von „monos“ – allein.) Allein im Angesicht des Absoluten. Schon ist das Gegenüber da. Wie bei Caspar David Friedrich – vor dem Meer. Oder in der bürgerlich idyllisierten Klause – als „geigender Eremit.“ Die Resonanz der Ewigkeit. Solissimo (Bachs Idee). Das Kloster, das einfache Leben, überhaupt: die Vereinfachung, die Beschränkung des Gesichtsfelds.
Gibt es da einen Umschlag in Allmachtsphantasien, vielleicht beginnend mit einem Bund der Gleichgesinnten?
Zunächst: der Mönch ist nicht allein! Er muss sich absichern. Notfalls durch Kampftechniken?

Man kann sich Anregungen holen in dem Absatz „Kampf und Krieg“ des Wikipedia-Artikels Mönchtum, der allerdings (lt. Vorbemerkung) noch nicht abgesegnet ist.
Ich habe oben zwei Goethezeilen zitiert, die uns jetzt weiterführen sollen, – wenn es denn geht:
Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet / das Lebend’ge will ich preisen, / das nach Flammentod sich sehnet.
Flammentod? Man sollte sich über die Problematik des Gedichtes „Selige Sehnsucht“ genau informieren, bevor wir den angedeuteten islamischen Hintergrund weiter verfolgen: vielleicht wiederum anhand eines Wikipedia-Artikels. Hier.
Nun halte ich Verse eines iranischen Mystikers unserer Zeit dagegen:
Mein Leben lang habe ich mich danach verzehrt, das Antlitz des Geliebten zu erblicken. ich bin ein Falter, der begierig die Flamme umkreist, eine Schote mit dem Samen der wilden Raute, die im Feuer röstet. Sieh meinen befleckten Mantel und diesen Gebetsteppich der Heuchelei. Werde ich sie eines Tages vor der Tür der Schenke in Fetzen reißen können?
Makaber genug, bezieht sich der Dichter dann auf einen der berühmtesten islamischen Mystiker, Mansur Al-Halladsch, der im Jahre 922 in Bagdad als Ketzer öffentlich verbrannt wurde, nachdem aus seinem Munde die Stimme des göttlichen Geliebten gesprochen hatte: „Ich bin die absolute Wahrheit.“ Und der eben zitierte Dichter fühlt sich von der Leidenschaft des großen Vorgängers durchdrungen und sagt: „Meines Herzen Liebe / hat den Mansur in mich gebracht, / (…) / Wein aus Deinem randgefüllten Becher / hat mich ewig werden lassen. / Durch das Küssen des Staubes deiner Schwelle / bin ich mit dem Geheimnis vertraut geworden.“
Wollen Sie den Namen des Dichters erfahren, der in dieser Weise nicht nur mit irgendeinem Geheimnis vertraut wurde, sondern der absoluten Wahrheit teilhaftig geworden ist und von der eigenen Ewigkeit Gewissheit erlangt hat?
Er heißt Ruhollah Chomeini. Wie Goethe im Divan-Gedicht spricht er als Eingeweihter zu Eingeweihten:
„Oh, mein geistlicher Freund […] hüte dich, diese Geheimnisse, die ich dir mitteile, zu verraten […]. Diese innere Religiosität ist eine Ehrerweisung des Schöpfers, die vor Fremden geheimgehalten werden muss, denn ihr Verstand reicht nicht aus, um dies zu begreifen.“
Ich zitiere hier aus einem Aufsatz, in dem Persönlichkeiten behandelt werden, die für eine bestimmte Prägung religiöser Gewalt einstehen: 1. Bernhard von Clairveaux, 2. Ruhollah Chomeini und 3. bedeutende Vertreter des Zen-Buddhismus. Beispiele für „Mystiker und ihr Engagement für den Krieg“. Der Titel dieser Abhandlung ist: „Selbstlos töten im Namen des Einen. Mystik und die Ausrottung des Bösen in der Welt.“ Der Autor heißt Reiner Manstetten, sein Beitrag gehört zur Dokumentation einer Tagung, die unter dem Titel „Mystik und Totalitarismus“ im Auftrag des Internationalen Jacob-Böhme-Institutes veröffentlicht wurde (Weißensee-Verlag, Berlin 2013). Eine Hauptkapitel dieses Buches ist überschrieben: „Mystik-Rezeption im Dritten Reich“ und klärt über Zusammenhänge auf, die man über jede politische Verdächtigung erhaben wähnte. Ich jedenfalls, über viele Jahre hinweg.
Eine großartige Aufklärung hatte schon 2007 Rüdiger Safranski in seinem Buch „Romantik. Eine deutsche Affäre“ betrieben. Das Siebzehnte Kapitel sei zu regelmäßigem Studium an allen Gymnasien und in privatester Ferien-Idylle empfohlen. „Romantische Geisteshaltung als Vorgeschichte. Weltfremdheit, Weltfrömmigkeit und weltstürzender Furor.“ Und wenn man glaubt, Safranski neuerdings in die Abstellkammer zeitgenössischer Philosophie verfrachten zu können, lese man aufs neue: „Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? Über das Denkbare und das Lebbare“ (1993) und auch „Das Böse oder Das Drama der Freiheit“ (1997/1999).
Denkbare und lebbare Bücher gerade in einer Zeit der sich verfestigenden autoritären Strukturen. Keine Geheimlehren.
Nachtrag 25. August 2016
Die heutige ZEIT erinnert daran, dass es mit dem Wunsch nach Entschleierung, der Offenlegung aller Gedankengänge in der Politik (und in der breiten Öffentlichkeit) eine besondere Sache ist: diese vollständige Transparenz ist nicht möglich und auch nicht wünschenswert. Man lese:
DIE ZEIT Seite 10 Gero von Randow: Lob der Verschleierung / Die Enthüllungsplattform WikiLeaks fordert von Politik und Diplomatie die totale Transparenz. Das ist nicht nur weltfremd, sondern grundfalsch.