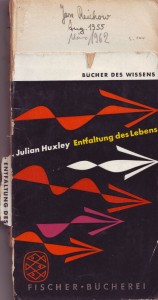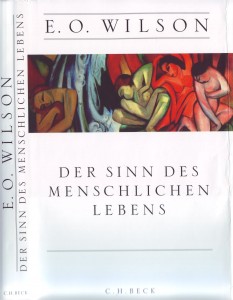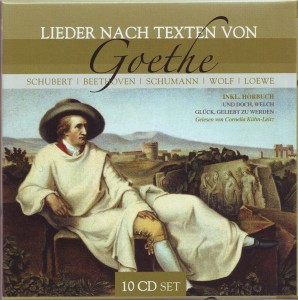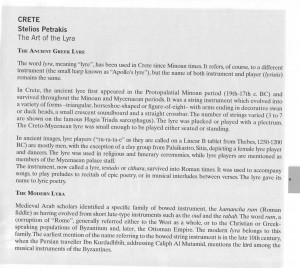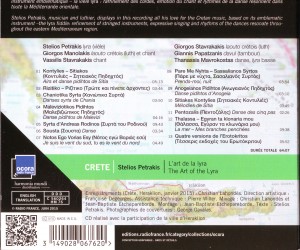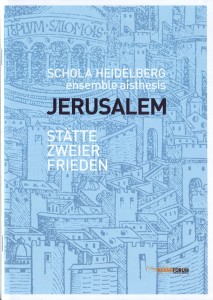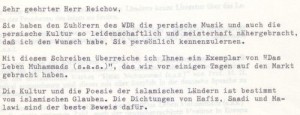Biologie oder Philosophie?
Es ist kein Zufall, dass das scheinbar natürliche menschliche Zusammenleben nur dank künstlichster Konstruktionen katastrophenfrei funktioniert. Wenn überhaupt … (die Grundgedanken lassen sich genauso in einer alten Solinger Hofschaft wie in einem Berliner Plattenbau, in einem Dorf auf Sri Lanka oder einer Metropole der Antike nachvollziehen. Ich denke zum Beispiel an die Gruppe der Häuser 6 bis 34 unmittelbar neben oder vor mir, die durch eine eigene Verwaltung zusammengefasst sind).
Ich erlaube mir, etwas weiter auszuholen: einmal bei unseren Vorfahren vor drei Millionen Jahren, dann bei Immanuel Kant im Jahre 1795. (Siehe auch hier). Beides beruht nicht auf meinen eigenen Recherchen, der eine Punkt auf dem neuen Buch des Evolutionsforschers E.O. Wilson, der andere auf dem großen ZEIT-Artikel von Thomas Assheuer (vor zwei Wochen). Mein Eigenanteil besteht nur darin, diese beiden Punkte gegen- oder miteinander abzuwägen. keinesfalls will ich behaupten, dass mir das Problem seit 60 Jahren sonnenklar ist. Es dämmert erst.
ZITAT (2015)
Bis vor drei Millionen Jahren waren die Vorfahren des Homo sapiens überwiegend Pflanzenfresser; wahrscheinlich zogen sie in Gruppen von Ort zu Ort, wo sie Früchte, Wurzeln und andere pflanzliche Nahrung sammeln konnten. Ihre Gehirne waren unwesentlich größer als die des modernen Schimpansen. Erst vor einer halben Million Jahre unterhielten Gruppen der vormenschlichen Art Homo erectus Lagerstätten mit kontrolliertem Feuer – also einen „Nistplatz“ -, von denen aus sie auf Futtersuche auszogen und mit Nahrung zurückkamen, darunter ein erheblicher Fleischanteil. Ihr Gehirn war auf eine mittlere Größe zwischen dem des Schimpansen und dem des modernen Homo sapiens angewachsen. Begonnen hatte dieser Trend wohl ein oder zwei Millionen Jahre zuvor, als der frühe vormenschliche Vorfahre Homo habilis in seiner Ernährung mehr und mehr auf Fleisch setzte. Als sich dann Gruppen auf einer gemeinsamen Lagerstätte zusammenfanden und ein zusätzlicher Vorteil aus kooperativem Nestbau und gemeinsamer Jagd entstand, nahm die soziale Intelligenz zu, und zugleich wuchsen die Zentren für Gedächtnis und logisches Denken im präfrontalen Cortex an.
Wahrscheinlich kam es zu diesem Zeitpunkt in der Ära des Homo habilis zu einem Konflikt zwischen der Selektion auf individueller Ebene, bei der Individuen mit anderen Individuen derselben Gruppe konkurrieren, und der Selektion auf Gruppenebene, bei der verschiedene Gruppen miteinander konkurrieren. Die Gruppenselektion förderte Altruismus und Kooperation unter den Mitgliedern derselben Gruppe; es entwickelte sich ein in der gesamten Gruppe angeborenes Moralempfinden, ein Sinn für Gewissen und Ehre. Der Wettstreit zwischen diesen beiden Selektionskräften lässt sich in etwa so darstellen: Innerhalb der Gruppe gewinnen Egoisten gegen Altruisten, aber Gruppen von Altruisten gewinnen gegen Gruppen von Egoisten. Oder sehr stark vereinfacht: Die Individualselektion förderte die Sünde, die Gruppenselektion dagegen die Tugend.
Das führte schließlich zu dem ewigen Konflikt des Menschen, eine Folge aus der vorgeschichtlichen Multilevel-Selektion. Wir schwanken in wenig stabilen, sich ständig verändernden Positionen zwischen beiden Extremkräften, die uns erschaffen haben. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir uns einer davon ganz unterstellen und damit die Ideallösung für unseren politisch-sozialen Grabenkampf finden. Würden wir ganz den instinktiven Bedürfnissen nachgeben, die sich aus der Individualselektion ergeben, so hätte das die Auflösung der Gesellschaft zur Folge. Überlassen wir uns dagegen der Gruppenselektion, so würden wir zu engelsgleichen Robotern – einer Art übergroßer Ameisen.
Der ewige Konflikt ist keine Versuchung, mit der Gott die Menschheit auf die Probe stellt, und genauso wenig das Machwerk des Teufels. Es ist einfach nur eine Entwicklung, die sich so ergeben hat. Vielleicht war es nur mit diesem Konflikt möglich, dass sich im Universum Intelligenz auf der Höhe des menschlichen Verstands und spziale Gefüge überhaupt herausbilden konnten. Irgendwann werden wir einen weg finden, mit unserem angeborenen Konflikt zu leben, und vielleicht erfreuen wir uns sogar daran, weil wir ihn als Urquell unserer Kreativität erkennen.
Quelle E.O. Wilson: Der Sinn des menschlichen Lebens / Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke / Verlag C.H. Beck München 2015 / ISBN 978 3 406 681707 (Zitat Seite 31 ff)
Und nun – nach dem Naturwissenschaftler und (nicht zu vergessen:) Ameisenforscher Wilson – der Philosoph Immanuel Kant, in der Darstellung von Thomas Assheuer:
Kant war Aufkärer, aber kein Träumer. Schwärmer mochte er nicht. „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.“ Torheit, Eitelkeit, Herrschsucht und Zerstörungslust gehörten zum Menschen dazu, dieser habe nun einmal einen „hang zum Bösen“, später sprach Kant gar vom „radikal Bösen“. Eine tiefe „Unvertragsamkeit“ präge den Menschen, eine „ungesellige Geselligkeit“.
Diese „ungesellige Geselligkeit“ bedeutete: Die Menschen können einander nicht leiden und mögen doch nicht voneinander lassen. Sie ziehen sich in die „Vereinzelung“ zurück – und spüren zugleich ein Ungenügen an ihr. Deshalb suchen sie Gesellschaft und geben sich eine gemeinsame Ordnung, genauer: eine Rechtsordnung, in der alle Mitglieder ihre schöpferischen Anlagen in Freiheit entfalten können. Die dialektische Pointe lautete also: Es ist die soziale „Unvertragsamkeit“, die die Menschen dazu bringt, sich eine republikanische Verfassung zu geben. Dabei sind die Bürger der Kantschen Republik zugleich Urheber wie auch Adressaten ihrer Gesetze, einen König von Gottes Gnaden brauchte es nun nicht mehr. Der König konnte gehen, die Bürger machten das jetzt selbst.
„Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür der anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann.“
Das war Kants berühmte republikanische Verfassung, seine genial einfach demokratische Idee. 1795 schießt ihm dann dieser atemberaubende Gedanke durch den Kopf: Wenn sich die einzelnen Bürger durch den freine Gebrauch ihrer Vernunft eine rechtliche Ordnung geben können – warum soll das den „unvertragsamen“ Nationen untereinander nicht auch gelingen? Gewiss, noch befinden sich die Völker im wilden Naturzustand und führen Krieg gegeneinander, doch das dürfe nicht das letzte Wort der Geschichte sein.
Eines Tages, so prophezeit er in seiner Altersschrift unter dem ironisch gemeinten Titel Zum ewigen Frieden , würden die Völker ihres Leides überdrüssig, gäben „ihre wilde (gesetzlose) Freiheit auf“ und fänden weltweit zu einem „Föderalismus freier Staaten“ zusammen. Und wieder befördert der Antagonismus der Menschen den Frieden des Rechts: „Die Natur hat also die Unvertragsamkeit des Menschen, selbst der großen Gesellschaften und Staatskörper (…), wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonismus derselben einen Zustand der Ruhe und Sicherheit auszufinden (…): aus dem gesetzlosen Zustande der Wilden hinaus zu gehen, und in einen Völkerbund zu treten: wo jeder, auch der kleinste, Staat seine Sicherheit und Rechte (…) erwarten könnte.“
Quelle DIE ZEIT 3. Dezember 2015 Seite 49 f Was nun Herr Kant? Er war der Philosoph der Vernunft und des Friedens. Warum er gerade in Kriegszeiten aktuell ist. Von Thomas Assheuer.
(Fortsetzung folgt)
Hinzuzufügen wäre, dass heute offenbar in Paris der Durchbruch eines ersten weltweiten Konsenses – also unter Beteiligung aller Völker – gefeiert werden darf. Man kann es kaum glauben, aber es wäre ein historischer Tag. Nicht den Frieden betreffend, aber immerhin eine gemeinsame Zukunft: das Weltklima.
Nachtrag 15.12.2015
Und dem wiederum wäre heute z.B. hinzuzufügen, was ich soeben in der SZ las:
Eigenwillig erscheint, dass Schellnhuber gerade die wachstumsbegeisterte Angela Merkel von seiner ständigen Politikerschelte ausnimmt. Schließlich ist Deutschland von den Pro-Kopf-Emissionen her alles andere als ein Klimavorreiter. Und auch die angeblichen Emissionsreduktionen seit 1990 sind in Wahrheit Emissionsverlagerungen, weil unsere Konsumgüter eben zunehmend aus den Schwellenländern stammen. Trotz aller technischen Alternativen zu Kohle und Öl könnte darum außer Technik auch ein genügsamerer Lebensstil nötig sein.
Quelle Süddeutsche Zeitung 15.12.2015 Seite 15 Die Klima-Welt aus Forschersicht Hans Joachim Schellnhubers Buch zum Pakt von Paris. / Von Felix Ekardt
Falls Sie diesem letzten Link nachgegangen sind und Ihnen ein Wikipedia-Banner aufgedrängt wurde: auch dazu gibt es heute einen SZ-Artikel (Seite 20), dessen Überschrift schon einiges aussagt:
Wikipedia erzürnt die Basis Ein Banner auf der Webseite wirbt jährlich mit immer höheren Spendenzielen – dabei hat das Online-Lexikon keine Geldsorgen. Im Grundsatz geht es um die Frage, wie viel Geld eine Freiwilligen-Organisation einnehmen darf. Von Angela Gruber.