Mit Smartphonebegleitung
Wieso denn beide? hieß es. (Ich finde beide nicht gut, aber das eine ist sowohl Korrektur wie Karikatur des anderen, insofern hat die Besitzerin des zweiten Glases nur halb recht.)
(Fortsetzung folgt)
Vergangenheit (Nazi?) und Gegenwart (Big Data?)
Es geht mir darum, einzelne Gesprächsthemen der Markus-Lanz-Sendung von gestern weiterzuverfolgen (Niklas Frank und Ranga Yogeshwar), das eine betrifft die Erinnerung an die eigene Familien-Situation nach dem Krieg, die andere das heutige Verhalten betr. Facebook u.ä., scheinbar harmlose Offenbarungen durch Likes (oder durch die Themenwahl in diesem Blog?). Schließlich noch Trumps explizite Lügen.
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-26-januar-2017-100.html
Ranga Yogeshwar: ab etwa 39:00
anschließend googeln: Michal Kosinski (oder gleich hier). ZITAT ihn betreffend: 2012 ist seine Methode soweit vorangeschritten, dass er anhand von 68 Facebook-Likes vorhersagen kann, welche Hautfarbe ein Nutzer hat (95% Trefferquote), ob er/sie homosexuell ist (88%) und mit welchem politischen Lager man sympathisiert (85%). Es folgen Dutzende weitere erfolgreiche Prognosen zu Konsumverhalten, ob ein Nutzer bis zum 21. Lebensjahr bei seinen Eltern gelebt hat, Religion, Geschlecht, künstlerischen und musischen Präferenzen, Erkankungen usw.
Niklas Frank über Hans Frank: ab etwa 52:00 (?Einblendung: Bilder dürfen aus rechtl. Gründen nicht gezeigt werden?)
Über Trumps Lügen („Alternative Fakten“): Bei LANZ (a.a.O.) ab 24:05 (die Bilder, die hier aus rechtlichen Gründen jetzt nicht mehr gezeigt werden dürfen, sind unter den unten folgenden Links durchaus zu finden), zu Ranga Yogeshwars Einwänden betr. Uhrzeit (Trump-Foto „ein bisschen zu früh, um es sauber zu vergleichen“ + Einfluss des Wetters: wieviel 100.000 Menschen können denn in letzter Minute auf einen Platz strömen? Wie steht es um die Richtigkeit der Zahlen der Verkehrsbetriebe?)
a) http://www.br.de/nachrichten/trump-pressesprecher-wahrheit-100.html hier
b) https://www.youtube.com/watch?v=9AjjVMAdWm4 hier (ab 1:33:30)
c) http://www.msnbc.com/am-joy/watch/kellyanne-conway-spicer-gave-alternative-facts-860234819559 hier
***
Dhruba Ghosh & Stephanie Bosch 21. Januar 2017
Unangefochten vom Nebel draußen:
Info in drei Screenshots, das Programmheft (Hinweis im folgenden Bild) kann man nicht hier, sondern auf dem Website-Original real aufrufen: hier)
Kurzbericht 23.1. im Hamburger Abendblatt hier.
Probe
Über Monitor
Im Konzert
Einführung
Er bewegt sich sogar. Und verfügt inzwischen über die von Dhrubas Hand notierte Programmfolge:
Bansuri Solo: Raga Vachaspati (Jhaptal) / Sarangi Solo: Raga Charukeshi
(Pause)
Sarangi/Bansuri Jugalbandi 1) Raga Jog 2) Raga Kirwani
Die Interpreten: Dhruba Ghosh, Sarangi und Gesang; Stephanie Bosch, Bansuri; Niti Ranjan Biswas, Tabla; Gert-Matthias Wegner, Tambura.
***
Aus der Einführung (Anhaltspunkte der Moderation)
Ein Hauptaspekt ist für mich immer: falsche Erwartungen zu mindern. Indische Musik ist kein esoterisches Gesäusel, und der von Anfang bis Ende durchgehaltene Grundklang ist keine Einschränkung, sondern die Voraussetzung guten Hörens: wie der ebene Boden für den aufrechten Gang. Der Rhythmus in Gestalt der Tala-Periode ist keine gefällige Untermalung, sondern Rahmen-Bedingung, die ein „kontrapunktisches“ Mitdenken stimuliert. (Daher das Musikbeispiel der „lärmenden“ Tempelmusik. Der Hinweis auf den Ursprung der abendländischen Musik im Engelsgesang, ihre Ächtung der angeblich teuflischen Momente. Siehe Reinhold Hammerstein „Diabolus in Musica“ 1974.)
Ich will demnächst – anhand einer Sendung in SWR2, deren Link ich, soweit ich weiß, einem Hinweis von Patrick Hahn auf facebook verdanke, – der Frage nachgehen, was eine Einführung überhaupt bringen kann, sagen wir, im Vergleich zum Programmheft. Vermutlich erwarten die Interpreten viel Biographisches und Instrumentenkundliches, was aber fürs Publikum eher langweilig wirkt (die Aufzählung der Preise und Lebensstationen…). Und danach bleiben die Leute ja mit der Musik völlig allein, die durchaus nicht als Irrgarten gemeint ist: man muss einfach mit den Grundbegriffen vertraut sein. Zum Beispiel: das Thema erkennen („the composition“), seine Wiederkehr, die Tala-Periode (das „Fluss-Bett“), auf der es schwimmt, an der es sich „reibt“. Die Gefahr ist, dass der Moderator unvermerkt zum Oberlehrer wird, obwohl er sich selbst gewiss zur Schülerschaft rechnet…
Das Konzert war anspruchsvoll, auch physisch: die Stühle relativ hart, und man sitzt in Tuchfühlung mit den Nachbarn, man wahrt also notgedrungen eine unveränderliche Meditationshaltung. Der erste Teil dauerte von 19:30 bis 21:00 Uhr; falls man zwischendurch raus will und nicht ganz am Rande sitzt, stört man wirklich alle, an denen man sich vorbeizwängt. Aber kaum jemand verließ den Saal, und nach der fast halbstündigen Pause fehlten erstaunlich wenige in der ausverkauften Halle. Wer den zweiten Teil erlebt hat, das faszinierende Wechselspiel zwischen Sarangi und Bansuri (Jugalbandi), gerade auch die sehr ausgedehnte Interpretation des Ragas Jog, – der ebenfalls hinreißende Raga Kirwani wirkte wie eine Zugabe -, der wird sie vielleicht für den Rest das Lebens als Highlight musikalischer Kommunikation in Erinnerung behalten. Nebenbei empfand ich das Überlappen der Stimmen, aus dem sich reizvolle Parallel-Wirkungen und wunderschöne Reibungen ergaben, als unerwartete, lebendige Illustration meiner Ausführungen: dass die indische Musikkultur eben keiner Harmonik bedarf, da sie den Kontrapunkt zwischen Melodie und Rhythmus auf die Spitze treibt, darüberhinaus aber auch noch solche Wirkungen der quasi zufälligen „Heterophonie“ auskosten kann. Und diese Ausgewogenheit zwischen Schönheit der Linien und Brillanz der virtuosen Mittel bleibt unvergesslich! Der einzige Wermutstropfen: man wird diese Sternstunde indischer Musik weder im Radio noch auf CD wieder aufrufen können. Man kann nur auf ein weiteres Konzert warten. Und die Weiterführung der Reihe WELTMUSIK in Zukunft lässt einiges erhoffen.
Die zwei Raga-Beispiele der Einführung stammten von Dhruba Goshs CD (1994!) „Bowing Sounds from Dawn to Moonlight“ (fonti musicali fmd 202 Bruxelles), die Nagasvaram-Musik aus dem Hindu-Tempel von unserer WDR-Aufnahmereise Sri Lanka Februar 1979.
Abschied
V.l.n.r.: JR, Pandit Dhruba Ghosh, Dr. Herta Wegner, Prof. Dr. Gert-Matthias Wegner
Den Raga Jog, der im zweiten Teil des Hamburger Konzertes im Jugalbandi (Sarangi & Bansuri) zu hören war, kann man auch in einer wunderschönen Solo-Aufnahme mit Dhruba Ghosh (und Yogesh Samsi, Tabla) vom 28. März 2015 in Calgary im Internet abrufen:
Fortsetzung Teil II (Gat, bei Tabla-Einsatz) HIER.
***
Das Indische Konzert in der Elbphilharmonie gehörte übrigens zur Planung der Agentur alba kultur (Birgit Ellinghaus). Es lohnt sich, dort jederzeit in die Terminplanung zu schauen. Für die eigene Terminplanung. Siehe HIER.
Ich habe mir vorgenommen, durch nichts meine dort avisierten Termine im Mai erschüttern zu lassen: zwischen dem 3. und dem 19. Mai das Ensemble BADAKHSHAN. Und ich werde hier in diesem Blog rechtzeitig beginnen zu rekapitulieren, was ich über diese Musik gelernt und notiert habe, und versuchen zu begründen, weshalb sie sich mir eingebrannt hat, – als stamme sie nicht von ungefähr aus einer Erdregion, die der Sonne (dem Himmel) besonders nahe ist.
Gegenbeispiele
Gidon Kremer
Ob es elterliche Bestimmung war oder meine Begabung, die die Geige zu meinem Instrument werden ließ, kann ich nicht beantworten. Wie auch immer die Entscheidung zustande gekommen ist, ich stelle auf jeden Fall meine „Freiwilligkeit“ dabei in Frage. Mir wäre zu der Zeit der Beruf eines Feuerwehrmannes, eines Schornsteinfegers oder eines Kellners, der im Restaurant die Süßspeisen serviert, mindestens genauso verheißungsvoll gewesen. Darüber wird heute natürlich nicht gesprochen. „Er hat schon als kleines Kind Geige gespielt“ – das paßt besser zur Legende. Meinen Wunsch, im Feuerwehrauto durch die Stadt zu jagen, Brände zu löschen und ständig Menschen vor dem sicheren Tod zu retten, sollte ein gefalteter Papierhelm zum Jaņu-Svētki-Fest befriedigen. „Kindereien!“ nannten die Erwachsenen meine Berufsvorstellungen und wußten wie immer mehr. Was für mich eine Möglichkeit war, schien ihnen die einzige zu sein. Meine ersten Versuche, die Geige zu halten und ihr Töne zu entlocken, erfüllten ihre Träume.
Quelle Gidon Kremer: Kindheitssplitter / Piper München 1993 ISBN 3-492-03614-7 (Zitat Seite 21f)
Zakhar Bron
Wenn ich von einem Menschen, sei er ein Künstler oder nicht, lese oder höre, er habe mit drei Jahren den genauen Wunsch gehabt, dieses oder jenes zu tun, dann glaube ich das einfach nicht. (…)
[Aber: Das frühe Anfangen (…) eine Grundvoraussetzung für eine gedeihliche Karriere?]
Das gilt besonders in der heutigen Zeit. Begabung allein reicht eben nicht mehr aus. Im Hinblick auf eine professionelle Tätigkeit sind ungenutzte Jahre in der Kindheit später nicht mehr kompensierbar. Wenn ich allerdings höre, daß man in östlichen Ländern, nehmen Sie Korea oder Japan, bisweilen im Alter von zwei Jahren beginnt, Geige zu spielen, dann kann ich das nicht gutheißen. Aber wer später als mit fünf oder sechs Jahren beginnt, dem kann man leider schon keine großen Chancen mehr einräumen. Die Konkurrenz ist einfach zu groß.
Quelle Ralf Noltensmeier: Große Geigenpädagogen im Interview Band 1 (Zakhar Bron u.a.) Peter Götzelmann Verlag Kiel 1997/3 1999 ISBN 3-98050 16-6-3
Gerald Moore
Was meine Musik betrifft, bin ich mir sogar selbst immer noch ein Rätsel. Bei diesem unwilligen, plärrenden Kind, das von seiner Mutter zum Klavier gezerrt wurde, fand man heraus, es habe Talent. Wieso? Niemand in meiner Familie war nur im geringsten musikalisch, und ich selbst ging als Knabe dem Klavier kaum je in die Nähe, wenn ich nicht zum Instrument gestoßen wurde. Ich machte mir Musik nicht zu eigen, bevor ich Mitte Zwanzig war; damals erst wurde ich von John Coates dazu getrieben – eine verspätete Entwicklung. Aus diesem nicht vielversprechenden Anfang ging ein guter Musiker hervor – diese Qualifizierung darf ich mir einräumen. Musik ist mein A und O. Ich kann mir für mich keine andere Art von Leben als das meine vorstellen. Aber ich wünschte, ich hätte meinen Kampf um die Kunst früher begonnen.
Quelle Gerald Moore: Bin ich zu laut? Erinnerungen eines Begleiters / dtv / Bärenreiter / München / Kassel, Basel, London 1976 / 1981 (Seite 266)
Nathan Milstein
Eigentlich hatte ich überhaupt keine Lust dazu, Geige zu lernen. Meine Mutter nahm mir die Entscheidung ab. Daß sie es ernst meinte, merkte ich spätestens, als sie mir eine kleine Geige in die Hand drückte und einen Lehrer engagierte. Es war ein Student des Konservatoriums von Odessa. (…)
Stoljarski war mit Sicherheit kein besonders tiefgründiger Musiker, aber mit der Violine kannte er sich aus. Allerdings erinnere ich mich nicht daran, daß er sich je mit der Erarbeitung technischer Grundlagen aufhielt. Alle mußten wir Übungsstücke von Ševčík und Schradieck spielen, außerdem Kreutzer-Etüden.
Ich mochte die Geige noch immer nicht; überhaupt konnte ich mir nicht recht vorstellen, daß ein normales Kind Freude daran finden könne, auf einem Instrument zu üben – außer, es war etwas verrückt. Ich jedenfalls war ein völlig normales Kind.
Damals wollte ich am liebsten Fußball spielen. Da Mama es mir aber nicht erlaubte, mußte ich stattdessen zu Stoljarski gehen. In seiner Schule war es schon lustig: Wir Kinder schrien herum, spielten und kämpften miteinander und sprangen herum wie die Verrückten. (…)
Oft lief ich von daheim fort, um im Stadtpark Fußball zu spielen. Damals waren alle in Odessa verrückt nach Fußball; ausländische Mannschaften kamen aus der Türkei und aus Griechenland zu uns. Ich war ein guter Angriffsspieler und durfte sogar Mittelstürmer sein. Dabei rannte ich so lange herum, bis ich völlig außer Atem war. So kamen meine Eltern dahinter, daß ich oft Fußball spielte, statt Geige zu üben… und ich wurde regelmäßig dafür bestraft: Ich mußte mich in die Ecke stellen.
Noch etwas gab es damals, nach dem alle verrückt waren: das Fliegen. Einer der populärsten Einwohner Odessas zu dieser Zeit war sowohl Fußballer als auch Flieger: Sergei Utotschkin. Und ich, der kleine Milstein, konnte damit angeben, daß ich auf einer Geige spielte, die von Utotschkins Bruder gebaut worden war. Die Geige war ein Alptraum. Den Lack konnte man mit dem Fingernagel wegkratzen. Wenn man wollte, konnte man mit dem Nagel auch eine tiefe Furche in das Holz graben. (…)
Nach und nach begann ich mich ernsthaft für die Geige zu interessieren. Ich mochte es nicht, daß die anderen Kinder besser spielten als ich. Deshalb gab ich mir erheblich mehr Mühe mit der Geige. Das fiel mir leicht, denn ich war ein heller Kopf und lernte schnell. Diese Fähigkeit habe ich bis heute behalten.
Quelle Nathan Milstein (Solomon Volkov) „Lassen Sie ihn doch Geige lernen“ Erinnerungen Geleitwort von Gidon Kremer. / Serie Musik PIPER München SCHOTT Mainz 1995 (Zitate Seite 16-23)
Gidon Kremer im Geleitwort: „Sind nicht Wunderkinder wie Milstein auf eine Art vergewaltigt worden, daß ihnen nichts außer dieser Treue dem Instrument gegenüber blieb?“
***
Dass er selbst schon in frühester Kindheit visionär begabt war, lässt sich leicht erkennen:
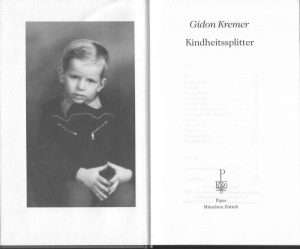 s.a. hier
s.a. hier
Körpersprachenforscher sprechen vom „Merkel-Dach“. Dies sei ein Symbol für Brücken und Nachbarschaft. (Zitat nach Wikipedia, siehe vorstehenden Link).
***
Wie früh soll man beginnen, Geige zu spielen? Oder: mit der Geige zu spielen?
Beispiel Tibor Varga.
Zunächst habe ich die Geige nur als Spielzeug verwendet – nicht immer zur Freude meines Vaters. Einmal, ich war vielleicht drei Jahre alt, habe ich eine sehr gute Geige genommen, bin in den Hof gegangen und habe sie mit Sand gefüllt. Anschließend habe ich den Sand auf die Straße gestreut, indem ich die Geige in der Art eines Salzstreuers verwendet habe. Darüber war mein Vater natürlich nicht sehr glücklich.
Quelle Ralf Noltensmeier: Geiger von Beruf – Gesprächsweise Einblicke in die Vielfalt geigerischer Profession. Peter Götzelmann Verlag Kiel 1999 / Seite 79-92 Der Professor für Violine: Tibor Varga
(Fortsetzung folgt)
Zum Jahresende
Die Weite des Himmels, das Rauschen des Meeres, das Murmeln der Menschen, überall ist Ruhe. Fast ohne Spannung. Die Bilder derselben Sache aber verändern auch die Realität.
(Fotos E.Reichow)
Das war gestern. Heute würde ich sagen, es ist umgekehrt: Stille und latente Unruhe. Sie beruht auf dem roten Buch. Und auf der Musik, die mir schon nachts durch den Kopf ging, meine Musik des Jahres, eine bestimmte Schubert-Aufnahme, real abrufbar im Moment nur indirekt (Fantasie C-dur, Carolin Widmann).
Heute, 1. Januar 2017 (mit Bezug auf vorigen Blogbeitrag)
Im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen 31.12.17 Seite 13 der Artikel „Genug gefeiert!“:
1867 Großes Werk: Karl Marx publiziert „Das Kapital“. Zitat der abschließenden Sätze:
Als Versuch, die Gesellschaft zu verstehen, in der wir leben, ist das Werk fast ohne Nachfolger geblieben. Dass man Marx nach 1989 für erledigt hielt, bleibt eine Torheit.
Die Wochenendausgabe der Süddeutschen
gibt unversehens Anlass, eine Stunde dem Sokrates zu widmen, ausgehend von seiner Todesstunde, ist das etwa zu viel verlangt? Aber es hört nicht auf und erinnert an den ersten bescheidenen Anfang mit der Philosophie. Ich glaube, begonnen hat es auf Langeoog, angeregt durch ältere Mitschüler: sie lasen sorgfältig, markierten Zusammenhänge und schrieben an den Rand des gelesenen Textes Stichworte zur Gliederung. Das hatte ich noch nie gesehen. Sie lasen „Einstein Mein Weltbild“, und mein Exemplar sah bald ähnlich aus:
Es war die Stunde und das Jahr der Taschenbücher, Einsteins Weltbild, das ging aufs Ganze, nichts war mir groß genug. Julian Huxleys „Entfaltung des Lebens“ war ein Schlüsselbuch 1955, ein Älterer (Langeoog!) nannte mir dazu noch den Namen und das Hauptwerk des Bruders Aldous, für mich ein Ritterschlag, ich vermerkte später die erneute Besitznahme im Jahre 1962… (Fischer „Bücher des Wissens“ gab es seit 1952, rde seit September 1955. Sehr wichtig weil erschwinglich! 1,20 oder 1,90 DM?)
Die nächste Stufe: Sokrates im Gespräch („Vorschule“ auf Langeoog) . . . .
. . . . 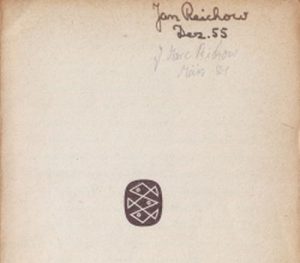 . . . .
. . . .
Besitzer 1955 (Besetzer 1981) Beide genau 15 Jahre alt!
Im März 1957 war endlich auch die Schule bei Plato (Sokrates) angelangt:
Ließ die Begeisterung nach? ich fürchte: ja. Jetzt wäre wieder der rechte Augenblick!
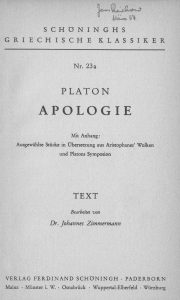 Fernziel Re-Lektüre bis März 2017 ?
Fernziel Re-Lektüre bis März 2017 ?
Fortsetzung folgt oder – Enkelgeneration: wäre diese Art Zugang heute noch denkbar?
Übrigens: das Bild, das mich heute aktivierte (ganz oben), kannte ich damals nicht. In unserm „Bilderbuch“ gab es nur „Die Ermordung des Marat“. Heute kann man ALLES kennen. Siehe HIER. (Tut mans? Will mans?) Es heißt also „Der Tod des Marat“, und es gibt nicht nur das Bild von Jacques-Louis David. Siehe HIER. (Vor allem ganz unten!)
Die (durchaus nachvollziehbare) Bild- und Bildungsverdrossenheit könnte ein Thema sein. Sie ist vielleicht viel brisanter als die vielbeklagte Politikverdrossenheit.
Es war damals leicht, weil klar war, dass man sich darum bemühen muss. Und wo es keinen Sinn hat. Heute ist es leicht, darum schiebt man die eigentliche Mühe auf. Sokrates ist zum Greifen nah, z.B. HIER. Oder sein berühmtester Satz HIER. (Interessant u.a. wegen Popper, dem „Stückwerk-Ingenieur“. Ein gutes Wort. Kann ich mir aneignen.) Neben Platons „erinnernden“ Dialogen (HIER ! Übersetzung und Originaltexte!) sind auch die des Xenophon leicht erreichbar, in Wielands Übersetzung HIER.
Interessantes Nebenergebnis ein ganz anderer Satz:
Muße beschreibt also einen Zustand, in dem Menschen sich wirklich auf etwas einlassen können. Dabei ist es egal, ob es die Gartenarbeit ist, ein interessantes Buch oder eine kreative Tätigkeit. Wichtig ist, dass niemand ein Ergebnis erwartet. Diese Ziel- und Ergebnislosigkeit erlaubt es, ohne Druck und Erwartung Neues auszuprobieren. (Figal)
Die Jugendlichen heute haben den leichten Zugang und versäumen ihn, indem sie lieber spielen und „daddeln“, vermeintlich vorläufig.
Natürlich ist Sokrates nur ein Beispiel. Ich hatte damals auch einmal zwei Bände Kant (Dünndruck, Bielefelder Stadtbücherei) mit auf Langeoog, auch ein größeres Sekundärwerk über ihn, nicht recht verstanden, – wieviel leichter wäre es heute, zunächst einen einfacher gefassten Überblick zu finden, – worum es eigentlich geht, wozu diese Abstraktionen, weshalb die Anstrengung des Gedankens in dieser Form nötig ist. Im täglichen Leben kann man doch offenbar wenig damit anfangen.
Und damit sind wir schon fast beim sogenannten gesunden Menschenverstand. Niemand kann sagen, ob das folgende Buch mir gehört, denn ich war es sicher nicht, der seinen Namen hineingeschrieben hat. Denn warum sollte ich damals meine Schrift verstellt haben, andererseits: warum sollte ein anderer meinen Namen verwendet haben? Vielleicht, um sich vor Aneignung des Büchleins zu schützen? Ich habe einen Verdacht. Das Problem ist nur: es bedeutet nichts, mal mache ich Spaß, mal meine ich es nicht ernst. Aber was wann?
Zum Glück bin ich nicht Sokrates. Und denke dabei nicht nur an den Schierlingsbecher.
In Haan, beim Italiener Piccolo Sud, habe ich (mit Kindern und Enkeln) auch immer mehrere Epochen und Stilebenen im Blick:
Ausgrabungen in Hamburg, Lüneburg & Celle 29.-31. Oktober
Lüneburg St. Johannis – Himmelsmusik an der Böhm-Orgel
 Buxtehude, Reincken
Buxtehude, Reincken Böhm, Bach
Böhm, Bach
Während ich dies schreibe, höre ich die obige CD, ich weiß: ein Sakrileg. Und ich habe auch schon gestern abend, sofort nach der Rückkehr von der Reise, den Boden dafür geschaffen: der Klang der Orgel, die Durchsichtigkeit der Polyphonie, das leichtfüßige Staccato, auch die Ton-Repetitionen in der witzigen Fuge von Reincken (Tr.6) oder der Figuren-Umtrieb in Bachs berühmter D-dur-Fuge (Tr.21), – wann hört man das schon in einem so verrückten Tempo! Hinreißend!
Grund der Hamburg-Reise: ein Familienfest (Diamantene Hochzeit), passend dazu ein Stammbaum, den einst der Bruder meines Vaters hat anfertigen lassen, der also vom Vater dieser beiden an, d.h. von meinem Großvater Bernhard Reichow an rückwärts in die geschichtliche Tiefe geht und mich also irgendwie betrifft. Ich könnte diesen Teil aus den von meinem Vater geerbten Dokumenten vervollständigen. Allerdings habe ich ein Detail neu entdeckt, das bei mir fehlte und weiter zurückreicht als der früheste Eintrag, den ich kenne. Die Kirchenbücher wurden zumeist im 30jährigen Krieg vernichtet, daher gibt es kaum eine biographisch relevante Information aus der Zeit davor. Bis auf eben diesen Eintrag, der oben im Scan nicht vollständig erfasst ist:
„Peter Reichow to Varchmin hat geborgt 5 Mark (Gegenwert einer Kuh) Bürge: Mathias Rotherkehle (Schuldverzeichnis zu Kordeshagen 1500)“
Ich kann nur hoffen, dass die Sache inzwischen erledigt ist.
Der Fußweg zum Familientreffen war traumhaft schön, direkt entlang am Ufer der Außenalster, die Mahnung, eventuellen Unrat betreffend, erreichte uns schon vorher, in der Alte Rabenstraße, und der Zufall wollte es, dass sich gleichzeitig ein Gruß aus dem uns vertrauten Rheinland in den Hintergrund des Bildes drängte. Der Dom.
Ich fasse mich kurz: wichtiges Zwischenziel auf der Rückreise war Lüneburg, aus meiner Sicht: die Stadt so zu sehen – die Kirche, die seine frühe Orgelwelt mitgeprägt hat -, wie ER sie wahrgenommen haben könnte. Jetzt allerdings wurde darin ein Luther-Musical vorbereitet. Ich versuche keine Zusammenfassung dessen, was eine sehr kompetente Dame bei der Kirchenführung vermittelt hat; nur diese Frage, der ich im Zusammenhang mit der norddeutschen Backstein-Gotik noch nie begegnet war: Galten die Backsteine in ihrer Eigenschaft als menschliches Machwerk tatsächlich als unedel, so dass sie im Innern der Kirche nicht würdig waren, das Gott geweihte Gebäude oder Teile desselben zu tragen, durch „Schlämmung“ optisch den edlen Gesteinsarten der südlichen Kathedralen angenähert werden mussten? Ich kann es nicht glauben. Wird nicht alles geweiht und „umgewidmet“, wenn es gottgefälligen Zwecken zugeordnet wird? Wenn aber nicht, sollte etwa hier der Schein genügen, während es im Innern schnöder Stein bleibt?
Also bitte, diese Kirche ist großartig, aber doch wohl nicht – wie behauptet – breiter als der Kölner Dom, – ich schwöre. Auch wenn man hier 44 m misst, und dort die Breite der Kölner Langhausfassade mit 45,19 m angegeben wird, und dies nur an der einen Stelle in der Mitte. Macht nichts! St. Johannis ist nach dem Vorbild des Lübecker Doms errichtet, wenn auch nur mit einem Turm, und mit diesem hat es eine besondere Bewandtnis: man sieht sofort, dass er nicht ganz gerade steht, was verzeihlich wäre nach – sagen wir – 600 Jahren. Aber die Geschichte ist ein Fall für sich:
Der nach einem durch Blitzschlag verursachten Brand im Jahre 1406 neu errichtete Turm von St. Johannis (Vollendung 1408) wirkt von allen Seiten aus schief: Der Dachstuhl ist im oberen Bereich korkenzieherförmig verformt. Die Turmspitze ist 220 cm aus dem Lot. Der Legende nach hat sich der Baumeister, nachdem er den Fehler bemerkt hatte, aus einem der oberen Fenster des Kirchturmes gestürzt, wurde aber durch einen vorbeifahrenden Heuwagen so glücklich aufgefangen, dass er am Leben blieb.
Quelle Wikipedia hier.
Nun zum jungen BACH. 2005, genau zu der Zeit, als Vogelsänger seine CD herausgab, gab es neue Forschungsergebnisse, die er noch nicht berücksichtigen konnte:
Aus heutiger Sicht ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Bach unmittelbar nach dem Stimmbruch als Schüler und möglicherweise auch Schreibgehilfe bei Georg Böhm wohnte. Die zweite Tabulaturhandschrift endet mit einer lateinischen Notiz in Böhms Handschrift (siehe Tafel 5b): Il Fine â Dom. Georg: Böhme descriptum ao. 1700 Lunaburgi (auch wenn manche dazu spitzfindig anmerken werden, diese Notiz belege für sich genommen weder Lehrer-Schüler-Verhältnis noch, dass Bach bei Böhm gewohnt hat). Tatsache ist, dass Bach – auf ausschließlich dem Meister vorbehaltenem, niederländischem Papier – Musik aus Böhms Bibliothek abgeschrieben hat, und dass seine Handschrift zu jenem Zeitpunkt der von Böhm ausgesprochen ähnlich war. Diese Anhaltspunkte genügen, um die rätselhafte Tatsache, dass Emanuel in seinem Brief an Forkel das entscheidende Wort – „sein [Lüneburger] Lehrer“ Böhm – ausgestrichen hat, als ein Zeichen der Loyalität des zweiten Sohnes gegenüber dem Vater zu enttarnen, der beharrlich behauptete, niemals einen ordentlichen Lehrer gehabt zu haben und als Autodidakt alles seiner eisernen Selbstdisziplin zu verdanken.
Im Lichte der neuen Quellenlage ist davon auszugehen, dass Sebastian Bach im Alter von 15 Jahren die schwierigsten Orgelstücke seiner Zeit zu spielen vermochte und dass er in Böhm einen einflussreichen Fürsprecher hatte, der in einer guten Position war, ihn seinem Hamburger Lehrer Reincken zu empfehlen (siehe Tafel 5b).* [Anmerkung weggelassen JR, zu den Tafeln s.u.] Reinckens Orgelspiel war von Opulenz und dramatischer Eindringlichkeit gekennzeichnet sowie von jenen plötzlichen, kühnen Eingebungen, durch die sich die norddeutsche Orgeltradition vom Stil Pachelbels und von der Thüringer Orgelschule unterschied, die Bach bei seinem älteren Bruder kennengelernt hatte.
Quelle John Eliot Gardiner: BACH Musik für die Himmelsburg / Hanser Verlag München 2016 (Zitat Seite 138) Aus dem Englischen von Richard Barth (Zitat Seite 132)
Dies ist eine der bedeutendsten Entdeckungen der neueren Bachforschung (bzw. der Bach-Forscher Michael Maul und Peter Wollny) , wie sie von Gardiner in seinem Buch dokumentiert wird:
Ich finde das sensationell genug, insbesondere aus privater Sicht, da ich sozusagen die doppelte Anschaffung des voluminösen Buches, zuerst im englischen Original, dann in der angenehm lesbaren deutschen Übersetzung, rechtfertigen möchte. („Hast Du nicht schon genug Bücher über Bach?“). Es ist eine unbezahlbare Fundgrube neuen, fundierten Wissens.
Einiges zu diesem Fund war schon a.a.O. auf Seite 127f zu lesen:
Ein Durchbruch war 2005 die Entdeckung von vier Musikfaszikeln in Weimar, die durch einen günstigen Zufall als theologische Handschriften katalogisiert und daher glücklicherweise im Kellergewölbe der im Jahr zuvor bei einem Brand schwer beschädigten Herzogin Anna Amalia Bibliothek aufbewahrt worden waren. Zwei davon waren Abschriften von in deutscher Orgeltabulatur notierten Werken von Dietrich Buxtehude und Johann Adam Reincken – in einer Handschrift, die zweifelsfrei dem jungen Bach zugeordnet werden konnte (siehe Tafeln 5a und 5b). Die auf ein einziges beschädigtes Blatt geschriebene Choralfantasie Nun freut euch, liebe Christen gmein von Buxtehude hat Bach offenbar während seiner Zeit in Ohrdruf abgeschrieben, als er noch unter der Vormundschaft seines Bruders stand.
[usw. hier wird der „Mondschein“-Legende vom heimlichen Abschreiben mit Recht die Grundlage entzogen.] Forts. a.a.O. Seite 130:
In Ohrdruf wütete gerade irgendeine Epidemie, als die beiden Freunde zu Fuß zu ihrer 300 Kilometer langen Reise gen Norden aufbrachen. Den Regentropfen auf Bachs Abschrift des Buxtehude-Stückes nach zu schließen, hatte er sie möglicherweise im Rucksack dabei.
***
Zur Orgel in St. Johannis (Lüneburg) – so die kompetente Exegetin des sakralen Raumes – sei noch zu beachten, was sie über die Stellung der Musik im Kosmos aussagt: ganz oben über ihr steht das Dreieck mit dem Namen Gottes, links und rechts davon die Sonne und der Mond, von dort kommt alles und schreibt sich in die Musik ein. Und dort unten hinter dem Spieltisch stehen die weiß-goldenen Engel mit den Posaunen („Originalinstrumente“, wurde gesagt), die in Richtung Altar zeigen, zum Zentrum des heiligen Geschehens, jenseits der Gemeinde.
 Fotos nach Wikipedia HIER
Fotos nach Wikipedia HIER
Und das ist auch etwas, was man sich nach der Lektüre der ersten Kapitel des Gardiner-Buches, etwa „Deutschland an der Schwelle der Aufklärung“, staunend klar macht: der Rationalismus mag in dieser Epoche entstanden sein, aber Maßstab allen Denkens in den deutschen Schulen und der gebildeten Öffentlichkeit war allein der Glaube. Musik wurde als ein göttliches Tun aufgefasst, sie kommt aus dem Zentrum, aber neben und mit ihr war allein die Theologie im gesamten Geistesleben präsent.
Luthers enger Vertrauter Philipp Melanchthon hatte bei der Ausarbeitung der Grundlinien des Lehrplans 1522 gemahnt: „Wenn die Theologie nicht der Anfang, die Mitte und das Ende des Lebens ist, dann hören wir auf, Menschen zu sein – wir kehren wieder in den Zustand von Tieren zurück.“ Alles musste daher auf die „Übung der Gottesfurcht“ und auf das Verinnerlichen der offiziellen Glaubenssätze der lutherischen Kirche ausgerichtet werden, der sogenannten Konkordienformel.
Quelle Gardiner a.a.O. Seite 82
Es ist aus heutiger Sicht unglaublich, wie wenig das, was damals gelehrt wurde, dem Weltbild dessen entsprach, was wir heute von einem denkenden, humanistisch und universal orientierten Menschen erwarten würden.
Trotzdem sollte man vorsichtig sein, wenn man Rückschlüsse auf Bach ziehen will; Gardiner ist weit davon entfernt, einen solchen Ausnahmekopf nach den Koordinaten einer finsteren Thüringer Provinzialität zu definieren.
Wie vielfach beschrieben wurde, lässt seine Musik auf eine Differenziertheit des Denkens schließen, die jener der führenden Mathematiker und Philosophen seiner Zeit nicht unähnlich war. Mir geht es hier darum, dass ihm die quasi-wissenschaftliche Sorgfalt, mit der er seine Musik später komponierte, nicht als Schuljunge eingepflanzt worden sein kann; dafür hatte der Unterricht zu wenig Ähnlichkeit mit einer rationalistischen oder aufgeklärten Erziehung. Trotzdem konnte das möglicherweise ein Teil der Erklärung für seinen ungewöhnlich ausgefeilten Sinn für Proportionen sein, der sich später in seinen Kompositionen manifestierte. Gerade die Tatsache, dass Rechnen in Bachs Schulzeit nicht als eigenes Fach unterrichtet wurde, hat es ihm vielleicht ermöglich, spontan Zusammenhänge herzustellen und sich jenes instinktive Gespür für Zahlen zu bewahren, das Kindern im Mathematikunterricht so leicht abhandenkommt.
Quelle Gardiner a.a.O. Seite 92
Ich breche schweren Herzens ab, nicht ohne zu erwähnen, dass mich dieses Kapitel eben besonders zufriedengestellt hat, weil einem Bach-Verehrer der Zwiespalt durchaus vertraut ist, der einerseits durch die ungeheure pietistische Überredungskraft der Bachschen Vokal-Musik, andererseits durch die emanzipatorische Wirkung der klaren musikalischen Struktur gegeben ist.
Ein anderes Mal vielleicht mehr über Celle. (Was gab es dort Besonderes? Ein gutes Essen zum Einbecker Bier im Ratskeller, wobei wir eine Nische weiter, hinter holzgeschnitzter Abgrenzung, eine bekannte Dame der Fernsehwelt wahrnehmen konnten: Barbara Wussow. Als wir 20 Minuten nach ihr und ihrer Begleitung unsere Mahlzeit beendet hatten, lag im Eingangsfenster schon aufgeschlagen das Gästebuch mit ihrem Konterfei und der Danksagung für eine Bewirtung nach 20 Jahren draußen in der Welt. Ich habs auf Handy, aber es passt nicht in die Umgebung dieses Artikels, weder dort ganz oben noch weiter unten, – abgesehen von dem abschließenden -ow ihres Namens.
Und ohne Frage hatte Bach es ebenfalls Böhm zu verdanken, dass er Gelegenheit hatte, ein im französischen Stil spielendes Orchester zu höre, sooft die Hofkapelle des Herzogs von Celle in Lüneburg zu Gast war.
Quelle Gardiner a.a.O. Seite 133f
Von 1665 bis 1705 erlebte Celle eine kulturelle Blüte als Residenz unter Herzog Georg Wilhelm. Dies ist besonders auf seine französische Gattin, Eleonore d’Olbreuse, zurückzuführen, die hugenottische Glaubensgenossen und italienische Baumeister nach Celle holte. In dieser Zeit wurden der Französische und der Italienische Gasten angelegt und das barocke Schlosstheater errichtet.
Quelle Wikipedia Celle
(Fotos: E.Reichow)
Nachtrag 2. November 2016
Erst heute entdeckt: ein Porträt der Orgel von St. Johannis in Lüneburg – mit Joachim Vogelsänger. (Übrigens haben wir vor 16 Jahren schon mal zusammengearbeitet, in der Johanneskirche Düsseldorf, siehe hier). Aufgrund seiner Ausführungen im folgenden Video erübrigt sich manches, was ich oben gemutmaßt habe, aber es ist nun mal aus meiner Sicht auch schon wieder „historisch“.
Zurück zum Stammbaum am Anfang dieses Artikels. Was hat es mit dem -ow am Ende eines Namens auf sich? Schauen Sie einfach mal bei Wikipedia nach: Hier.
Oder studieren Sie eine Landkarte. Aber seien Sie sicher: dort kennt mich keiner mehr. Falls aber doch, müsste ich vielleicht den Gegenwert einer Kuh zurückerstatten. Bleibe also lieber hier, in meiner Heimat. Und denke nicht an virtuellen Besitz oder Geld und Gut oder gar Rittergut. Womöglich nur dort … , sehen Sie den Punkt? Erste Abzweigung von dem Sträßchen zwischen Gr.Reichow und Kl.Reichow. Galgenberg steht da.
Vom Himmel auf Erden nicht müde werden
(Das Phänomen ist. Weder Lyrik noch Musik. Hier und dort vielleicht noch ein Klick.)
Texel – Bos en Duin – Paal Vijftien
(Fotos: ER & JR)
Nachtrag zuhaus
Abreise am 24. September 2016
Das Pferd hinten auf der Weide ist ein wichtiger Punkt der Erinnerung.
Eigentlich halte ich es so, dass direkt vor der Natur (wie bei einem Maler) nur das angeschaute (und gehörte) Phänomen im Betrachter sein sollte. Nichts, was ich dazudenke oder darüberstülpe, schon gar keine Begleitmusik. Das gelingt nicht immer. Der Wasserfall der Gedanken, meistens überflüssig, manchmal mit nützlichen „Schwebstoffen“, lässt sich kaum filtern. Hier wurde ich erwischt, als der Urlaub zuendeging und ich noch einen Ansatz für diesen Blogbeitrag suchte, ausgerechnet Popmusik:
Siehe dunklen Punkt im Mittelgrund.
Siehe linke Hand, Knopf im Ohr, angespannte Haltung…
Zehetmair in Stuttgart
Es steht noch immer die Frage im Raum: wer hatte die zweite Karte für die Stiftskirche? (Siehe hier – gegen Ende – und hier). Per Mail kam in Bezug auf ein privates Nachgespräch die folgende Mail:
Was mich übrigens bei Brahms' Bearbeitung immer störte, ist der Akkordwechsel vom G-dur (mit Quinte) zum e-moll in T.187. Irgendwie komisch und ungewohnt, wenn man Busoni im Ohr hat, der genau das nämlich vermeidet. Und jetzt habe ich mal Bachs original angesehen: keine Quinte, aber vor allem: kein Terzfall im Bass. Hier irrt Brahms für mich. Es klingt banal. Geradezu genial übrigens - und das hatte ich eben im Ohr... - ist hier Busoni: er legt einen oszillierenden Orgelpunkt ums D herum drunter und schreibt auf der bewussten Eins rechts den Akkord h-fis-g-h (über D), dann e-moll...
Dazu die folgenden beiden Scans, die ich durch die erwähnten Busoni-Takte ergänze:
Stimmt genau, war mir nie aufgefallen. Gerade der erste Akkord im 3. Takt des Bachschen Originals ( h – g – h ) mit seinem prekären Klang der verdoppelten Terz h ist einem als Geiger lieb, man möchte ihn nicht durch den Grundton monumentalisiert haben, der Wert des kompakten e-moll-Dreiklangs, grifftechnisch nicht einfach, würde gemindert. Großartig bei Busoni, diese Akkordfolge dissonantisch zu „präzisieren“, wenn auch der kompakte e-moll-Dreiklang nunmehr auf das letzte Achtel verlagert ist.
Dank an JMR!
Nachfrage zu Zehetmairs Verzierungen in Takt … („ist das original?“). Er hat es genau so schon in der Aufnahme von 1983 gemacht, vielleicht hat Harnoncourt das angeregt (oder ihm „durchgehen“ lassen). Die Begründung, dass in Bachs Zeit Wiederholungen nach Belieben oder Geschmack des Interpreten verziert werden konnten, würde ich in diesem Werk, das gewissermaßen von Anfang an (ab Takt 9) Variationen des Modells liefert, nicht gelten lassen. Bach geht bereits an die Grenze des Möglichen, – es ist nicht nötig (wenn auch möglich), ihn virtuos zu übertrumpfen.
(Fortsetzung folgt)
ZITAT (Ein Rätsel)
Bach entsann sich seines Gehrener Großoheims. Er war sieben Jahre alt gewesen, damals, als sich die Bache in Arnstadt trafen und allesamt den Heinrich Bach besuchten, der in seinem Zimmer lag und sonderbare Reden von sich gab. Wieder sah er die weißen Haare auf dem Linnen. Johann Michael Bach aus Gehren und Johann Christoph Bach aus Eisenach, die Söhne des Sterbenden, standen seitwärts in jenem Zimmer, friedfertig der eine aus Gehren, der sich immer klaglos in sein Schicksal fügte, und ungeduldig und immer voller Zorn der andere aus Eisenach, der mit ihnen nach Arnstadt gekommen war.
Als sie aufbrachen aus Eisenach, waren sie zu viert. Er, Bach, lief mit seinem Bruder Johann Jacob hinter dem Vater und dem Großoheim her, die beide gewaltig ausschritten. Johann Christoph gebrauchte starke Worte gegen die Eisenacher Obrigkeit, so sehr manchmal, daß die beiden vor ihnen in Streit gerierten. In Ohrdruf kam der ältere Bruder dazu, da waren es zwei Johann Christophs, die einander in Worten und Gebärden unterstützten und nun gemeinsam den Vater bedrängten, während sie immerfort liefen durch den Tambuch und durch Bittstädt und wieder über den Kamm der Berge bis nach Arnstadt. Sie beide, Johann Jacob und er, hatten Mühe, Schritt zu halten, und er wußte noch, daß linker Hand sich unendlich weit die Ebene erstreckte, während sie auf der Höhe liefen und die grelle Sonne über ihnen immer mitging und schwarze Schatten auf den Weg warf. Es fiel ihm ein, daß sein Vater viel eher dem Johann Michael aus Gehren glich als dessen Bruder. Auch er war unendlich geduldig, klagte nie und verurteilte niemanden.
„Wie sind Sie denn, Monsieur Bach, mit dem Gehrener Bach verwandt gewesen?“ Der Direktor der gräflichen Kapelle sah ihn an und fuhr fort: „Es gibt so viele Bache, daß man sie kaum auseinander halten kann.“
„Sein Großvater, der Spielmann aus Wechmar, war mein Urgroßvater. So hat es mir mein Vater erklärt.“
***
Ich ahne, warum ich damals diese Biographie zu lesen aufgehört habe: Wahrscheinlich habe ich nicht mehr durchgefunden. Heute ist es relativ leicht. Und vor allem: die letzte Motivation ist da… Ich verrate zunächst die Herkunft des Zitates:
Quelle Martin Stade: Der junge Bach / Roman / Hoffmann und Campe Hamburg 1985 / Seite 100 f
Jetzt folgt ein Ausschnitt aus dem zuverlässigen Stammbaum der Bach-Familie, der sich auf der Innenseite des rückwärtigen Buchdeckels von „Bachs Welt“ befindet, des Werkes, das ich nun seit unserem Arnstadt-Besuch am 11./12. Juli immer wieder zitiere. Autor: Volker Hagedorn. Rot umkreist sind die Namen, die im obigen Zitat vorkommen.
Weshalb ich ins Grübeln geriet: wer ist der zu Anfang des Zitates erwähnte Gehrener Großoheim, dessen sich [Johann Sebastian] Bach entsann? Und wo liegt überhaupt Gehren? (Es liegt im Ilm-Kreis, südwestlich von Rudolstadt.) War er etwa zuerst aus Gehren nach Eisenach gekommen, um dann mehr als die Hälfte des Wegs zurückzuwandern nach Arnstadt?
Mit dem Großoheim könnte Heinrich Bach (16) gemeint sein, denn der war der Bruder von Johann Sebastians (24) Großvater Johann Christoph (5). Dessen Sohn (Vater Johann Sebastians) hieß Ambrosius (11). Johann Michael Bach (14) aus Gehren und Johann Christoph Bach (13) waren Söhne von Heinrich Bach (16), sie waren also Cousins von Ambrosius (11).
Als sie zu viert von Eisenach nach Arnstadt wanderten, offenbar in zwei Zweiergruppen, liefen hinten Johann Sebastian Bach und sein Bruder Johann Jacob, vorneweg der Vater (11) und – der Großoheim (?). Wie bitte? Liegt der nicht im Sterben? Sogleich wird jedoch der Name Johann Christoph genannt, offenbar der Cousin (13) des Ambrosius (11), beide Eisenacher, die verständlicherweise über die Eisenacher Obrigkeit diskutierten, „so sehr manchmal, daß die beiden vor ihnen in Streit gerieten“. Vor ihnen? Sie schritten doch als erste, oder ist dies nun wieder von der hinteren Zweiergruppe aus erlebt? Offenbar. „In Ohrdruf kam der ältere Bruder dazu“, dessen Name ebenfalls Johann Christoph (22) ist, „da waren es zwei Johann Christophs“ (13 und 22), die „nun gemeinsam den Vater bedrängten“, nämlich den Ambrosius (*1645), der nur Vater des zweiten (*1671), jedoch Cousin des ersten (*1648) war, all drei gesehen aus der Perspektive Johann Sebastians. Aber nennt man, nannte man etwa den Cousin des Vaters nun auch „Großoheim“? – ich glaube nicht, vielleicht Großcousin, oder damals eher Großvetter, oder vielmehr – gar nichts mit „Groß-“ . Erschwert wird die Sache dadurch, dass bis 1750 der Begriff Oheim (Onkel) sich nur auf Bruder oder Schwager der Mutter bezog. Man studiere das alles anderenorts.
Der Grund, weshalb in diesem – übrigens durchaus gut geschriebenen – Roman der fälschlich „Großoheim“ genannte Onkel namens Johann Christoph (13) an dieser Stelle eine Rolle spielt, liegt in dessen Gehrener Bruder Johann Michael (14), der beim Erzählzeitpunkt bereits verstorben war.
Denn: seine Witwe lebt, und bei ihr soll es noch ein gutes Clavicord geben, vor allem aber auch vier hübsche Töchter. Und die jüngste unter ihnen – ja, das Märchen ist wahr – sie heißt Barbara und soll im Laufe des Romans Johann Sebastians erste Frau werden…
Wir aber wissen nun, was es bedeutet, wenn man sagt, er habe seine Cousine geheiratet. Es stimmt nicht so ganz. Nicht die Väter waren Brüder, sondern zwei der Großväter (in der männlichen Linie).
***
Siehe auch u.a. den Artikel „Mit Bach in Arnstadt und Wechmar“ HIER.
***
Habe ich recht? Die Geschichte geht später weiter, nach einer Schlägerei im Wirtshaus, in der Dachkammer:
Zuerst schlief er fest und traumlos, doch gegen Morgen stahlen sich ständig wechselnde Bilder in seinen Schlaf, die von Mal zu Mal deutlicher wurden.
Er lief neben dem drei Jahre älteren Bruder Johann Jacob, umgeben von dichten Dornenhecken, die immer wieder zurückwichen, er war müde und schrie, seine Beine täten ihm weh und er wollte zu seiner Mutter nach Eisenach, doch der Bruder, einen Kopf größer als er, packte ihn bei der Hand und zog ihn immer weiter. Vor ihnen lief plötzlich der Oheim, der Vater und sein großer Bruder aus Ohrdruf, der Oheim gestikulierte und schrie störrische Worte in den Himmel über sich, die Hecken wichen zurück und gaben den Blick frei auf Berge und Wälder zur rechten und auf die weite Tiefebene zur Linken, wo die Kirchtürme der Dörfer spitz und reglos wie verwurzelt mit der Erde und den Behausungen der Menschen sich erhoben und alles andere überragten. Und so liefen sie alle fünf weiter, unter der grellen, schattenwerfenden Sonne, bis sie plötzlich unter sich und vor ihnen Arnstadt erblickten, vieltürmig und die Häuser zusammengedrängt wie eine herde Schafe vom Band der steinernen Mauer.
Die drei Männer vor ihnen verharrten und sprachen ein Gebet, da sie angekommen waren und aus der Stadt heraus Glockengeläut erscholl. Kaum waren sie zu Ende damit, begann der Oheim wieder heftig zu reden, und er, das Kind Johann Sebastian, starrte ihn offenen Mundes an, da es ihm sonderbar vorkam, daß man seinem Vater Vorwürfe machen konnte.
„Du, Ambrosius, bist still und zahm wie ein neugeborenes Lamm. Du läßt dich hin und her schubsen und weißt nicht, was sich für unsereinen gehört. Du bist ebenso wie mein Bruder, der in Gehren sitzt. Der läßt sich die Hände binden und macht alles, was man von ihm will.“ der Oheim hielt inne, ließ die Hände sinken und sagte, indem er auf die Dörfer in der Ebene sah: „Mein Vater Heinrich hat es uns allen gesagt, daß wir von dort kommen und daß der Bauer Claus Bach zu uns gehört, den sie von 150 Jahren bei Mühlhausen verbrannt haben. Und den Caspar Bach sollen wir auch nicht vergessen, der zwanzig Jahre vorher bei Münzer und Pfeifer gewesen ist. Der Mensch soll sich wehren, solange es geht, daß er reinen Gewissens vor seinen Gott treten kann, wenn es soweit ist.“
Bach wußte, daß er im Bett lag und träumte. Er träumte und sah sich selbst, einen Jungen von sieben Jahren, der offenen Mundes und mit großen Augen den Oheim und den Vater ansah, diesen erregten und zornigen Oheim und seinen Vater (….).
Quelle Martin Stade: Der junge Bach / a.a.O. Seite 120 f