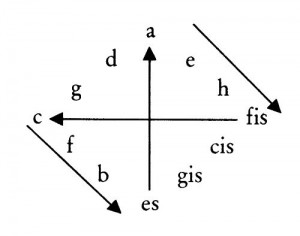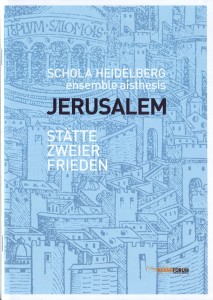Über einige Chill-Effekte und den Ernst der Lage

Ich möchte einige stark „emotionalisierte“ Situationen durchspielen, die ich selbst erfahren habe, von denen ich aber nicht weiß, ob ich ihre Wiederkehr wünsche oder eher fürchte. Sie sind mit einer Art Schrecken verbunden, der zwar nicht wirklich zu meiner Gefährdung führte, mir allerdings bedrohlich nahe kam. Bis hin zu einer „allzu primitiven“ Begeisterung.
1) Barrabam-Schrei aus Matthäus-Passion von Bach (Wut s.o.)
2) Die Folter-Szene in Puccinis „Tosca“ (Tenorschrei: Verismo)
3) Jede Wiederkehr des Leidens-Themas im Adagio der zweiten Schumann-Sinfonie
4) Bach „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ (sanftes, unerbittliches Gleichmaß)
5) Wagner Lohengrin Vorspiel (allmähliches Anwachsen des Stromes bis Beckenschlag)
6) Wagner Siegfrieds Schmiedelied (Sieg: Vibrato-Wucht auf dem Ton F s.u.)
7) Strauss Elektra (steigende Spannung bis Wiedererkennung „Orest!!!“)
8) Mahler „Ich hab‘ ein glühend Messer“ (Niederlage: „O weh!“)
9) Anfang des Klarinetten-Quintetts von Brahms (Terzentrost & Farbwechsel)

Die Anregung zu dieser Liste (die um viele Punkte erweitert werden könnte, zumal aus der nicht-klassischen und aus der nicht-westlichen Musik) gab das lapidare Forschungsergebnis, das die Forscher Altenmüller und Kopiez (2012) mitteilen:
Das einzige Merkmal, das in unseren Experimenten als eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Entstehung einer Chill-Reaktion gefunden wurde, war ein unerwarteter Bruch in der musikalischen Struktur oder, in der Terminologie von David Huron, eine Nichterfüllung von Erwartungen.
Ich würde hinzufügen: … oder in der hinausgeschobenen bzw. verspäteten Erfüllung von Erwartungen; [also doch ein nicht gerade unerwarteter Bruch? siehe Lohengrin].
1) Wenn man diesem Turba-Schrei zum erstenmal begegnet (bei mir etwa 1955), trifft er einen unvorbereitet, zumal die Erzählung sich etwas hinzieht: Pilatus hat die entscheidende Frage längst gestellt, Barrabam oder Jesum? Aber zunächst kommt noch „Pilati Weib“ mit ihrem Traum zu Wort, dann wieder die Hohenpriester und die Ältesten, dann noch einmal die Frage des Pilatus und die irreführende Formulierung des Evangelisten „Sie sprachen“ und in der nächsten Sekunde – statt eines Sprechens – dieser gewaltige Schrei, den der Herausgeber Kretzschmar mit einem fortefortissimo bezeichnet hat, ein verminderter Septakkord, der völlig aus der Tonart fällt. Es ist wie ein Angriff. Das Ungeheuerliche kommt erst im Nachhinein zu Bewusstsein, – als Jugendlicher setzt man die Grammophon-Nadel gern noch mehrfach zurück, bereits mit Gänsehaut, um nun andere dran teilhaben zu lassen, und rät beschwichtigend: „Wartet nur ab…“
Frage: Handelt es sich wirklich um eine musikalische Wirkung – oder um eine regietechnische Überrumpelung? (Anders als im Fall des unfassbar wilden Chores „Sind Blitze, sind Donner“, vor dem man ebenfalls längere Zeit stillgestellt wird durch das Duett „So ist mein Jesus nun gefangen“, – in Alarmbereitschaft versetzt immerhin nach dem ersten Einwurf des fassungslosen Chors der Gläubigen „Lasst ihn, haltet, bindet nicht!“).
2) Wie geschmacklos, diese Folterszene im 2. Akt, – Cavaradossis „echte“ Schreie aus dem Hinterzimmer, Toscas Verrat und die Frage des Gefolterten: „Hast du geschwiegen?“ Man will es nicht ertragen und auch – als notwendigen Ausweis der Realität nicht missen. Ist es so? Dürfte ich die Nadel noch einmal zurücksetzen (gab es da nicht diesen Trauermarsch?) oder vor den Worten des Verrats („Im Brunnen … dort im Garten“), diese 4 Akkorde überprüfen (sind das etwa die Tagesschau-Akkorde?) – oder willst du Sadist nur noch einmal die Schreie hören? Ich kann die Gänsehaut nicht leugnen… Für mich ist der Höhepunkt der Anfang (!) des 3. Aktes, der Nachthimmel, die Herdenglocken, die sich in der Ferne verlieren, das Lied des Hirten mit der Knabenstimme: „Io de‘ sospiri te ne rimanno tanto“ – „Ach soviel Seufzer sind Qualen meinem Herzen“. Dann die Morgenglocken!
Ein bloßer Bruch in der musikalischen Struktur?
3) Zitiert Schumann Bach? So dass ich sofort weiß, wie ernst das ist, dieses Leidensmotiv aus der Triosonate des „Musikalischen Opfers“? Aber dann der Rhythmus eines Schreittanzes im Untergrund (ich denke an Ravels Pavane, die mir ebenfalls eine Gänsehaut abfordert), das Unerbittliche in graziöser Verkleidung. Madame La Mort. (Eos erwähnte den Aufmarsch des Chores bei Sanchez-Verdú am Anfang des Jerusalem-Programms in Mannheim…) Hören! Die Wirkung der Klarinette bei 2’57. In diesem Fall spielt aber die Steigerung bei jeder Wiederkehr des Themas eine große Rolle: auch die Wirkung der Triller! Tränen sind geradezu unvermeidlich. Im Konzert würde ich dieses Stück meiden oder eine Rechenaufgabe dabei lösen.
4) Die sanften, gleichmäßig fließenden Sechzehntel sind es – gerade dieses Gleichmaß, ohne Bruch in der Struktur, ist entscheidend, die dadurch bedingte Verlangsamung der Melodie, das Heraustreten von Einzel-Intervallen und Kurz-Motiven, der Bedeutungszuwachs jedes einzelnen Harmonieganges, der Wechsel der Ebenen, die Wiederholung in der Tiefe, Intensivierung durch „Gewichtigkeit“. Choral-Melodien wirken bei Bach eigentlich immer als Momente der Wahrheit, besonders aber im Anfangschor der Matthäuspassion – dank der Knabenstimmen. Aber auch in vielen Werken, wo in Einzel-Zitaten ein Cantus Firmus auftaucht, dessen Melodie mit dem musikalischen Material der beteiligten Instrumente ansonsten weniger zu tun hat, sondern „unbeirrt“ auftaucht. Im vorliegenden Fall müsste ich dagegen die Wirkung der Chorals zeilenweise beschreiben, mit dem Höhepunkt ab Takt 9, mit As-dur-Kadenz – dann aber im Bass As – E – F – also Wendung in Richtung F-moll, statt dieses Akkords aber dann der Trugschluss Des-Dur, die Wendung über Es-dur nach C-moll und der Aufstieg der Melodie über die Töne Es – As – As – B – B – C: das alles ist letztlich so unbeschreiblich, als müsse gerade eine Geschichte von Leben und Tod ohne Worte erzählt werden. Vom Text weiß man nur „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ – nur diese leiseste Anrufung bleibt, in der letzten Stunde, – nur darum kann es sich handeln, um diesen Bruch… (Merkwürdigerweise gefällt mir keine der Aufnahmen, die auf youtube zu finden sind; gerade nicht die von Anna Gourari, wo mit romantischen Fotos auf die Tube gedrückt wird. Es muss sensibel, aber quasi ungerührt gestaltet werden. Mit Noten kann man das Stück bei Claudius Tanski studieren, aber hier ist es womöglich zu langsam, zu drückend, es gibt zu viele kleine Verzögerungen. Der unabänderliche Gang der Dinge ist Hintergrund unserer Erschütterung durch die melodisch-harmonischen Einzelmomente.Vielleicht handelt es sich bei den Sechzehnteln aber auch um den roten Faden (der Liebe), der sich durch alle Dunkelheiten der Harmoniewechsel zieht? Aber das ist schon eine Deutungsphantasie…
5) Lohengrin-Vorspiel – „Heilig“ sagt schon der erste Harmoniewechsel in höchster Höhe, kirchentonal ist der Wechsel zwischen Tonika und VI. Stufe und zurück, „funktionslos“. Das Heilige (oder das Leben?) ist ein tendenziell unendlicher Strom. HIER (Anfangsbeifall bis 0:40) Vorausahnung des Höhepunkts beginnt bei 5:33 = Crescendo-Beginn, es lässt nicht nach … 1. Beckenschlag bei 5:57, 2. Beckenschlag (schon im Abschwellen) bei 6:22 Rückkehr zum Anfang abgeschlossen bei 8:22
Die Chill-Wirkung, die ich aus den 50er Jahren in Erinnerung habe (als ich außer dem Vorspiel immer noch „Elsas Traum“ mit Begeisterung hörte – auch hier übrigens im Anfang die verminderte Quart, vgl. Bach/Schumann), bleibt jetzt aus, vielleicht auf Grund der dürftigen Klangqualität der alten youtube-Aufnahme.
6) Merkwürdigerweise gibt es den Chill der Freude selten, die Freude selbst dagegen immer wieder, – wieviel von Bach könnte ich benennen! Die Brandenburgischen Konzerte, Kantaten wie „Unser Mund sein voll Lachens“ oder die entsprechende Suite. Und ich muss mir nur den Anfang der Italienischen Sinfonie von Mendelssohn vorstellen, um leichten Herzens zu sein. Aber diese verrückte, überhebliche Freude an der eigenen Kraft, das brachiale Gefühl, der Welt gewachsen zu sein, ja, übermütig auf den Tisch zu schlagen, einen begeisterten Veitstanz aufzuführen, das stellt sich doch selten ein: kein Triumph mit wirklich gutem Gewissen! Aber hier mit den Hammerschlägen des Schmiedeliedes, das keine Hindernisse der Rücksicht kennt, da entsteht unwillkürlich ein glucksendes Lachen, dessen man im Nachhinein nicht froh ist. Ach dieser bösartige Giftzwerg Mime, der dem strahlenden Helden die tödliche Suppe köchelt, soll er mir etwa leid tun? Stimmgewalt… Wird er nicht rein stimmlich hinweggefegt, in jenen Takten, wo er mit seinen quäkenden Tönen keift: „lachen muss mir der Lohn!“ und Siegfried denselben Ton, das hohe F auf „Lohn“, in seinem „Hoho!“ überbietet und für einen Moment mit einem Fortissimo-Vibrato ins Uferlose treibt? Da kann man nur wie ein törichter Fußballfan aufspringen und mitgröhlen. Herrlich heldische Atavismen.
Unvergleichlich in dieser einen Aufnahme, wie so vieles in Soltis Jahrhundert-Ring aus dem Jahre 1962. Siehe HIER, der Wechsel des hohen F von Mime zu Siegfried (Gerhard Stolze, Wolfgang Windgassen) siehe ab (kurz nach) 1:18:05.
Sympathie für „die blonde Bestie“? Nur wenn man ihn für einen Halbstarken hält, der das Fürchten (und Fühlen) noch lernen wird. Am Ende vorstellbar als ein aufrechter Staatsbürger? Lächerlich. Von Sympathie spreche ich nicht, sondern von blinden Chill-Reaktionen.
Ich denke aber lieber an Freudekundgebungen wie die der Figaro- oder der Carmen-Ouvertüre.
7) In „Elektra“ ist es mehr die Situation als die Musik, obwohl gerade diese mit dem „Orest!“-Schrei der Elektra alle Dämme brechen lässt und einen riesigen Schwall der Motive und Emotionen entlädt. Die Wirkung hat essentiell mit der Ratlosigkeit vorher zu tun, mit dem Aufbau der Erwartung des wissenden Publikums, jede neue Frage erhöht die Spannung: „Wer bist denn du?“ bis „Wer bist du denn? Ich fürchte mich.“ Orest (sanft): „Die Hunde auf dem Hof erkennen mich, und meine Schwester nicht?“ Elektra (aufschreiend): „Orest!“
Es ist eine archaische Szene: die Angst vor dem Unbekannten und die Aufdeckung, die Wiedererkennung. (Die genannten Hunde sind durch Menschen vertreten…)


Nach diesem Schrei könnte statt der Orchestermusik anhaltendes Maschinengetöse zu hören sein, die Gänsehaut ist unvermeidlich. (Screenshots etwa bei 1:15:10 aus der BelAir-DVD mit Evelyn Herlitzius, Orchestre de Paris, Esa-Pekka Salonen, Patrice Chéreau.) Wiedererkennungsszenen, blitzartige Durchblick-Erlebnisse tun unvermeidlich Wirkung, ob Kitsch, ob Kunst. Bei Karl May und Rosemarie Pilcher ebenso wie bei Richard Strauss. Am Ende der Schiller-Ballade „Die Bürgschaft“: hier ist es der Erweis einer Freundschaft bis zum Tode. Und es muss sichtbar sein, wie auf einer Bühne: „Und Erstaunen ergreifet das Volk umher, / In den Armen liegen sich beide / Und weinen vor Schmerzen und Freude. / Da sieht man kein Auge tränenleer, / Und zum Könige bringt man die Wundermär, / Der fühlt ein menschliches Rühren, / Lässt schnell vor den Thron sie führen.“ Die im Hintergrund lauernde Gewalt löst sich auf in plakative Harmonie.
8) Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“, es geht um die früheste Aufnahme mit Dietrich Fischer-Dieskau und Furtwängler mit dem Philharmonia Orchestra (1952). Das, was mich beim ersten Mal ins Herz traf: der hohe Ton auf dem zweiten „Messer“: „Ich hab‘ ein glühend Messer, ein Messer in meiner Brust, oh weh, das schneid‘ so tief!“ Man höre genau diesen Anfang auf youtube: hier hat er die Wildheit des Ausdrucks noch kaum abgemildert wie in späteren Aufnahmen, und dennoch ist es kein roh-naturalistischer Ausbruch. Was für ein Übergang auch später, nach der ruhigeren Phase, wo die Erinnerung an „ihr silbern Lachen“ wieder umschlagen will in Raserei und die „O weh, o weh“-Klage in den ungeheuer, verzweifelt zusammenfassenden Satz übergeht: „Ich wollt‘ ich läg auf der schwarzen Bahr, könnt‘ nimmer, nimmer die Augen aufmachen“, dieser Vokal „a“ in „aufmachen“, – wen es da nicht von oben bis unten überläuft, der höre den nächsten Satz und beginne wieder von vorn… Ich behaupte, Fischer-Dieskau hat es nie wieder so erschütternd getroffen wie hier (ab 9’00). (Vielleicht weil ich damals auch noch ziemlich jung war???)
Der Wehe-Ruf der absteigenden kleinen Sekunde, der sich wiederum häufig in der Nähe der kleinen Sext aufwärts findet (wie auch hier bei „Ich wollt’…“, dem Beginn des Abstiegs, der wiederum sein Ziel hat in der kleinen Sekunde: „aufmachen“), gehört offenbar zum biologischen Stamm der Ur-Motive des Menschen. Ein Trennungsruf, der die kommunikative Verbindung meint. Also ein Stimmfühlungsruf, wie er dem Menschen seit frühen Zeiten vom Schrei des Bussards und dem Ruf des Gimpels vertraut ist. Der Neurowissenschaftler Jaak Panksepp bezieht sich bei seiner Untersuchung des Chill-Effekts mit einer gewissen Einseitigkeit auf dieses Phänomen:
Ein Sonderfall der akustisch ausgelösten Chill-Reaktion scheint bei mütterlichen Trennungsrufen einiger Affenarten aufzutreten. Diese Rufe führen bei den abgelegten Affenbabys zum Aufstellen der Haare. Jaak Panksepp argumentiert, dass Gefühle des Verlustes und der sozialen Kälte so durch die mütterlichen Laute gelindert werden können. Seiner Meinung nach könnte dies erklären, warum beim Menschen häufig Chill-Reaktionen bei trauriger oder sehnsuchtsvoller Musik auftreten. Kritisch anzumerken ist, dass bislang keine systematische Untersuchung dieser Chill-Reaktion bei Primaten durchgeführt wurde. Auch wenn Panksepps These häufig zitiert wird, haftet ihr somit etwas Anekdotisches an.
Quelle Eckart Altenmüller und Reinhard Kopiez: Starke Emotionen und Gänsehaut beim Musikhören: Evolutionäre und musikpsychologische Aspekte. In: 16. Multidisziplinäres Kolloqium der GEERS-STIFUNG 2012 Band 19 (Seite 59)
***
Die eben zitierte Artikel war das Movens für den vorliegenden Blog-Beitrag, der eigentlich nur als Stoffsammlung gedacht war, bevor er ausuferte, ohne zu einem Ende zu führen. Da das Thema untergründig und auf Nebenschauplätzen weiterwuchert, kam gestern – amazongesteuert – das Buch von Byung-Chul Han, bei dessen Lektüre ich an Musik denken werde. Auch hier ist Anekdotisches nicht auszuschließen.
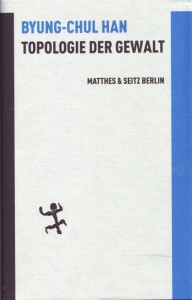
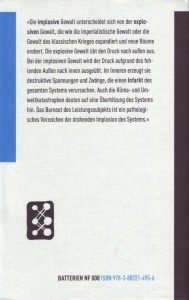
***
In welchem Maß die hier hervorgehobene Überschreitung des künstlerisch gebändigten Ausdrucks in Richtung „Schrei“ zum Allgemeinplatz geworden ist, kann man im Journalismus oft genug aufzeigen (ich will es auch gar nicht kritisieren), z.B. hier:
Eines der markantesten Beispiel seiner [Ferenc Fricsays] Interpretationskunst findet sich im „Fidelio“, wo auf Pizarros (Fischer-Dieskau) „Er sterbe“ ein einzigartig dramatischer Prozess in Gang gesetzt wird, der in Leonie Rysaneks Aufschrei „Töt‘ erst sein Weib!“ seine erste Entladung findet. Ein Schrei, der die Grenzen dessen erreicht, was Musik überhaupt ausdrücken kann. Kurz darauf ertönt, mit einem harmonischen Trugschluss die Botschaft aus einer anderen Welt versinnbildlichend, das ausgedehnte Sostenuto des Trompetensignals, das jeden jagenden Puls schlagartig verstummen lässt. Eine solch radikale Spannung zwischen Bewegung und gefühltem Stillstand ist bezeichend für Fricsays geballtes, kontrastbetontes Musisieren.
Quelle FONO FORUM November 2015 Seite 64 f Wider die Politur Im August 2014 wäre der Dirigent Ferenc Fricsay 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat sein ehemaliger Labelpartner im Jahresabstand zwei Boxen mit Einspielungen vorgelegt. Von Christoph Vratz.

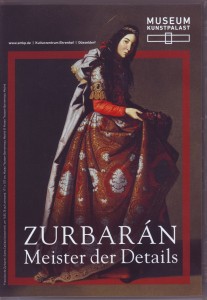












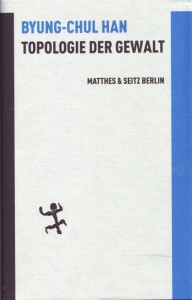
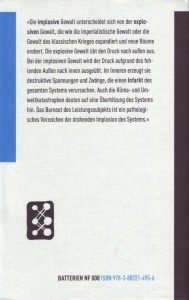



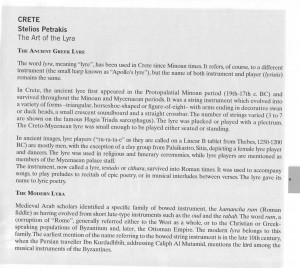
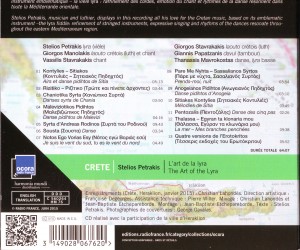

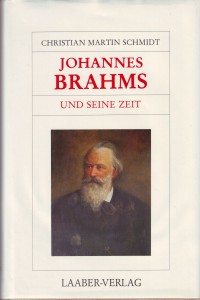 Christian Martin Schmidt
Christian Martin Schmidt