Zwölf Stücke op. 59
Veröffentlicht 1992 bei Intercord INT 860.872 LC 1109 (Redaktion Klassik, Ingrid Sonntag), nicht mehr erhältlich; seit 1994 bzw. 2000 ist der Firmensitz Stuttgart geschlossen.
Zwölf Stücke op. 59
Veröffentlicht 1992 bei Intercord INT 860.872 LC 1109 (Redaktion Klassik, Ingrid Sonntag), nicht mehr erhältlich; seit 1994 bzw. 2000 ist der Firmensitz Stuttgart geschlossen.
Ein Beispiel zur Musik in Indien und Europa
Ronald Kurt geht in seinem Buch (siehe hier) von Max Webers Entwurf aus und schreibt:
Immerhin, mit der Trias ‚Schriftlichkeit, Mehrstimmigkeit, Komposition‘ hatte Weber einen kategorischen Bezugsrahmen bereitgestellt, mit dem sich die abendländische Kunstmusik kultursoziologisch in den Blick nehmen ließ. Durch die Brille dieser (aus der eigenen Kultur für die eigene Kultur entwickelten) Begriffe nach Indien zu blicken, würde aber bedeuten, das Fremde in der Optik des Eigenen zu sehen. Um nicht gezielt am Anderen der indischen Kunstmusik vorbeizusehen, mussten angemessenere Begriffe her. Einerseits; andererseits erforderte die Logik des Vergleichens, dass die Begriffe für die indische Musik zu den von Weber gewählten Begriffen passen mussten. Nach der Lektüre der einschlägigen Fachliteratur, insbesondere Daniélous Einführung in die indische Musik (1982), Bagchees Buch Nād. Understanding Rāga Music (1998) und dem Indienartikel in Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG 1996) kristallisierten sich die Begriffe ‚Mündlichkeit‘, ‚Improvisation‘ und ‚Einstimmigkeit‘ als Kernbegriffe für die Charakterisierung der klassischen indischen Musik heraus. In diesem Sinne fasst auch Ravi Shankar die Hauptmerkmae der klassischen indischen Musik zusammen. In einem Radiointerview mit Radio France Internationale vom 16.02.1998, auf das ich bei Recherchen im Archiv von All India Radio in New Delhi stieß, sagte er: „Our music has been always a oral tradition, it is not a written down music […] and the performance of a raga is all improvisation, nothing is fixed […] we don’t use harmona or structured composed music like in the west“. Der Stimme des weltweit wohl bekanntesten indischen Musikers folgend, entschied ich mich dann für die Konstruktion von Begriffsdichotomien und spannte den Vergleich der Musikkulturen Indiens und Europas in die folgenden Gegensatzpaare ein:
Ich weiß nicht, warum Ronald Kurt hier ein Interview bemüht, das Ravi Shankar für ein westliches Medium gegeben hat. Mir scheint, dass der indische Meister situationsbedingt oder aus rein pädagogischen Gründen die Sache absurd vereinfacht. In seinem 30 Jahre früher erschienenen Buch „My Music, My Life“ (New York 1968) gibt er jedenfalls eine weit differenziertere Darstellung, die zu anderen Folgerungen zwingen würde. Und auch Daniélou hat in seiner „Einführung in die indische Musik“ (1975) Formulierungen gewählt, die sich kaum in das obige Schema fügen:
Nicht die melodische Folge der Töne ist wichtig, sondern die Gesamtheit aller Töne. Dies erklärt, weshalb die modale Musik bei ihrer Ausführung improvisiert werden kann. Das Bewußtsein des Musikers ist auf das Gebäude als Ganzes gerichtet, auf eine vertikale Struktur. (S.17)
Einerseits wieder eine fragwürdige Aussage über das Improvisieren, andererseits der wichtige Hinweis auf die vertikale Komponente der indischen Musik.
Mit Blick auf das Schema könnte ich fragen, ob mit der Mündlichkeit in Indien nun grundsätzlich etwas Nicht-Fixiertes gemeint sein soll, und ob die Schriftlichkeit im Westen eigentlich einer abweichenden, improvisatorisch erweiterten Interpretation wirklich entgegensteht. In jeder mündlichen Überlieferung gibt es doch durchaus fixierte (unantastbare) Gebilde: in der südindischen Tradition kennt man eindeutig melodisch-rhythmische Kompositionen, deren tongenaue Wiedergabe von allen Kennern streng überwacht wird. Die Werke bestimmter Komponisten um 1800 gelten bis heute als sakrosankt. Es gibt in Süd und Nord zahllose Trommel-Kompositionen, die zwar nur im Gedächtnis der Interpreten „aufgezeichnet“ sind, jedoch dergestalt verfügbar, dass sie z.B. als Geschenk weitergegeben werden können. Auch jeder nordindische Künstler kennt eine riesige Anzahl eigener und fremder „Compositions“, Melodiegebilde, die refrainartig wiederkehrend das Rückgrat seiner Konzertvorträge bilden.
Wenn etwa Joh. Seb. Bachs zweistimmige Inventionen einen hohen Grad entwickelter „Mehrstimmigkeit“ realisieren, darf man ein raffiniertes Wechselspiel zwischen Sitar-Melismen und Tabla-Rhythmen keineswegs als Beispiel für „Einstimmigkeit“ subsumieren. Die indische Improvisation ist einerseits nicht zu leugnen, andererseits wieder in vielen Details so streng determiniert, dass man dafür einen neuen Ausdruck wählen müsste, um nicht eine Freiheit vorzugaukeln, die dort fast ebensowenig besteht wie in Europa beim Vortrag einer Beethoven-Sonate. (Übrigens soll diese klingen, als werde sie gerade geschaffen, – und nicht wie ein Schrift-Stück.)
Ein wichtiger Punkt wäre, dass die westliche Kunstmusik im künstlich eingehegten Raum entstand bzw. geschaffen wurde (Kloster und Kirche), während Volksmusik nicht etwa aufhörte zu existieren, soziologisch jedoch vollständig ausgegliedert wurde. Die indische Raga-Musik (zweifellos Kunst-Musik) kann von sich behaupten, dass sie zu 100 % auf Volksmusik basiere (Madhup Mudgal im Interview 15.04.1995); Wechselwirkungen sind also strukturell nicht ausgeschlossen.
Um es zuzuspitzen könnte man sagen: die westliche Musik ist der exotische Sonderfall, die indische Musik der Normalfall. Indische Musik kann man lernen, indem man bei Null anfängt, beim Grundton(-Klang); westliche Musik kann man nur lernen, indem man einen Teil der gesamten Musikgeschichte durchwandert, also wenigstens von 1600 bis 1900. (Man fängt nicht bei Null an, sondern mit der Kadenz, der Harmoniefolge I – IV – V – I.) Wer es kürzer haben will, halte sich an Max Regers Leitsatz „B-a-c h ist Anfang und Ende der Musik“ und beginne mit den ersten 4 Takten des Wohltemperierten Claviers.
Übrigens habe ich Bauchschmerzen bei allen allgemeinen Ausführungen zur Musik in Indien und Europa, würde aber selbst sogleich mit den Details beginnen: die Behandlung (Aussparung) des Grundtons im indischen Raga Marva und die Bedeutung des „Neapolitaners“ in der westlichen Harmonielehre. Und so meldet sich Widerspruch, wenn ich bei Ronald Kurt auf Allgemeinheiten über Bach stoße, etwa Seite 36 – „Kunst der Fuge“ als Abschiedswerk (?), keinesfalls, man lese bei Peter Schleuning oder Christoph Wolff nach – , über Beethoven und das Subjektive als das „Allgemein-Menschliche“ (Seite 37). Oder bei dem Begriff der „Mimesis“, dessen Bedeutungsbreite auf das bloße Nachahmen im Schüler-Lehrer-Verhältnis reduziert wird, das in Indien extrem ausgeprägt sei. „Die Bereitschaft zur Mimesis fungiert dabei als Bedingung für die Möglichkeit, dem Unterscheiden die Ich-Grundlage zu entziehen.“ (Seite 120) Und schon sind wir im Philosophisch-Allgemeinen. Hervorzuheben wäre dagegen, dass der Unterricht bei einem Meister auch im Westen unabdingbar ist und nicht halbherzig vonstatten geht. Schüler, die dem Lehrer ständig ihr unerfahrenes Ich und ihre eigene kleine Meinung entgegensetzen, sind auch im Westen hoffnungslose Fälle. Die Unterordnung unter den Komponisten ist ohnehin allererstes Gebot. Wer dagegenhält mit „Aber ich fühle es anders!“ ist auch bei uns ein Dummkopf. Der Geist des Werkes ist bei uns traditionellerweise genau so hoch angesiedelt wie in Indien der Geist des Ragas. (Ein Unterschied besteht in der religiösen Anbindung, die in Bachs Zeit allerdings noch betont wurde; wenn sie fehlte, hörte er nichts als „ein teuflisch Geplärr und Geleyer“. In der Tat: das sieht man heute anders.)
Der Begriff der Mimesis (Ronald Kurt Seite 121) wird also als „nachahmende Handlung“ viel zu eng gesehen. Er wäre zu klären vor dem Hintergrund so heterogener Anwendungen wie in Berthold Auerbachs Buch zu Mimesis oder in der musikalischen Interpretationslehre von Adorno bis Jürgen Uhde und Renate Wieland:
Quelle Renate Wieland / Jürgen Uhde: Forschendes Üben. Wege instrumentalen Lernens. Über den Interpreten und den Körper als Instrument der Musik. / Bärenreiter Kassel etc. 2002
Man sage nicht: das sei ja der ganze Schrecken einer umfassenden Interpretationslehre. Die Übermittlung der Mimesis zwischen Lehrer und Schüler in diesem Sinn, die verbal ausformuliert unendlich viel Zeit in Anspruch nehmen würde, kann aber im direkten Unterricht durchaus wortlos geschehen. Das Stück liegt im Schriftbild vor ihnen auf dem Notenpult und wird in gemeinsamer Arbeit in Geste und Geist verwandelt. Fast wie in Indien – dort allerdings ohne Schriftbild.
P.S.
Übrigens ist meine Behandlung der Arbeit von Ronald Kurt nicht als grundsätzliche Kritik zu verstehen. Das Buch ist sehr aufschlussreich und in vieler Hinsicht empfehlenswert, es gibt nichts Vergleichbares! Und wenn ich einzelnes herausgreife, um es auf meine Weise zu untersuchen, so bin ich zugleich dankbar dafür, dass es mich aktiviert und herausfordert, – vielleicht vertraue ich zu sehr auf meine musikalische Intuition und misstraue unnötigerweise einem methodischen Ansatz, den ich nicht ganz angemessen finde. Wobei ich vor allem dann kritisch reagiere, wenn ich unsere eigene Musik allzu pauschal behandelt sehe. Das beginnt schon bei Max Weber, dessen Konzept der Rationalisierung letztlich auf einer Verabsolutierung und Idealisierung der abendländischen Harmonik beruht.
Zur Erinnerung (wie es bis Ende 2015 war)
Dies sind nur Screenshots. An Ort und Stelle kann man immer noch die Broschüren mit dem Verzeichnis aller Sendungen aufrufen. Also etwa (Stand 4. Februar 2016) HIER
Es gibt nach wie vor Sendungen zum Nachhören, wie hier die von Barbara Wrenger, gesendet am 31.05.2015: „Himalaya und Köln – Klänge hohen Glücks“.
Man weiß offenbar, was man daran hatte.
Auf diesem kleinen Sendeplatz, dem freundlich geduldeten Reservat der Musikkulturen (sonntags ab 16.05 Uhr), gibt es nun ab 2016 etwas ganz anderes: Klassische Musik in einer neuen Form der Präsentation. Lauter Einzelstücke als Klangteppich ohne Moderation, kunstvoll aneinandergefügt und mit Übergängen versehen von DJs, die uns aufgrund des Club-Charakters dieser Darbietung eine Erschließung neuer, mutmaßlich junger Publikumsschichten versprechen.
 direkt anzuklicken hier
direkt anzuklicken hier
Die Sendungen sind für den einmaligen Gebrauch, nachhören kann man sie nicht, klar, sie verstehen sich von selbst, jedoch kann man die ebenfalls recht wortkargen Musik-Ablaufpläne anklicken. Und Informationen über die DJs findet man in ausreichendem Maße hier.
Ich enthalte mich jeder Bewertung dieser Sendeform im Rahmen klassischer Musikvermittlung, erinnere nur daran, dass diese Präsentation, – die Idee, jeglichen historischen und narrativen Ballast abzuwerfen -, nicht neu ist. Die Frage bleibt, ob die Musik nun auch leichter wird und ihren (lästigen) Anspruch verliert. Ob nicht im Gegenteil die Gefahr wächst, dass sie in Bruchstücke der Beliebigkeit zerfällt. Während Klassik im emphatischem Sinn von Vertiefung lebt, nicht vom Vorrüberrauschen.
Die Soundscapes der 70er und 80er Jahre wären in Erinnerung zu rufen, Klarenz Barlows gigantische Klangwelt Calcutta, die anspruchsvollen „Reisen des Ohres“ (s.u.), selbst die Matinee Couleurs, in denen World-Music-Fragmente aneinandergehängt und überblendet wurden, ohne dass es weh tat, aber auch ohne dass es lange nachwirkte. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die ganzen Diskussionen, Widersprüche, Improvisationen und Experimente wieder revue passieren lassen soll.
Nein, ich sehe doch: – heute überlegt man auch sehr genau, wie man mit der Musik umgeht, wenn schon mal entschieden ist, dass sie im Prinzip aus den etwas unhandlichen klassischen Bausteinen bestehen soll. Aus dem Umgang mit ihnen lässt sich in jedem Fall etwas lernen. Wenn nicht über ihren Geist, so über unseren Zeitgeist.
Aus einzelnen Werken formt der „WDR 3 Klassik Klub“ ein neues und ganzes Hörerlebnis mit eigener Dramaturgie. So kommt ein Stück Club-Kultur ins Radio.
Viele Vorgaben macht WDR 3-Redakteur Michael Breugst den DJs nicht. Außer, dass die Mischung abwechslungsreich und spannend sein soll: nicht zu viel aus dem gleichen Jahrhundert, nicht nur leicht, sondern auch mit dem Mut zum Bruch innerhalb eines Mixes. Der Sonntag soll ein Tag auf WDR 3 sein, der sich auch für klassikaffine Einsteiger eignet. Und da muss die Mischung stimmen.
„Ich hatte einen Versuch gemacht, das ganz konventionell anzugehen, (…) nämlich Stücke zu suchen, die von der Tonart und der Stimmung gut zueinander passen und diese auch durchaus mit einer kleinen Pause hintereinander zu spielen. das erschien mir aber dann etwas ermüdend.“
„Ich habe wirklich Übergänge gemacht, teilweise auch Überlappungen, Überblendungen, wo sich das anbietet. Und ich habe dazu produziert, mit Effekten gearbeitet, ganz unterschiedlich von Stück zu Stück.“
… [er kann nämlich] Sampler einsetzen und – wenn nötig – mit seinen analogen Synthesizern Übergänge basteln.
Eine aufwändige Denk- und Bastelarbeit, die sich gelohnt hat. Die Sendung wirkt wie aus einem Guss und nimmt den Hörer mit auf eine musikalische Reise. Dabei stammt die Musik aus allen Epochen. Brahms, Ravel, Strawinsky, Prokofjew, Chopin und Mozart tauchen in der Playlist auf, ein traditioneller marokkanischer Tanz mit Streichquartett und Minimal Music von Komponist Philip Glass.
Dennoch: Blume würde nie ein komplettes Stück einen Ganzton höher pitchen, damit die Tonart passt. Für vier Takte am Anfang erlaubt er sich diesen Trick aber schon. Er schneidet auch niemals Takte am Anfang oder Ende eines Stückes weg. Aber er produziert aus Elementen der Musik ein bisschen was dazu, um Übergänge zu bauen, verwendet dabei sogar gelegentlich Vogelzwitschern. Aber gering dosiert, fast unauffällig.
„Es ist ein schmaler Grat, (…), die Stücke sollen sich in der Sendung zu einem neuen funktionierenden Ganzen zusammenfügen, man muss aber auch sehr respektvoll mit dem Material umgehen.“
Auch sein Kollege Jürgen Grözinger will „sehr sensibel herangehen, da ich vor einem Radiopublikum bin. Ich würde nicht wagen, die Stücke hinsichtlich Geschwindigkeit oder mit Effekten zu verändern.“
Auf jeden Fall sei die Sendung „eine sehr schöne Spielwiese“, so Blume.
Quelle print Das Magazin des WDR Februar 2016 Seite 37 ff „Einmal KLASSIK am Stück, bitte“ (Christian Gottschalk)
P.S. Ich habe den marokkanischen Tanz rot hervorgehoben, weil er hier vielleicht als kühnes Element gilt. Ein Mini-Mahnmal dessen, was an dieser Stelle und in diesem Programm einmal möglich war.
***
Zurück in die Zukunft! Hiermit soll keine Priorität beansprucht werden. Sicher ist nur: Das Radio ist selten ganz neu erfunden worden, erst recht nicht in jüngster Zeit. Insofern hilft ein Blick in die Geschichte:
„In der folgenden Sendung und an den nächsten beiden Sonnabenden zur selben Zeit geht es um Musikwelten und musikalische Welterfahrung, Sendungen, in denen kein Wort der Erklärung gesprochen wird. Gewiß, jedes akustische Zitat hat etwas zu bedeuten, d.h. der Autor hat sich etwas gedacht bei der Auswahl und Aneinanderreihung dieser Hörstücke aus dem Wald, dem Wasser, Dörfern des Balkan, aus Orient und Okzident: er versuchte nämlich Natur und Kunst voneinander zu unterscheiden und bemerkte, daß das Ohr daran nicht interessiert ist. Da´ß es gern und ständig mit diesen verschiedenen Schichten der Wirklichkeit umgeht; in der Natur wie in der Kunst. Wollen Sie Ihrem Ohr diese einstündige Reise zwischen Abend und Morgen erlauben? Idee und Zusammenstellung: Jan Reichow“.
Geplant waren folgende drei Sendungen, die allerdings so erfolgreich waren, dass eine ganze Sendereihe daraus wurde.
Der Plan der ersten Sendung, wie ihn der „DJ“ damals, lange vor der Einführung der Digitalisierung ausgearbeitet hatte:
Für einen späteren Zeitpunkt habe ich mir vorgenommen, alle Sendungen dieser Reihe aufzulisten und zu dokumentieren. Vielleicht werde ich damit endlich berühmt. Und habe nur zuviel geredet. Ich habe sogar noch eine schöne wortlose Sendung in Erinnerung, in der Iranische Tar- und Santur-Fantasien sich mit Bachschen Cembalo-Toccaten nahtlos zusammenfügten. In der Tat, es ging um wechselseitige Beleuchtungen, und zumindest ich war hin- und hergerissen von den erhellenden Wirkungen der bloßen Musik.
P.S.
Was ich jetzt noch nicht erzählt habe? Weshalb ich eines Tages völlig damit aufgehört habe. Es war die Furcht vor der Beliebigkeit. Die Sorge, Meisterwerke oder Meisterleistungen zu „verheizen“, ohne dem falschen Einverständnis wenigstens verbale Stolpersteine in den Weg gelegt zu haben…
Gute Musik braucht guten Kontext.
(Deshalb konnte ich mich auch nie mit der Sendung „WDR 3.pm“ anfreunden. Stichworte: Beliebigkeit + zu wenig Respekt gegenüber hochrangigen Bestandteilen + unangemessen ironischer Blick von weit oben )
***
Ein gutes Beispiel verbaler und physischer Klassik-Vereinnahmung kommt gerade aus dem – was auch immer das ist – „clubzwei“ in München:
Die Goldberg-Variationen wurden geschrieben, um in eine tiefere Entspannung zu gelangen. Sie tragen eine wirkmächtige, hypnotische Kraft in sich. Jacques Palminger wird diese Energie freisetzen. In einer konzertanten Séance macht er die heilenden Frequenzen, die magisch reale Schönheit und die alles durchdringende Wahrhaftigkeit der Goldberg-Variationen zu einer bewusstseinserweiternden Erfahrung. In einem luftigen, sich immer weiter verdichtenden Netz aus Einflüsterungen, Wachträumen und assoziativen Gedichten aktiviert er das suggestive Potential dieser Jahrhundert-Komposition. Nach dem Vorbild der jamaikanischen Dub-Musik werden die Variationen in Echtzeit verlangsamt und mit psychoakustischen Effekten belegt, um so ihre Wirkung voll zu entfalten. Unterstützt wird Palminger durch den Jazz-Musiker, Bach-Intimus und Multi-Instrumentalisten Lieven Brunckhorst.
„Erwarten Sie nichts weniger als eine mental-positivistische Gruppenhypnose mit surrealistischem Mehrwert und maximalem Glücksversprechen. Diese musikalische Lesung hat den Anspruch, der zauberhafteste Abend des Jahres zu werden. Die Fallhöhe ist enorm, die Chancen stehen gut. Lernen Sie, Ihre innere Katze zu streicheln und Ihre Leber zur Sonne zu drehen! Kommen Sie mit auf den Goldberg!“ (Jacques Palminger)
Kann es überhaupt bessere Worte geben, um das Elend der Musik heute zu beschreiben?
Das Schicksal einer Abschrift (Quelle C)
Quelle Mus.ms. Bach P 267 Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Germany (http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/) Vgl. auch den Artikel hier.
Wer auch immer diese Abschrift der „Sonata I ma“ angefertigt hat, er verstand etwas davon, aber derjenige, der sie mit Überschrift versehen hat, zeigt auch einen gewissen Abstand, sonst hätte er (wer auch immer) nicht im Zusatz zur Titelzeile hervorgehoben, dass sie von dem „berümbden Bach“ stammt. Vielleicht gibt die Notiz am Ende des Notenblattes einige Hinweise?
Der vierzeilige Text wurde bereits im ersten Kritischen Bericht (Hausswald 1950) im Detail entziffert:
Dieses von Joh. Sebast. Bach eigenhändig geschriebene / treffliche Werck, fand ich unter altem, für den Butterladen / bestimmtem Papier, in dem Nachlasse des Clavierspielers Palschau / zu St. Petersburg 1814. Georg Pölchau.
Von Bach „eigenhändig geschrieben“ sicher nicht. Aber wer ist der Clavierspieler Palschau, und wer ist Georg Pölchau, der Schreiber dieser Zeilen? Wie kam das Konvolut der Noten, zu denen auch dieses Blatt gehört, nach Petersburg, wo letzterer es auffand?
Georg Pölchau kannte sich aus: geboren 1773 in Kremon bei RIGA, wo er 1785-1792 die Domsingschule besucht hat, gestorben 1836 in Berlin, war einer der größten Notensammler seiner Zeit. Ihm war z.B. der Kauf der Bibliotheken und Nachlässe von N. Forkel und C. Ph. E. Bach geglückt, er besaß zahlreiche Autographe J. S. Bachs. Nach der Heirat (1811) mit einer Frau aus wohlhabenden Hamburger Verhältnissen zog er 1813 mit seiner Familie nach Berlin und konnte sich nunmehr ganz seiner Sammeltätigkeit widmen. Er unternahm dafür zahlreiche Reisen nach Mitteldeutschland, Süddeutschland und Osteuropa. (Siehe MGG 2005 Bd.13)
Der Komponist und Clavecinist Wilhelm Johann Gottfried Palschau ist am 1741 in Kopenhagen geboren und 1815 in St. Petersburg gestorben. Er studierte in RIGA bei Johann Gottfried Müthel, ab 1777 erwarb er sich in St. Petersburg den Ruf eines angesehenen Clavecinisten und Pädagogen. (Nach Alexander Schwab: Migration deutscher Komponisten und Musiker, 2005)
Johann Gottfried Müthel (1728-1788) steht für die direkte Verbindung zu Johann Sebastian Bach. Siehe Wikipedia. Darin:
Zur Perfektionierung seiner musikalischen Fähigkeiten wurde Müthel [1750] ein Urlaub für die Dauer eines Jahres gewährt. Diesen begann er zunächst als einer der letzten Schüler Johann Sebastian Bachs, in dessen Haushalt er auch wohnte. Auch wenn Bach bereits drei Monate nach seinem Eintreffen verstarb, konnte sich Müthel als Kopist des schon erblindeten Meisters intensiv mit dessen Schaffen auseinandersetzen.
Man kann aus den persönlichen und geographischen Zusammenhängen nicht unbedingt schließen, dass Palschaus Bach-Noten aus dem Besitz von Müthel stammen und somit vielleicht aus der unmittelbaren Umgebung J. S. Bachs. Die Vorlage dieser Gebrauchsexemplare – so sagt der Kritische Bericht (1950), der neuere ist mir leider noch nicht zugänglich – kann aber auch nicht Bachs Autograph von 1720 gewesen sein, sondern möglicherweise eine frühere Fassung.
Irritierend ist zudem die Tatsache, dass Pölchau die Noten aus dem Nachlass Palschaus im Jahre 1814 entdeckt hat, dieser aber erst 1815 gestorben ist. Hat er also noch gelebt, als Pölchau die Blätter im Altpapier entdeckte???
Einige ungelöste Rätsel…
Nur nicht in einem Punkt: auch in dieser, Bach gewiss sehr nahestehenden Abschrift steht im Takt 3 dies Adagios (Zeile 2) ein klares b als Vorzeichen vor dem untersten Ton des dreistimmigen Akkords. An dieser Stelle ein E zu spielen, das die Schärfe der Dissonanz verdirbt, sollte man nicht mit einer subjektiven „künstlerischen Entscheidung“ begründen oder gar mit dem Urtext: Bach hat es in seiner Reinschrift von 1720 einzuzeichnen vergessen, weil es so selbstverständlich geworden war.
Max Reger z.B. am 11. Mai 1916 !
Gestern traf per Post diese Neuaufnahme der Choralfantasien (Reger: „Phantasien“) für Orgel ein, höchst erfreulich, Musikproduktion Dabringhaus und Grimm. Grund genug für mich, meine Reger-Aktivitäten von vor 25 Jahren zu überdenken. Sie begannen nicht aus eigenem Antrieb, aber die Aufnahmen mit Christoph Bossert, die ich damals vorweg zu hören bekam, faszinierten mich. Und für die Firma Intercord sollte es der Start für die Produktion des gesamten Orgelwerks werden; das Unternehmen gedieh aber leider nur bis dritten oder vierten CD, dann wurde die Firma aufgelöst, und die so sorgfältig vorbereitete Edition verschwand vom Markt, den es natürlich für Orgelwerke im krass kommerziellen Sinne nicht gibt. Um so wichtiger, wenn eine neue Initiative entsteht und diese Klänge in ihrer unerhörten Gewalt wiedererweckt.
Da auch meine Texte damals in der Versenkung verschwunden sind, möchte ich sie bei diesem Anlass wieder hervorholen, vielleicht als Anreiz, die Regerschen Orgelwerke aufs neue ernstzunehmen, ebenso die romantischen Orgeln, für die sie geschrieben wurden. Ich jedenfalls brauchte die gedankliche Motivation und eine Zeit der Versenkung in diese Welt, der ich ansonsten ferngerückt war. Und der Text sollte, indem er doch zuweilen recht weit ausholte, diese Anstrengung widerspiegeln und vielleicht – so meine Hoffnung – auch Menschen musikalisch motivieren, die gerade nicht von Kirchenmusik geprägt sind.
Die neue, oben abgebildete Doppel-CD enthält selbstverständlich einen eigenen Einführungstext, der vom Organisten selbst stammt und authentische Auskunft über die Werke, die Orgeln und den Interpreten gibt. Erwähnt sei, dass er u.a. bei Christoph Bossert studiert hat.
 Noten nach Edition Breitkopf 8490
Noten nach Edition Breitkopf 8490
Die äußere Form des Booklets und die sorgfältige Gestaltung war bei Intercord der Bearbeitung durch Ingrid Sonntag zu verdanken.
***
Über Balász Szabó siehe hier. Bemerkenswert ist, dass die Doppel-CD der Regerschen Choral-Phantasien auch die Choral-Fantasie von Heinrich Reimann enthält, die 1896 zum Auslöser der Regerschen Kompositionswelle und in seinem op. 40 Nr. 1 gewissermaßen überboten wurde: „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.
Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Choralmelodien war, dass die zu Grunde liegenden Choräle in Dur stehen. In allen Fantasien entwickelt sich aus einem düsteren Anfang eine krönender, heller Abschluss ähnlich wie bei Reimanns Phantasie: „Durch Nacht zum Licht“ (Volbach). Die „Projektion des Höhepunktes auf den Schluß“ kann als ein übliches Verfahren der großen symphonischen Formen des 19. Jahrhunderts klassifiziert werden. So wird die ‚Apotheose‘ in der letzten Choralzeile als Krönung der Fuge mit allen Mitteln erfüllt. Auch der Inhalt der Choraltexte unterstreicht diese Tendenz.
(Aus dem Booklet von Dr. Balász Szabó)
Selbstprüfung
Hören Sie diese (oder jede andere) Aufnahme der Regerschen Choralphantasie und versuchen Sie, die Choralmelodie zu erkennen oder gar mitzusingen, ohne die Noten zuhilfe zu nehmen. Sie ist vollständig in das ganze Klanggewebe eingelassen, und die Töne sind auch in der linearen, figurativen Verarbeitung durchaus nicht hervorgehoben. Der Organist hat sie natürlich jederzeit im Auge, Reger hat die betreffenden Stellen sogar mit dem fortlaufenden Text der Strophen versehen. Ich behaupte: Sie (oder ich), nein: niemand, der im Kirchenschiff sitzt und aufmerksam zuhört, erkennt die Melodie.
Was sagt das über die Musik oder über unsere Musikalität?
Versuchen Sie, keine regressive Antwort zu geben. Es ist eine Fangfrage. Der Sinn der Musik ist ja keinesfalls , völlig durchsichtig zu sein oder unsere detektivischen Fähigkeiten zu bestätigen…
Sie „darf“ größer sein als wir selbst.
Ich will niemandem zu nahe treten, am wenigsten dem hier dargestellten Menschen eines anderen Jahrhunderts, aber auch nicht dem musizierenden Freund, der einen Bach-Abend gab und als Schmuck des Programms dieses Gemälde beifügte. Jedenfalls kann ich in Betrachtung dieser Visage nicht konzentriert zuhören: wie nennt man das, wenn jemand einen so impertinent mustert? Im nächsten Moment wird er mich aus dem Saal weisen, ja, er ist eine Aufsichtsperson, er bezweifelt, dass ich überhaupt eine Eintrittskarte habe.
Wenn dies hier das Gesicht von Johann Sebastian Bach ist, dann hat dessen Musik ein ganz anderer geschrieben. Vielleicht Shakespeare oder Casanova oder James Cook oder Rabelais. Aber nicht dieser Mann.
Ich weiß nicht, welche Berechtigung besteht, ihn für Johann Sebastian Bach auszugeben. Schon wieder ein falscher Ton in der Überlieferung? Ein schlechter Zug um den Mund, ein kleinbürgerlicher Blick? Nein, nicht der Dargestellte ist zu diffamieren, er wird ja erst lächerlich, wenn man seine Bedeutung überschätzt. Ohne die Sonntagskleidung, einfach so als Schneider oder hinterm Bankschalter: super, der Mann!
Es geht nicht anders, wir sind aufgerufen nachzuforschen, – ad acta legen, das geht überhaupt nicht. Es sei denn, unter einem anderen Namen. Meinetwegen auch als Johann Jacob Reichow, Mühlenbesitzer in Roggow/Hinterpommern.
***
Ich füge einmal an, was ich auf die Schnelle fand. Neben dem Bild war zu lesen – abgesehen von dem Namen, den ich nicht akzeptieren mag – „Meininger Pastell“ von Gottlieb Friedrich Bach.
Wer ist das?
Kabinettmaler, Hoforganist; geb. 10. 9. 1714, gest. 24. 2. 1785 (begraben 26. 2.1785). Der
jüngere Sohn von Johann Ludwig Bach besuchte das Meininger Lyzeum, trat 1721 in die IV.
Klasse ein und verließ es 1729 nach Absolvieren der Primarstufe. Nach dem Tod seines
Vaters 1731 spielte er bis zur Rückkehr seinesälteren Bruders Samuel Anton Jacob die Orgel in der Schloßkirche. Etc. etc.
Gottlieb Friedrich Bach unterhielt offenbar engere Beziehungen zu Johann Sebastian Bach sowie zu Carl Philipp Emanuel Bach. Möglicherweise hielt er sich zwischen 1740 und 1745 in Leipzig auf und malte ein Bild von Johann Sebastian Bach. Ein Porträt Carl Philipp Emanuel Bachs ist jedenfalls bekannt.
Und wer war sein Vater Johann Ludwig Bach?
Lehrer, Kantor, Pageninformator, Hofkantor, Kapellmeister, Komponist, Lehrer; get. 6. 2.
1677 Thal, begraben 1. 5. 1731 Meiningen. Der Sohn von Johann Jacob Bach (1655 -1718)
und Anna Martha Bach, geb. Schneider wuchs wie sein 8 Jahre jüngerer Vetter Johann
Sebastian in einem musikalischen Haushalt auf und erhielt die erste musikalische Ausbildung bei seinem Vater. Er besuchte 1688 -1693 die Lateinschule in Gotha, wo u. a. Wolfgang Michael Mylius (1636 -1712) und Johann Pachelbel wirkten. Etc. etc.
1726 führte Johann Sebastian Bach mehrere Kantaten Johann Ludwig Bachs in Leipzig auf. Von Johann Ludwig Bachs weltlichem und geistlichem Werk ist nur ein Bruchteil erhalten. Das eindrucksvollste Werk der überlieferten geistlichen Vokalmusik ist die Trauermusik auf den 1724 verstorbenen Herzog Ernst Ludwig I. von Sachsen-Coburg-Meiningen.
Quelle
Maren Goltz : Musiker-Lexikon des Herzogtums Sachsen-Meiningen (1680 – 1918) HIER
WIKIPEDIA: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Friedrich_Bach , darin zu lesen:
Er porträtierte seinen Vater Johann Ludwig Bach, Carl Philipp Emanuel Bach sowie Mitglieder des Meininger Herzoghauses und andere Thüringer Fürsten. Carl Philipp Emanuel Bach berichtete auch von einem Porträt Johann Sebastian Bachs, doch ist darüber heute nichts Sicheres bekannt.
Das Rätsel ist geklärt (jedenfalls mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit):
Erkennen Sie das Portrait wieder? Rechte Seite, in der Mitte. Es handelt sich demnach um Wilhelm Friedemann Bach. Und direkt darüber befindet sich ein mit Fragezeichen versehenes Bild von „Johann Sebastian Bach“ (auch hier würde ich sagen: ihn stellt es keinesfalls dar). Mittlere Spalte, Bild 1 und 2: Carl Philipp Emanuel Bach? Ja, er ist es unverkennbar. (Friedemann – rechts – ist ebenfalls glaubwürdig, vgl. z.B. hier. Jetzt würde ich den Gesichtsausdruck natürlich auch ganz anders deuten…)
Quelle Neil Jeffares: Dictionary of pastellists before 1800, online editin, darin: BACH, Gottlieb Friedrich / Meiningen 1717–1785 – Aufzufinden HIER.
Nachtrag 8. Februar 2016
Der kritisierte Freund hat mir widersprochen, und ich fürchte – er hat recht, hier seine Mail:
Du hast vermutlich übersehen, dass in dem Online-Buch von Jeffares die Abbildungen unter dem Text stehen und nicht darüber.
Friedemann wäre, als das Bild entstand, erst 20 Jahre alt gewesen. Das Bild darunter stellt ihn dar. Auch hier ist die Zuschreibung nach Meinung des Autors zweifelhaft. Im übrigen gäbe es keine Ähnlichkeiten mit den zwei (?) bekannten Portraits von Friedemann (Das allgegenwärtige mit dem Schlapphut scheint sowieso falsch zu sein).
Was bei der Zuschreibung an Johann Sebastian „doubtful“ ist, wäre noch herauszufinden, interessiert mich aber nicht wirklich (…).
***
Ich gebe zu, es war voreilig von mir, an die Unfehlbarkeit dieser verdammten Liste von Pastellbildern zu glauben. Und obendrein noch selbst die beschreibenden Texte den falschen Bildern zuzuordnen!
Ich hätte wenigstens ahnen können, dass es längst eine regelrechte Forschungsrichtung zur Authentifizierung überlieferter Bach-Portraits gibt. Wie glücklich bin ich nun, dass die kritische Reaktion des Freundes eine neue Suche ausgelöst hat, die zu einem durchaus hoffnungsvollen Neuanfang geführt hat. Ob „doubtful“ oder nicht, es interessiert mich nachhaltig. Denn eines Tages wird mir Bach im Traum erscheinen, und er soll bitte genau so ausschauen, wie auf dem Bild von Haussmann, mir den Kanon entgegenhalten und rufen: „Und das hab‘ zum Zeichen!“ ich werde entgegen: „Moment, darf ich einmal die Handschrift überprüfen!?“
Auch die folgende Website habe ich allerdings noch nicht gründlich geprüft, sie bietet jedoch reichen Stoff zum Weiterforschen und beruht auf einem Wissensstand, von dem ich vor 5 Tagen nur träumen konnte.
Sehen Sie also THE FACE OF BACH ………….. HIER.
Nach-Nachtrag 10.02.2016
Gewiss: Alles bewundernswert, was man da zu lesen und zu sehen bekommt. Nur der entscheidende Punkt, dass dieses Bach-Bild, das mich irritierte, vielleicht doch authentisch ist, bleibt ganz und gar unglaubwürdig. Da hilft auch keine Schädelanalyse. Inzwischen habe ich dem Mann so lange ins Antlitz geblickt, bis ich zu der Überzeugung kam: er ist ein Vorfahr von Peter Sloterdijk. Nur die Haare trägt er schöner. (Ja, wer von beiden? das lasse ich offen.) Ich habe die hundert Seiten der Bach-Kantaten-Behandlung noch nicht studiert, – ist es mehr das Werk eines akribischen Rechtsanwalts oder eines höchst systematisch engagierten Laien-Musikers? Ganz ratlos machen mich seine Tränen, etwa, wenn der Autor über Bachs Bildnis (natürlich doch das eine von Haussmann) gesprochen hat, seine mutmaßlich lebensfrohen Aktivitäten (Rauchen, Trinken, Bett) und schließlich auf die eigene größmögliche Nähe zum Komponisten kommt: er nimmt die Handschrift der Kantate BWV 7, blättert mit ungeschützten Fingern darin herum und ist zutiefst gerührt. (Ähnlich erschüttert sagt er seiner Meisterin Rosalyn Tureck am Ende eines anderen Filmes – https://www.youtube.com/watch?v=mAFPfflNex0 – zu ihrem 100. Geburtstag und 10. Todestag ein schlichtes „Danke, danke“.)
Heute habe ich nochmal in einen schönen Bildband geschaut, der zum Bach-Jahr 1985 herausgekommen ist, – wer weiß, ob ich damals die Seite 142 überhaupt beachtet habe (indiskutabel); bestimmt habe ich nur gedacht: das Bild auf Seite 143 muss doch von Adolph Menzel sein!? (Ist es natürlich nicht!)
Max Weber
Wie der Zufall gerne spielt: während ich am vorigen Beitrag arbeitete, kommt die Post und bringt die Pflichtbestellung 2015, die ich der Wissenschaftlich Buchgesellschaft eilig nachgereicht hatte, um nicht drei „fremdbestimmte“ Werke zu bekommen, die ich nicht unbedingt brauche. Und dieses Buch passt genau zu dem (Eigen-)Zitat, das ich vorhin wiederlas, womit – wie schon des öfteren – eine Gedankenkette ausgelöst wurde, die am Ende zu dem Vorsatz führt, einmal wieder Max Weber (und John Blacking) zu studieren.
Da spielt natürlich auch Peter Schleuning hinein, den ich im Programmheft „West-Östliche Violine“ 1989 (wo ist das eigentlich? s.u.!) ausführlich zitiert habe. Und zu John Blacking gesellte sich inzwischen Bruno Nettl. Aber im Hintergrund immer ER:
Und daraufhin liegt hier nun auch wieder ein guter, bei Weber ansetzender Kulturenvergleich auf dem Tisch, oder besser gesagt: ein „Verstehensversuch Indien/Europa“ will rekapituliert werden. Ich habe den Entstehungsprozess damals fast aus der Nähe miterlebt.
Immer wenn ich ins Autobiographische abdrifte, treffe ich auf den universalistischen Drang, den man auch der Hybris verdächtigen kann. Dazu gehört, dass zu Beginn meiner „bildungsfähigen“ Zeit bei Rowohlt die ersten Taschenbücher einer „Enzyklopädie“ auftauchten, die ich mir im Laufe der Zeit vollständig einzuverleiben trachtete. So kann man nur scheitern! War es ein Wunder, dass ich am Ende auch die Geige, wenn ich schon kein Virtuose geworden bin, in den Mittelpunkt der Welt zu stellen geneigt war? Das wäre ein Extra-Kapitel in Fortsetzungen wert.
Die Grafik (oben) stammt von Heinz Edelmann: zweifellos hat er den Geiger als – Migranten gesehen. Und die Kritik in der Kölner Rundschau war dergestalt, dass ich sie verwahrt habe…
Natürlich sollte es weitergehen:
 Mikro-Probe (mit Tonmeister Frobeen)
Mikro-Probe (mit Tonmeister Frobeen)
Zurück zu dem Buch „Indien und Europa“. Ich kann nicht darin blättern, ohne dass mich ein zweifelndes Gefühl beschleicht. Woran liegt es? „Ein Verstehensversuch“. So viel Richtiges, aber das Entscheidende fehlt (schon im Ansatz). Zunächst wäre die Ungleichzeitig des Gleichzeitigen zu bedenken (ohne die westliche „zeitgenössische“ Welt als Trumpf auszuspielen, – es könnte der absurde Weg sein). Das traditionelle (!) indische Denken wäre mit einer „abgerundeten“ abendländischen Weltanschauung wie der des Barock zu vergleichen, nicht mit der Moderne. (Affektenlehre, Prinzip der Bewegung, Basso continuo = Tabla). Die Moderne betrifft Indien – die indische Musik – auf ähnliche Weise wie uns, – aber auch ganz anders. (Bleibt der Grundton?).
als das Wünschen noch nicht nötig war und die Schatzkammern öffentlich…
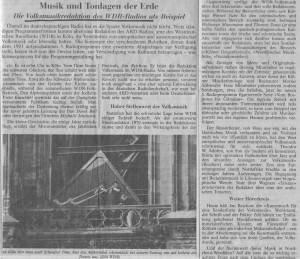 Neue Zürcher Zeitung 14.05.1992
Neue Zürcher Zeitung 14.05.1992
 Ein Festival der Völker seit 1976
Ein Festival der Völker seit 1976
Aus dem Folkfestival wurde das Weltmusikfestival, und es lebte noch 10 Jahre weiter, und wenn es nicht gestorben worden wäre, lebte es vielleicht noch heute.
Dies zur Erinnerung.
Wer wissen will, wie in etwa (oder auch im Detail) das Musikgeschäft läuft, besitzt längst sein aufschlussreiches Buch über „Das Geschäft mit der Musik. Ein Insiderbericht“ (Berlin 2013 Edition Tiamat). Und wer darüberhinaus auf dem laufenden bleiben will, der liest regelmäßig seinen Presserundbrief, dessen Version 1/16 soeben eintraf, – Berthold Seliger.
Ich zitiere Auszüge und empfehle eiligen Lesern (gibt es die hier?) das Video zum Echo 2015 (am Ende dieses Beitrags).
Auf der Womex in Budapest gab es eine Session mit dem schönen Titel „Why Curation Will Save the Music Industry – The Power of Guidance in the Era of Algorithms“.
Und wer waren die Referenten? WDR-Funkhaus Europa-Chef Francis Gay und die Chefin des Lollapalooza-Festivals Berlin. Also ausgerechnet jenes Festivals, das so ziemlich das mainstreamigste und langweilste Konzertprogramm aller deutschen Festivals im abgelaufenen Jahr aufzuweisen hatte. Ganz so, wie man sich ein zum weltgrößten Konzert-Konzern Live Nation gehörendes Festival eben vorstellt, in dem die großen Namen zusammengebucht (oh, Verzeihung: zusammenkuratiert) werden, von denen man sich die größtmöglichen Profite verspricht, zu dessen Programm aber garantiert keine unbekannten Weltmusik-Acts gehören.
Wie man es schafft, ausgerechnet auf so ein Podium ausgerechnet bei der Womex ausgerechnet eine Vertreterin des weltgrößten Livemusik-Konzerns, der allüberall die kulturelle Vielfalt erschwert, Werbung für ihr Festival machen zu lassen, während unter den akkreditierten Womex-Teilnehmer*innen doch nun wahrlich genug Vertreter*innen unabhängiger Festivals aus ganz Europa zu finden gewesen wären, bleibt ein Rätsel. Und ein beträchtliches Ärgernis.
* * *
Lollapalooza Berlin 2016 hat zwar noch keinen Spielort, aber kommerziell ist bereits alles am Start: „Kommen Sie mit. Zum Melt!, zum splash!, zum Lollapalooza oder dem ‚Pure&Crafted’. Wir bieten umfassende Sponsoringberatung ‚aus einer Hand’ – und haben eine passende Medialisierung sowie Streaming-Pakete ebenfalls im Angebot“, flötet die „Festivalvermarktungsabteilung“ des HUG-Konzerns in einer Mail Ende November 2015, „Copyright © 2015 Intro GmbH&Co.KG“.
In dieser Mail steht in bemerkenswerter Offenheit, warum man Festivals wie Melt oder Lollapalooza (mit-)veranstaltet:
„Die zunehmende Fragmentierung jugendlicher Zielgruppen macht ein Engagement in jungen Umfelder immer schwieriger. Im Vergleich dazu wächst der Festivalmarkt seit Jahren und gehört zu den attraktivsten Möglichkeiten, eine Marke in jugendlichen Umfeldern zu platzieren. Musik bedeutet Emotion und Leidenschaft: Unternehmen, die sich in diesem Umfeld engagieren, werden in Umfragen überwiegend als positiv bewertet – wenn das Engagement glaubwürdig und authentisch ist. Wir bieten in unserem Netzwerk dazu optimale Marketing-Plattform quer durch alle musikalische Genres, „Millenials“ ohne Streuverluste direkt und nachhaltig anzusprechen und Markenbotschaften zu platzieren.“
Die einen kuratieren also das Ding, in dem die anderen ihre Markenbotschaften platzieren. Eine Marketing-Plattform ohne Streuverluste.
Wenn Sie dachten, da gehe es um Musik – awcmon, das haben Sie nicht wirklich gedacht, oder? So naiv sind Sie schließlich nicht? Wollen Sie M.U.S.I.K. erleben? Dann fahren Sie besser zum Fusion, nach Haldern, Roskilde, Rudolstadt oder zum Beispiel nach Barcelona zum Primavera Festival. Oder besuchen Sie den Musikclub Ihres Vertrauens.
* * *
Doch nicht nur die HUG-Unternehmensgruppe weiß, worum es wirklich geht (nämlich nicht um Kultur, sondern zuvörderst um Sponsoring und Profite). In Münster hat sich Anfang 2015 eine „Translate Entertainment GmbH“ gegründet, die „Programmplanung, Beratung, Künstlerbuchung und Organisation zum Beispiel für Corporate Events, Incentives, Galas und Stadtfeste“ sowie „inhaltliche und unternehmerische Konzeptionen für Veranstaltungen abseits vom traditionellen Konzertgeschäft“ anbietet.
Leute, die solche Firmen gründen, sprechen amtliches Musikindustriesprech, und das hört sich dann so an: „Vor Kurzem realisierte Translate für den Klambt Verlag einen Incentive‐Event mit Nena, konzipierte für einen Kunden aus dem TV ein Live‐Produkt im Kids Entertainment und buchte bereits große Acts auf Veranstaltungen von Mercedes Benz, Telekom, Hapag‐Lloyd sowie weiteren Unternehmen.“ (laut „Musikmarkt“)
Gesellschafter der Firma sind Till Schoneberg mit seinem Konzertbüro Schoneberg und Florian Brauch und Florian Böhlendorf von Sparta Booking sowie Markus Hartmann von Green Entertainment. Worum es geht, fasst Translate Entertainment-Geschäftsführer Kevin Bergmeier im „Musikmarkt“ so zusammen: „…auf individuelle Anforderungen wie beispielsweise die musikaffine Inszenierung einer Marke, Entwicklung von Event‐Konzepten und den Einsatz eines VIP, eines Künstlers, dessen Musik oder Stimme in einer Werbekampagne können wir zielgerichtet eingehen.“
* * *
Echo? Das ist diese von der Lobbyorganisation der deutschen Musikindustrie veranstaltete Dauerwerbesendung, die das Staatsfernsehen stundenlang im Abendprogramm auszustrahlen pflegt. Alles, was Sie über den Echo @ ARD wissen müssen, habe ich anhand des Echos 2015 in weniger als zwei Minuten auf einem YouTube-Video zusammengefasst:
Autor des oben zitierten Textes und des Videos: Berthold Seliger / siehe auch hier.
mit ein paar Worten mein Üben inspiriert hat.
Im bloßen Wortlaut kann es nicht liegen, jeder, auch ich selbst hätte mir sagen können: Du musst einfach immer wieder ganz langsam üben, und nicht verzagt beobachten, wie und wo du Probleme hast. Es ist seine einfache, ehrliche Art zu sprechen und im Kontrast dazu sein gewaltig zupackendes und sensibles Geigenspiel, – als sei es nicht derselbe Mensch, der dann sagt, er habe um dieses Werk (das 2. Violinkonzert von Béla Bartók) immer einen Riesenbogen gemacht… – bis er es dann ganz, ganz langsam geübt hat, wie in Zeitlupe, es musste ja einfach nur funktionieren. Das Wort Matrix und die Anspielung auf den Film tat ein übriges (zugegeben: ich habe den Film nie gesehen und mich erst jetzt bei Wikipedia schlau gemacht). Also – ich hab’s alles abgeschrieben, es soll auch auf andere Menschen wirken:
Frank Peter Zimmermann O-Ton:
Also erstmal war das natürlich eine Riesenfreude, als die Offerte kam, die Anfrage, eine große Ehre und [weil] das Orchester eins von meinen Lieblingsorchestern ist auf der Welt, und da hab ich mir gedacht, wenn ich schon die Chance hab mit diesem wunderbaren Orchester, dann muss ich doch meine Residence mit diesem Stück hier beginnen. 0:52
Also der Bartók gilt ja wohl weltweit bei allen Orchestern und bei allen Violinsolisten als mit das komplexeste Violinkonzert wohl überhaupt. Und wenn man dann abends aufs Podium geht und … dieser Riesenberg … oh Gott, jetzt habe ich dieses ganze Stück vor mir, und jetzt beginnt alles wieder von vorne. Auf der andern Seite, es ist so unglaublich beglückend, wenn man’s dann geschafft hat. 1:33
Ich hab’s erst mit 37 gelernt, auch weil ich da immer ’n Riesenbogen drum gemacht hab, weil es eben so komplex und schwer ist, der Violinpart, und dieses Jahr hatte ich also eine große Serie mit dem Stück. Es hat sich nicht so viel verändert in der Interpretation, das Bartók-Konzert ist, eigentlich ähnlich wie das Berg-Konzert oder wie überhaupt alle großen Violinkonzerte des 20. Jahrhunderts, so, dass es eigentlich funktionieren muss erstmal, [eher] als dass man sich so wie bei Mozart oder Bach ein ganzes Leben lang … damit… ja, immer wieder musikalisch verändert. 2:33
Ich übe eigentlich dieses Werk extrem langsam. Ich sage immer, dass ich es eigentlich nur so lernen kann … indem ich es in Matrix-Art, also auf Matrix … also wenn man damals an diesen berühmten Film denkt, wie diese Kugel da auf den kleinen Keanu Reeves zukam und alles für ihn eigentlich in Zeitlupe war, so ist das, und soweit muss dann auch später so sein, wenn man es im schnellen Tempo spielt, dass es einem fast vorkommt, als ob man es [gerade] langsam übt. 3:22
Es ist für mich immer eine Zeit, wenn ich das Stück spiele, dass ich in Hochdruck lebe, eigentlich die ganzen Tage und Wochen auf der Überholspur, möchte ich mal sagen, auch innerlich. Man hat eine gewisse Unruhe, und ich glaube, man muss sich auch in diese Art von Stimmung bringen, ja quasi mit einem Killerinstinkt, dieses Stück zu spielen,- das Orchester auch während der Aufführung reizen, dass es an die Grenze geht. In der Lautstärke oder grade auch in den zarten Momenten ist es ja manchmal auch so unglaublich still und fein und einzigartig… 4:21
Ich glaube, man hat so wahnsinnig viel Möglichkeiten für den Ausdruck, die Geige kann sein wie Elektra auf der einen Seite, auf der anderen kann sie so unglaublich zart … singen, und der Bartók hat das alles in dieses unglaubliche Werk hineingepackt… Die Geige ist 1711 gebaut worden von Antonius Stradivari. Die Geige ist wirklich ein Teil meines Körpers, ich spiele auf dieser Geige seit 9 Jahren, die Geige hat Fritz Kreisler gehört, eine Zeit lang, er hat da wahrscheinlich nie einen Ton Bartók drauf gespielt, er hat ja wenig zeitgenössische Musik gespielt, aber, nein, in Kombination mit einer phantastischen Geige gehört auch ein ganz toller Bogen, dieser Bogen ist eine Kopie von meinem [Dominique] Peccate, eine Kopie, die Herr Lucke gemacht hat, in Berlin, phantastischer Bogen, wo ich also wirklich bei Bartók das Gefühl hab, ich bekomme diesen richtigen Kern, also, mein Klang hat … ja, diesen Puszta-Klang irgendwie. 5:33
Das Interview stammt noch aus der Zeit 2010/2011, inzwischen musste FPZ die Kreisler-Stradivari dem Verleiher zurückgeben. Die Geschichte von der anderen Stradivari, die er seit kurzem zur Verfügung hat, kann man hier nachlesen.
An dieser Stelle geht es mir nur um die Methode des Übens. Im Original mit eingestreuten Beispielen aus der Bartók-Orchesterprobe mit FPZ nachzuhören in der youtube-Quelle.
Natürlich liegt es auf der Hand, mir vorzuhalten, dass meine kleine tägliche Übetätigkeit am Klavier oder mit der Geige nicht im geringsten an der Arbeit eines solchen Virtuosen Maß nehmen kann. Im Gegenteil! Es wäre nur dumm, das nicht zu tun: um wieviel mehr als er habe ich (haben SIE) es nötig, mindestens die gleiche Sorgfalt aufzuwenden und sich nicht täuschen zu lassen vom Erscheinungsbild: die Leute glauben ja immer, die besondere Leistung fiele den Meistermusikern in den Schoß, weil es bei ihnen so leicht und organisch aussieht. Es gibt genug Gründe, mich (oder Sie) zu entmutigen, aber keinen einzigen, uns am richtigen Üben zu hindern. Jede positive Erfahrung, die dabei herauskommt, ist mehr Geld wert, als eine langwierige Therapie beim Psychotherapeuten…
Meine aktuellen Probleme sind leicht benannt (man muss sie eingrenzen!):
Es ist übrigens sehr einfach zu üben, aber man braucht Geduld. Ich muss mir physisch die Chance geben, es zu verinnerlichen. Zeitlupe, – bis es mir auch im schnellen Tempo wie in Zeitlupe erscheint. Ich mache mir einen Plan, ich muss das Problem sonnenklar vor mir liegen haben:
***
1 als Zeitlupe-Übung
2 als Klavierfassung
3 als Klavierfassung (cum grano salis)
Zugegeben: so kann man’s nicht spielen, weder auf dem Klavier noch auf der Geige. Ich lasse es trotzdem erstmal stehen.
Die Vorübung für das schnelle Nachschlagen ist sehr einfach, wird erst bei äußerster Präzision und längerer Dauer problematisch. man kann leicht Varianten erfinden. Mit dem Fuß als Taktschläger, aber auch ohne; ohne Metronom, aber auch mit Metronom, Viertel = 120. Falls das Schwierigkeiten macht, bei 60 beginnen und allmählich aufwärts. Nicht Fuß und Metronom gleichzeitig. Denn vor allem gilt: absolut mühelos. Wie im Schlaf. Rumänische Tanzgeiger können es stundenlang. (Sie spielen beim Nachschlagen auch Abstrich/Aufstrich, mit Bogen an der Saite!)
Und jetzt folgt die Schumann-Stelle, sträflich vereinfacht, auch transponiert, man sollte die Melodie singen oder pfeifen und dabei lässig die nachschlagenden Quinten ausführen. Es muss in Fleisch und Blut übergehen, – die zwei hier tätigen Geister sollen halt (wie soll ich sagen?) ein Fleisch werden.
Vorläufiges Ende der Übung auf dem Papier. Es ist ein Übung der Gleichmäßigkeit. Ein Lob dem Metronom! Under Psychologie: es ist ein Unterschied, ob ich „nachschlagend“ denke oder „auftaktig“ (offbeat). Synkopen (in Vierteln) sind ja ohnehin kein Problem. Ich habe das Problem gewissermaßen geschaffen, um es auf anderem Niveau zu lösen. Bewusstsein einschalten, um es nacher leichter ausschalten zu können. Oder „zu schalten und zu walten“.
Weiter! (7.2.16) Viertel (nur) 120