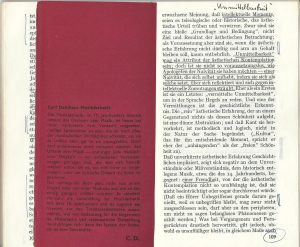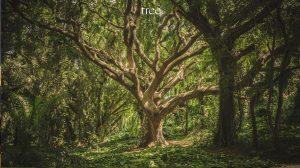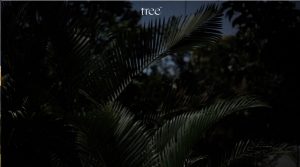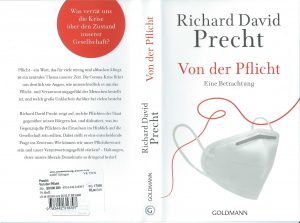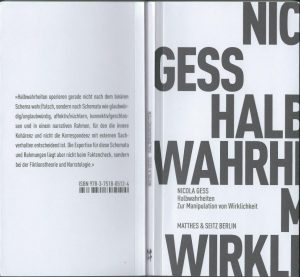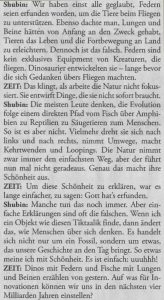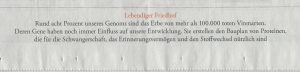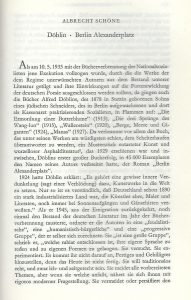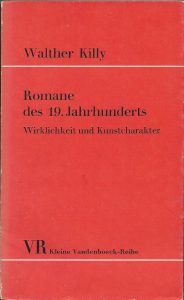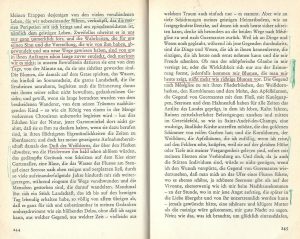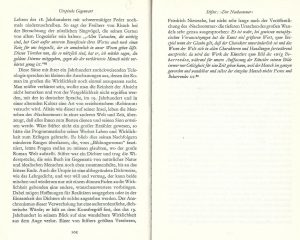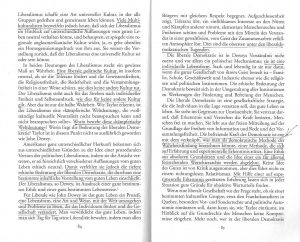A propos Karl Lauterbach (ohne Mundartfärbung)
Die Wissenschaft, in der ich tätig bin, also die klinische Epidemiologie, unterscheidet sich insofern von der philosophischen Wissenschaft, als [dass] die Bandbreite dessen, was als wissenschaftlich gesichert gilt, doch viel klarer umrissen ist. Während man in der Philosophie nie zu einem vollständigen Konsens darüber kommen wird, ob eine materialistische oder idealistische Sicht auf die Welt richtig ist, liegt das Spektrum in der Epidemiologie viel näher beieinander. Natürlich sind auch die medizinischen Disziplinen diskursiv, aber hier wird doch meist eher über bestimmte Schattierungen gestritten. Ein Beispiel: Wissenschaftlich ist mittlerweile relativ klar, dass der AstraZeneca-Impfstoff gut wirkt. In Details gibt es zwar noch Diskussionen, aber dabei geht es eher darum, noch das Haar in der Suppe zu finden, wie Christian Drosten es zutreffend genannt hat. In der Öffentlichkeit entsteht unterdessen oft der Eindruck, die Bandbreite der Meinungen in der Virologie oder Epidemiologie wäre extrem groß. Im vergangenen Sommer schien es etwa so, die Virologie streite darüber, ob wir jemals einen Impfstoff für Covid-19 bekommen werden. Dabei waren es nur wenige Leute, die daran zweifelten. Für 95 Prozent der Virologinnen und Virologen war indes klar, dass man für ein Virus, das über ein Spike-Protein in die Zelle eindringt, ein Vakzin wird entwickeln können.
Quelle hier (bitte erst später öffnen und nachlesen)
Ich wähle das Beispiel meiner eigenen (an mir selbst „erprobten“) Vorurteile, um nicht mit dem Finger auf (imaginäre) Lauterbach-Verächter zu zeigen. Ich beginne also mit dem Satz, den man ertragen sollte: Karl Lauterbach gehört für mich zu den maßgebenden Politikern unserer Zeit. Zunächst die Punkte seines Lebenslaufes, die Zündstoff hergeben: also aus dem Wikipedia-Artikel hier folgende Zitate:
Karl Lauterbach [- geboren in Düren -] wuchs in Oberzier in unmittelbarer Nähe der Kernforschungsanlage Jülich auf, sein Vater arbeitete in einer nahe gelegenen Molkerei. Trotz sehr guter Leistungen in der Grundschule erhielt nur eine Hauptschulempfehlung, wechselte dann aber mit Unterstützung seiner Lehrer zuerst auf die Realschule, dann aufs Gymnasium am Wirteltor, wo er sein Abitur ablegte.
Ein Markenzeichen Lauterbachs war lange Zeit die Fliege, die er des Öfteren anstelle einer Krawatte trug. Bei Talkshowauftritten im Jahr 2020 zum Corona-Virus trägt Lauterbach bewusst keine Fliege mehr, da er sich so, nach eigener Aussage, eine höhere Akzeptanz seiner Einschätzungen bei jüngeren Zuschauern verspricht.
Fehlt noch: eine Anmerkung zur allmählichen Veränderung seiner widerspenstigen Haartracht. Ist er nur etwas ungeschickt in seinen Anpassungsversuchen?
In dem oben schon zitierten Artikel werden die an Stammtischen (gesetzt, sie fänden noch statt) zutage tretenden Vorurteile nicht zum Thema, – nichts Thymotisches also – abgesehen vom „Hass“, der fast wie eine Naturkatastrophe erscheint, der man aus dem Wege gehen könnte.
ZITAT
Noch eine Frage zum Schluss: Seit Beginn der Pandemie werden Sie im Netz von Gegnern der Corona-Maßnahmen immer wieder mit Hasswellen überzogen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich das nicht weiter anzutun?
Nein, das habe ich nicht. Ich versuche einfach, so gut ich kann, also nach bestem Wissen und Gewissen, einen Beitrag zu leisten. Damit werde ich erst aufhören, wenn ich den Eindruck habe, dass ich diesen Beitrag nicht mehr leisten kann, mich aber nicht durch die Anfeindungen und Bedrohungen einschüchtern lassen.
* * *
Einige Notizen, die der Unschlüssigkeit bei der Analyse eigener Vorurteile entsprechen:
Zur Erforschung der Sprechmelodien in den Dialekten hier oder auch hier
Speziell zu Lauterbachs Tonfall: Vorurteil Kölsch? hier
Das Thema ist anregend genug, aber dann sollte auch irgendwann Schluss sein mit vordergründigen Abschweifungen à la Krawatte, Frisur oder Slang. Wer nicht aus dem Rheinland stammt oder hier lebt, braucht vielleicht etwas länger, um zu abstrahieren.
Sehr gut über Rawls hier / des weiteren hier (Wiki)
* * *
Schon bevor die neue ZEIT eintraf, kam ich auf die Idee, mich – statt mit Lauterbach „persönlich“ – mit den maßgebenden Impulsen seines Lebens zu beschäftigen, dem philosophischen Ansatz und den naturwissenschaftlichen Prinzipien. Eher sollte es nicht weitergehen: Eine plausible Verbindung des Lebens „da draußen“ mit den notwendigen geistigen Bewegungen. Idealer Ansatzpunkt: das Gespräch mit einem Paläontologen, der zu meiner Überraschung weniger über seine fossilen Fundstücke spricht als über das Genom und die „Schnittstelle zwischen Mama und Kind“. Und damit verabschiede ich mich fürs erste und (Vorurteil!) suche ein paar Bücher heraus (unten im Überaum, im Regal gleich neben Adolf Portmann, wo auch Dawkins steht, nein eher irgendwas zur anthroposophischen Vorurteilsgenerierung). Vorweg das ZEIT-Zitat, die Frage, von der aus das Gespräch mit Shubin an Fahrt gewinnt:
ZEIT: Als Paläontologe kraxeln Sie durch die Arktis und hauen jahrmillionenalte Fossilien aus dem Fels. Im Labor untersuchen Sie unsichtbare zeitgenössische Genome. Ist diese Kombination der Schlüssel, um das Ganze zu verstehen?
SHUBIN: Evolution ist eine komplizierte Angelegenheit. Da brauchen Sie jedes Werkzeug, das Sie kriegen können. Die Fossilien zeigen mir, wie das alte Leben aussah. Auf der anderen Seite müssen wir die Gene verstehen, um das Geschehen in unseren Zellen zu verstehen.
ZEIT: Wie muss ich mir das vorstellen?
SHUBIN:Als eine Art Krieg. Unser Genom wird, während es Generation für Generation seine Arbeit tut, ständig von Viren infiziert. In jeder Zelle herrscht Aufruhr. Soll man den neuen Mikroorganismus bekämpfen oder sich mit ihm arrangieren? Ein Beispiel: in der Plazenta erfüllt ein Protein eine besondere Aufgabe. Es heißt Syncytin und dient als molekularer Verkehrspolizist für den Austausch von Nährstoffen und Abfallprodukten zwischen Mutter und Fötus – wichtig für die Gesundheit des Embryos. Wissenschaftler entdeckten, dass es sich dabei um ein Virusprotein handelt. Irgendwann muss also ein Virus in uns eingedrungen sein. Es hackte sich in unser Genom, brachte dort das Programm für sein Protein unter – und wurde seinerseits gehackt. In der Folge verlor es seine Infektionsfähigkeit, wurde von seinem neuen Herrn zur Arbeit herangezogen – und arbeitet nun für uns an der Schnittstelle von Mama und Kind.
ZEIT: Ein typisches Drehbuch für biologische Innovationen? [Durchaus]
Etwas später:
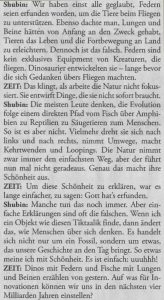
Quelle DIE ZEIT 4. März 2021 Seite 33 »Die Natur ist ein fauler Fälscher« Wenn neues Leben entsteht, wird unentwegt geklaut und kopiert. Warum ist das so? Ein Gespräch mit dem Paläontologen Neil Shubin (Mit Urs Willmann)
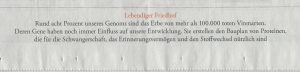
Vorschlag: Jetzt zurück zum Philosophie-Magazin hier
* * *
Keine Ausflüchte (ein Nachwort zum wirklich Wütendwerden)
Immerhin gab es gestern ein Statement der Bundeskanzlerin. Und die von ihr erzeugte Ratlosigkeit kann nicht mit einem Lob der Wissenschaft weggewischt werden. Eine weitere Leseempfehlung, denn:
Was die Kanzlerin und ihr Kanzleramtsminister zuletzt über Corona-Tests und die Corona-Warn-App gesagt haben, ist geradezu unverschämt. Es lässt uns vielleicht nicht zu Wutbürgern werden, aber zu Grollbürgern.
Sascha Lobo über Staatsversagen in der Pandemie – HIER. (Spiegel Netzwelt)
ZITAT
Noch im März könnte Amerika so viele Menschen geimpft haben, wie in Deutschland leben.
Im direkten Kontrast schmeckt Merkels »Teststrategie sicherlich im März« noch einmal erbärmlicher nach Dysfunktionalität, Widerwillen, Versagen in der Breite und der Tiefe. Wenn Deutschland wie bisher weiter mit unter 200.000 Impfungen am Tag vor sich hin dümpelt, dann stehen nicht nur zu Ostern über sechs Millionen Dosen unverimpft in der Gegend rum.
P.S. Ich zum Beispiel habe den lang ersehnten und begehrten Impftermin Mitte April…
 Autor: Heinz von Loesch
Autor: Heinz von Loesch