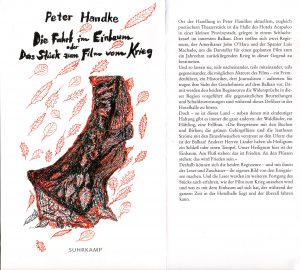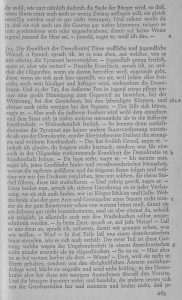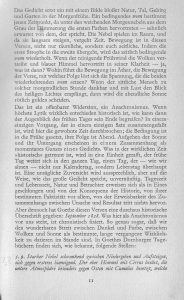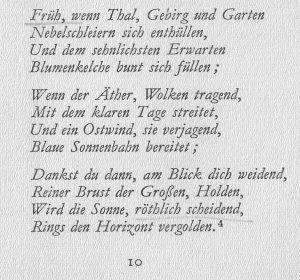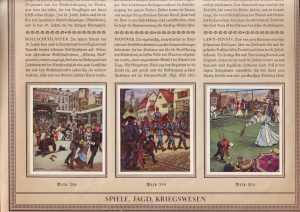Nachrichten aus Platos „Staat“
Nie und nimmer hätte ich gedacht, dass mich ein Zeitungsbericht über die Wirkung des Internets einmal dazu bringen würde, Platons „Staat“ hervorzuholen, in dem ich Ende der 50er Jahre gestrandet bin. Es war mit schlicht zu langweilig. Dabei trägt der vorangehende Dialog „Phaidon“ allerhand Gebrauchsspuren. Ich kannte ihn, wie andere Dialoge, auch aus anderen Ausgaben seit Dezember 1955. (Ich bitte um Nachsicht: mir liegen diese autobiographischen Abrundungen am Herzen.)
Dies war der aktuelle Auslöser – Justus Bender in FAZ online (5.10.2019) -, ich zitiere mitten aus dem Text:
Das Internet birgt eine besondere Ironie. Es ist die größte informationstechnische Revolution in der Geschichte der Menschheit. Ausgerechnet auf Demokratien hat es aber einen rückschrittlichen Einfluss, mit dem Mob, der destruktiven Debatte und dem Trommelfeuer von Falschnachrichten. Es hat die mäßigend wirkende Parteiendemokratie, den Pluralismus und die auf Versachlichung angelegten Parlamente geschwächt.
Das Ende der Vormundschaft
In der Antike galt der Mob als unlösbares Grundproblem der Demokratie. Platon lehnte die Demokratie ab, weil er sie für den sicheren Weg in die Tyrannei hielt. Grob folgt er in „Der Staat“ der These, dass Menschen in Demokratien eine Sucht nach Freiheiten entwickeln, die ihnen auch gewährt werden. Sie beginnen, ihren Selbstwert zu empfinden und Autoritäten zu hinterfragen, die Eltern, die Lehrer, die Regierung. Alle Bürger werden mit der Zeit gleich, der Sklave wie der Großgrundbesitzer, die Frau wie der Mann, ganz so, wie es in einer Demokratie sein soll.
Doch diese Haltung steigert sich immer mehr. Platon beschreibt antike Shitstorms, „gegenseitige Anklagen“ und „Kämpfe“. Er beschreibt Bürger, deren Seelen im Freiheitsrausch so „zart“ werden, dass sie keine Autoritäten mehr ertragen. So entstehen Vorwürfe gegen alle Bessergestellten, Teil eines Establishments zu sein. Die Bessergestellten wehren sich und machen so den Vorwurf wahr: Sie treten als ein Block auf. Schnell kommt ein Politiker empor, der den Menschen verspricht, sie von dieser Herrschaft der „Volksfeinde“ zu befreien.
Es ist der spätere Tyrann, der zu dieser Zeit noch von Freiheit redet. Die antiken Facebook-Menschen wählen ihn. Ist er aber erst einmal an der Macht, wird er seinen Kampf gegen die „Volksfeinde“ fortsetzen. Er wird die Opposition unterdrücken, weil sie dem wahren Volkswillen entgegensteht, den er verkörpert. Und dann werde „das Volk, beim Zeus, wohl sehen, was für ein Früchtchen es sich erst erzeugt und dann gehegt und gepflegt hat“, schreibt Platon.
Quelle Frankfurter Allgemeine online (aktualisiert 5. Oktober 2019, abgerufen hier) Die Wiederkehr des Populismus : Im Namen des Volkes / Von Justus Bender
Diese Lesart war mir neu, der Sache musste ich nachgehen. Zunächst bot sich Wikipedia an – natürlich trotz des großen Negativartikels über das bewährte Online-Lexikon, letztens in der Süddeutschen (hier) -, die virulente Skepsis genügt:
Das Hauptmerkmal der demokratischen Gesinnung, der unbeschränkte Freiheitswille, wird den Demokraten letztlich zum Verhängnis, da sich die Freiheit zur Anarchie steigert. Der demokratische Bürger ist nicht gewillt, eine Autorität über sich anzuerkennen. Die Regierenden schmeicheln dem Volk. Niemand ist bereit sich unterzuordnen. Ausländer sind den Stadtbürgern gleichberechtigt, Kinder gehorchen nicht, sie respektieren weder Eltern noch Lehrer, und sogar Pferde und Esel schreiten frei und stolz einher und erwarten, dass man ihnen aus dem Weg geht.
Dieser Zustand der höchsten Freiheit schlägt schließlich in die härteste Knechtschaft um. Den Ausgangspunkt der Wende bildet der Gegensatz zwischen Armen und Reichen, der weiterhin besteht, aber nun nicht mehr wie in der Oligarchie von der herrschenden Doktrin legitimiert wird. Die Vermögensunterschiede stehen im Gegensatz zum demokratischen Gleichheitsdenken. Die Masse der relativ Armen ist sich ihrer Macht im demokratischen Staat bewusst. Gern folgt sie einem Agitator, der eine Umverteilung des Reichtums fordert, die Reichen einer oligarchischen Gesinnung beschuldigt und entschlossene Anhänger um sich schart. Dadurch sehen sich die Besitzenden bedroht, sie beginnen tatsächlich oligarchische Neigungen zu entwickeln und trachten dem Agitator nach dem Leben. Dieser lässt sich nun zu seinem Schutz vom Volk eine Leibwache bewilligen, womit er sich eine Machtbasis verschafft. Die Reichen fliehen oder werden umgebracht. Der Weg zur Alleinherrschaft des Agitators, der nun zum Tyrannen wird, ist frei.
In der Anfangsphase seiner Herrschaft tritt der neue Tyrann volksfreundlich auf. Er verhält sich milde, erlässt Schulden, verteilt konfisziertes Land und belohnt seine Anhänger. Nachdem er seine Herrschaft stabilisiert und einige Gegner beseitigt hat, ist sein nächster Schritt, einen Krieg zu beginnen. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit auf einen äußeren Feind, demonstriert seine Unentbehrlichkeit als Befehlshaber und verhindert, dass sich eine Opposition gegen ihn formiert. Mögliche Gegner räumt er aus dem Weg, indem er sie an die Front schickt. Jeder Tüchtige, ob Freund oder Feind, erscheint ihm als Gefahr, die beseitigt werden muss. Da sich in der Bürgerschaft zunehmend Hass auf den Tyrannen ansammelt, verstärkt er seine Leibgarde mit Söldnern und ehemaligen Sklaven, die ihm persönlich ergeben sind. Der Unterhalt dieser Truppe verursacht hohe Kosten. Zu deren Deckung werden zunächst die Tempel geplündert, dann Steuern erhoben. Das Volk ist aus der maßlosen Freiheit in die übelste und bitterste Sklaverei geraten.
Quelle (wie immer habe ich Anmerkungszahlen, Klickmarkierungen und eine Zwischenüberschrift eliminiert) Artikel „Politeia“ HIER
Danach hatte ich Lust, den Bücherschrank hinter mir zu konsultieren, die Anmerkungen verwiesen mich auf die Kennziffer 565 ff in der Ausgabe „Rowohlts Klassiker“ (Schleiermacher-Übersetzung), hier das Ergebnis. Mithilfe der Maustaste lässt sich das schwer leserliche Textformat in einen angenehmen Bereich transportieren, so, als seien meine Augen, die doch so vieles gesehen, noch jung wie ohne Brille vor 60 Jahren.

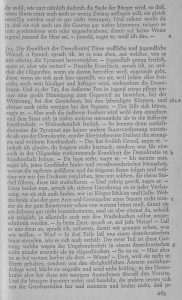
Wie schön! Wie gemächlich der Gedankengang dahinschreitet, angesichts der laufenden Bestätigungen durch den Gesprächspartner. Eine andere Übersetzung findet man übrigens online hier , ebenfalls unter der blauen Kennziffer 565, die dann auch zum griechischen (und lateinischen) Originaltext durchzuklicken erlaubt.
Oder versuchen Sie doch einfach, den journalistischen Text mit Platos sinnlichem Verstand zu ergreifen:
Soziale Netzwerke werden ihr Angebot so gestalten, dass weder der Algorithmus noch die anderen Nutzer Trolle belohnen. Mit Nacktfotos funktioniert das schon, sie werden auf Facebook mit großem Aufwand blockiert. Die Trolle [über den Troll in der Netzkultur siehe hier] wiederum, die Provokateure des Internets, werden ihre Wirkung verlieren. Man wird sich an sie gewöhnen, wie an den Verrückten in der Fußgängerzone, der ein Schild mit der Ankündigung des Weltuntergangs hochhält.
Auf der Straße beachtet ihn niemand. Im Internet hingegen bilden sich Trauben um solche Leute: Die Verrückten sind dort die Debattenführer, weil ihre Inhalte spektakulär sind. So wie der Irre sich im Gemeindesaal blamiert, wenn er Irres von sich gibt, so wird sich in einer unbestimmbaren Zukunft auch der Troll blamiert sehen, wenn er das im Internet tut. Die Sonderstellung des Netzes wird sich nicht halten. Es wird eine Gewöhnung geben. Gefährlich sind immer nur die Umbruchzeiten wie die zehner Jahre – auch die zwanziger Jahre werden es vorerst bleiben.
Quelle siehe oben FAZ, im Anschluss an den roten Text, abzurufen also als vollständiger Text hier.
 Eine Geschichte für sich…
Eine Geschichte für sich…
Zu den Ursachen des Hasses (aus der ZDF-Sendung Markus Lanz am 8. Oktober 2019 mit u.a. Natascha Kampusch – bis November noch abrufbar – HIER):
ZITAT (Abschrift JR)
ab 11:26 (Lanz: Ist das richtig, was Frau Milborn da schildert? Also Opfer müssen sich wie Opfer benehmen, sonst gefällt uns dieses Bild nicht…)
Der Jugendpsychiater Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort antwortet: (…) Wenn solche unerhörten Grenzüberschreitungen stattfinden, so löst das immer Projektionen aus, und zwar in allen möglichen Richtungen. Das Unerhörte darf es eigentlich nicht geben, das kann es nicht geben, aber wir wissen dann am Ende doch , dass es in der Normalität verborgen ist. Die Normalität heißt: wir sind es alle selbst. Und das wollen wir nicht hören, und deswegen projizieren wir all diese ganze unangenehme Gefühle auf die Opfer, auf die Täter, das ist sehr unterschiedlich je nach Konstellation und bringen da drin unter, was wir eigentlich mit uns selber nicht verarbeiten können. Dass wir nämlich selber potentiell zu dieser Grenzüberschreitung in der Lage wären. (Und dann kommt so eine massive Ablehnung, dieser Hass, ist das für Sie plausibel?) Das ist für mich absolut plausibel (Warum?) das zeigt ja nur, dass offensichtlich bestimmte Menschen in der Gesellschaft – und das ist nicht nur eine kleine Minderheit – so ein Ventil braucht, um mit dem eigenen Druck umzugehen. Und man kann – wir nennen das einen projektiven Mechanismus, nur weil ich mir jetzt vorstelle: sie kucken mich jetzt besonders wütend an, und ich fange an, Sie zu beschimpfen, dann ist das eine Projektion. Ja, dann bringe ich in Ihnen was unter, was mit Ihnen in dem Moment gar nichts zu tun hat, ich bringe etwas unter, was eigentlich zu mir gehört. Nämlich meine eigene Aggression Ihnen gegenüber. So funktioniert so eine Mechanismus, der ist ubiquitär, das können wir alle, das machen wir auch alle in bestimmten Situationen, (das verstehe ich, aber warum mit einer jungen Frau wie ihr, mit jemand, der das durchlitten hat) Weil es eine so unerhörte Grenzüberschreitung ist, die nicht sein darf, die sich natürlich nicht gehört, die aber trotzdem stattfindet, und die Tatsache, dass sie trotzdem stattfindet, in der Normalität nicht nur der österreichischen Gesellschaft, das muss man eben dazusagen, dann darf das nicht sein. Und dann bring ich, weil ich das nicht aushalte, dass das nicht sein darf, weil das ja stattfindet, bringe ich es im Opfer unter. 13:27 (Lanz an C. Milborn: Wie haben Sie das erlebt, wann begann das, wann kippte das?)
Corinna Milborn: Ganz ganz schnell, nach einer Welle der Hilfsbereitschaft – das hat aber nur wenige Wochen gehalten, wenn nicht nur Tage, nach ein paar Wochen ist das ins Gegenteil gekippt. Und ich hab sehr viel darüber nachgedacht, was da in den Leuten ausgelöst wurde, es hat viel mit dem Internet zu tun, aber vielleicht sprechen wir ja noch drüber, weil das neue Buch ja auch davon handelt. Es hat auch damit zu tun, dass das vielleicht auch in den Menschen drinnensitzt. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, wie das vor 100 oder 150 Jahren war, dann hatten junge Frauen überhaupt keinen Platz an der Öffentlichkeit, das war nicht vorgesehen, dass sie sich hinstellen und über ihre Geschichte sprechen und zu sich selbst stehen, und schon gar nicht, wenn sie betroffen waren von sexueller Gewalt. Da gibt’s diesen Begriff, diesen hässlichen Begriff „Schändung“, wo die Schande am Opfer, nicht am Täter klebt, und wo Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt werden zu sowas wie Nutzgegenständen geworden sind im klassischen patriarchalischen Zusammenhang. Und ich glaub, dass das vielleicht noch tief sitzt. Und wenn man eine junge Frau sieht, die sich Raum nimmt, dann ist es an sich schon eine Provokation für viele, – das merkt man schon, wenn Frauen sich Raum nehmen und nicht nur dekorativ sind, sondern mehr als das, und wenns dann noch jemand ist, der sich nicht an die Opferrolle hält, dann löst das tatsächlich Aggression aus, so das Gesellschaftsgefüge, das ganz tief drinnen sitzt, ein bisschen ins Wanken bringt, und deshalb feiere ich Natascha Kampusch jeden Tag, weil sie es ins Wanken gebracht hat. 15:02
Vormerken die Bücher „Cyberneider. Diskriminierung im Internet“ (Dachbuch Verlag, Wien, 192 Seiten, 19,99 Euro) und das frühere im Brandstätter-Verlag hier.
Sehr wichtig ist auch – aus meiner Sicht – die ZDF Lanz Sendung gestern, mit den folgenden Gästen: Journalist Olaf Sundermeyer, Politiker Gerhart Baum, Autorin Deborah Feldman, Extremismus-Forscherin Julia Ebner und Schauspieler Christian Berkel, bis 9. November 2019 abrufbar HIER.