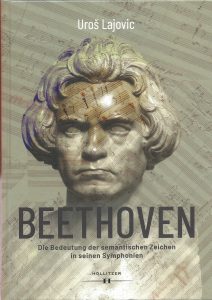Wie der Praktiker zur wissenschaftlichen Arbeit kommt
Für angehende Musiker[innen] gehört es schon früh zu den selbstverständlichen Fragen, ob die in den Noten – als Achtel, Viertel oder wie auch immer – scheinbar eindeutig dargestellten Töne kurz oder lang, markiert oder leichtfüßig wiederzugeben sind. Alles, was nicht ausdrücklich in den Noten steht – und das ist viel -, kann zu einem Problem werden. Viele Details, die den Vortrag betreffen, werden im lebendigen Unterricht vermittelt, manches, was um 1800 selbstverständlich war, gerät in einer anderen Epoche in Vergessenheit. Es muss gesagt und vorgemacht werden, es kommt nicht von selbst. Auch neue, groteske Missdeutungen werden regelrecht eingeübt. Ich nenne nur ein Beispiel: im Laufe des 19. Jahrhundert wurde es selbstverständlich, dass ein guter Musiker über den Taktstrich hinwegdenkt, dass er eine Melodielinie partout über mehrere Takte hinwegspannt. Dies nicht zu tun, war geradezu ein Zeichen für unmusikalisches Verhalten. In meiner Lernzeit (50er Jahre) gab es dementsprechend die geigerische Manie, den Schluss eines Taktes immer zu crescendieren und in die Eins des nächsten Taktes hinüberzuziehen. Ein Markenzeichen dieser nicht abbrechenden Intensität war auch das Dauervibrato, das man zur Schau trug, als dürfe es keine entspannteren Phasen geben.
Insofern musste erst wieder gelernt werden, dass vieles z.B. in der Barockmusik ganz anders zu handhaben ist; dass es einen rastlos wandernden Bass gab, dass andererseits die Tanzmusik bestimmte Betonungen – auch taktweise – vorgab und die Musik trotzdem nicht langweilig wird, sondern gerade dadurch erst ihren hinreißenden Drive bekommt.
Heute wundert sich kein musikalischer Mensch mehr, dass über solche Fragen der Artikulation, Betonung und Phrasierung endlos gestritten werden kann. Dass es – auch nach jahrzehntelanger bewährter Orchesterpraxis – niemals überflüssig wird, nachzufragen, wie genialische Menschen denn wohl selbst ihre Werke einem Publikum dargeboten oder mit Schülern ausgearbeitet haben. Und was sie dabei in die Noten eintrugen, um ja nicht missverstanden zu werden. Jeder Hinweis wäre nützlich. Ich erinnere nur an den Vortrag der Mazurken von Chopin: wie nah oder wie fern stehen sie noch der Praxis der polnischen Volksmusik? – oder dem, was der Komponist selbst als „Nationalcharakter“ empfand, aber schon als hauptstädtische Modifikation betrachtet werden könnte (siehe hier).
Ich hatte mich in den 60er Jahren relativ früh mit „Aufführungspraxis“ beschäftigt, dank meinem Lehrer Franzjosef Maier, erst recht seit er uns im Kurs für Alte Musik Köln Georg Muffats Vorrede zum „Florilegium secundum“ studieren ließ (die wohl auch für ihn neu war) und wie man mit solchem Rüstzeug nicht nur „Terpsichore“ von Praetorius adäquat erarbeiten konnte, sondern entsprechend auch die genuin französische Musik: Suiten von Lully, Rameau oder Campra. Damals eine neue Welt! (Maiers Name fehlt übrigens in den Annalen der Stadt Köln, siehe hier ab Seite 6, Dr. Alfred Krings war die treibende Kraft.)
Die praktizierenden Musiker begannen erfolgreich ins Gehege der Musikwissenschaft einzudringen und machten ungeahnte klangliche Entdeckungen. August Wenzinger, Fritz Neumeyer, Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt und viele andere. Concentus musicus Wien, Cappella Coloniensis, Collegium Aureum, La Petite Bande. Am Anfang ahnte niemand, dass eine musikalische Revolution bevorstand. Für mich war es eine Offenbarung, als ich im Musikhaus Tonger zufällig diese Abhandlung entdeckt hatte und all die Zeichen zu hinterfragen begann, die mir eigentlich aus der Violinschule von Leopold Mozart schon seit den 50er Jahren (Musikbücherei Bielefeld) vertraut sein mussten. Aber der Fall liegt so: man kennt es in der Schriftlichkeit, als archaisches Faktum, aber man realisiert es nicht, die Bedeutung erreicht uns erst auf einer ganz anderen Ebene.
Neu war in den 60er Jahren, dass die Zeichen uns auf den Leib rückten, wir schafften uns auch das Material an, die Bögen, um die gemeinten Stricharten auch „taktil“ zu erleben. Wir versuchten es zumindest. Wie geht ein Springbogen, ein Spiccato, mit solchen Bögen?
 Entwicklung des Bogens (nach David D. Boyden 1971)
Entwicklung des Bogens (nach David D. Boyden 1971)
Soviel – so knapp wie möglich – zu meiner Vorgeschichte des (Kennen-)Lernprozesses der „Aufführungspraxis“ oder der „historisch informierten Spielweise Alter Musik“ oder wie auch immer Sie es nennen wollen, wobei die Spannweite der Impulse, die von der „Alten Musik“ ausgingen, sich kontinuierlich über Klassik, Romantik in Richtung Moderne erweiterte, wo wir mit Leibowitz, Kolisch, Adorno zugleich wieder bei Beethoven gelandet sind… Man lese nur Thomas Seedorf über die Erweiterung des Repertoires hier. Ein Zwischenstopp bei Ravel, dessen Bolero hier nicht als Beitrag zur Geschichte der Aufführungspraxis gedacht ist: eine Melodie-, Harmonie-, Monotonie- und Instrumentationslehre ohnegleichen…
Ist es ein Wunder, dass auch heute noch ein Buch mit neuen Erkenntnissen zu Beethovens Aufführungspraxis uns in Aufregung versetzen kann? Nein, es ist kein Wunder, zumal es von diesem Dirigenten stammt, einem Mann der Praxis: Uroš Lajovic, aus der Schule der Praktiker Bruno Maderna und Hans Swarowsky. Und mit besonderer Sympathie habe ich unter dem beflügelnden Vorwort des Buches den Namen eines ehemaligen WDR-Kollegen gelesen, – mit dem entsprechenden berufsbezogenen Zusatz: Michael Schwalb, Cellist und Musikjournalist.
(Fortsetzung folgt)
Beethoven-Link betr. Punkt und Keil hier , siehe Schwalb Seite 10
(Fortsetzung oder Ergänzung folgt)