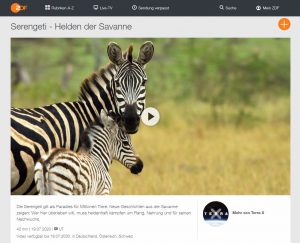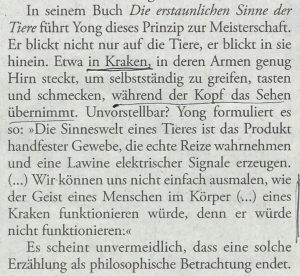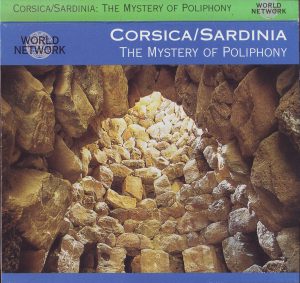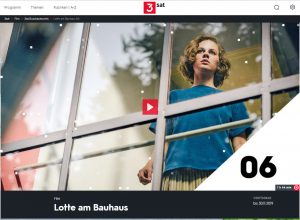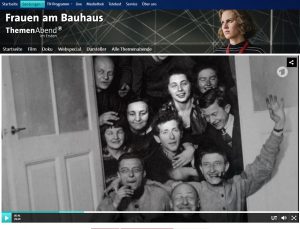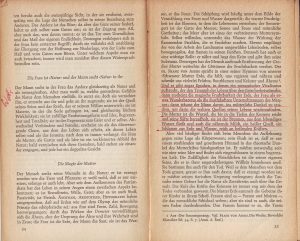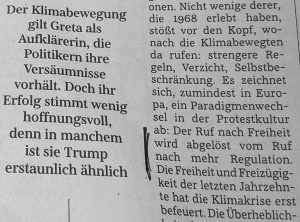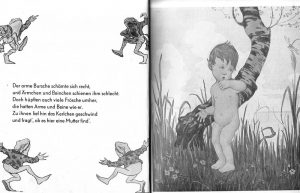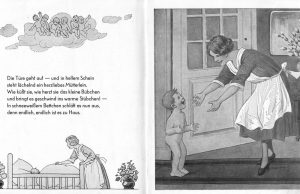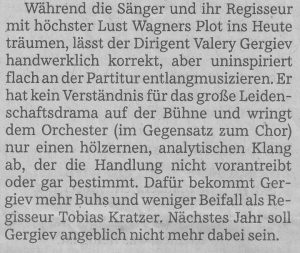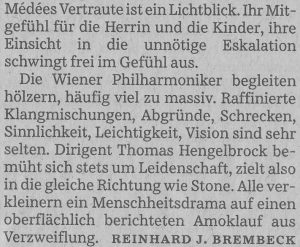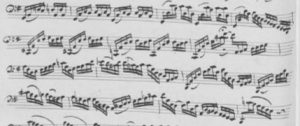Autor: Florian Henckel von Donnersmarck
Biographie bei Wikipedia Hier
Seit gestern: einer der besten (kunstbezogenen) Filme, die ich je gesehen habe. Es gibt ihn schon seit 2018. Warum grenze ich mit dem Adjektiv „kunstbezogen“ die Reichweite meiner Begeisterung ein? Genauso wie mit der Floskel „die ich je“ – weil ich kein Cineast bin, der unendlich viele Filme professionell erlebt hat und somit auf ein umfangreiches Repertoire zurückschaut, das er ständig reflektiert. Mit andern Worten: ohne jede Autorität. Aber ich denke nicht nur an Filme wie die über Vincent van Gogh (1956) oder Toulouse-Lautrec (1952), die mich früh beeindruckt haben und die ich heute als im besten Sinne dilettantisch bezeichnen würde. Sondern solche, die selber Kunst sind (sein wollen). Ich lasse mich nicht beeindrucken durch professionell destruierende Urteile, wie sie z.B. im Wikipedia-Artikel hier auftauchen, – was geht mich das an, wenn ich begeistert bin? Natürlich benutze ich dieses Wort „begeistert“ nicht als Argument, wenn jemand, mir widersprechend, als erstes an die Gaskammer erinnert, die nicht inszeniert werden dürfe. Das Entsetzen dürfe nicht instrumentalisiert werden, um den kritischen Abstand des „Konsumenten“ zu brechen. (Kurz: darüber rede ich nicht.)
Über Gerhard Richter und sein Urteil über den Film: hier. Ich erinnere an Schönberg und die Kontroverse über Thomas Manns „Doktor Faustus“
Keine Nebensache: der Film umspannt auch den größten Teil meines eigenen Lebens. Ein Mitschüler aus Bielefeld studierte an derselben Kunstakademie. Mit dem realen Hintergrund (der ersten Frau des realen Malers Richter) in Düsseldorf hatten wir in den 80/90er Jahren eine äußere Verbindung.
Was erinnere ich seltsamerweise als erstes? Das wogende Kornfeld. (Kindheit, vielleicht deswegen: hier)
Wichtiger Punkt: der gute Einsatz der Musik (überwältigend: Bach BWV208 am Klavier), was mich nach dem Autor dieses Parameters fragen lässt, Max Richter.
DER FILM
Nur noch bis zum 4. Januar abrufbar. Montag. Hier noch der Trailer, mit dem man nicht einverstanden sein muss:
Und in diesem Moment liegt wieder ein Buch auf dem Tisch, das ich im Dezember 2005 von lieben Kollegen zum Abschied geschenkt bekommen habe: eine geniale Geschichte der Unschärfe. Daraus nur 1 Zitat.
Auch hier bestätigt sich die Vermutung, dass interessante Bücher interessante Kritiken produzieren, vgl. hier. (Samt genauer Quellenangabe, falls man dem Buch nähertreten will.) Bemerkenswert besonders diese Sätze zur Rezension von Elke Buhr (FR):
Sie hebt hervor, dass es Ullrich gelingt, die gängige These, wonach die Fotografie der Malerei die Naturnachahmung abnahm und letztere sich darum der Abstraktion zuwenden musste, zu modifizieren. „Auch die Fotografen folgten dem Trend zur Autonomisierung von Fläche und Form, auch sie sahen die entscheidende Herausforderung darin, das reine Abbild der Realität zu transzendieren“, erklärt die Rezensentin. Bedauerlich findet sie nur, dass Ulrich am Ende seines Buches die aktuelle Unschärfeästhetik mit dem Label der „postmodernen Beliebigkeit“ kritisiert, und mit diesem Pauschalurteil seine so sorgfältig entwickelte Differenzierungsfähigkeit wieder zerstört.
Was mir noch dazu einfällt, stammt vom Filmemacher Edgar Reitz. Der Zeitungsausschnitt hängt am nächstgelegenen Bücherregal. Aber man kann ihn auch im Netz-Archiv der Süddeutschen Zeitung abrufen:
Seit ich Filme mache, beschäftigt mich, wie unser Sehsinn funktioniert. Sind unsere Augen kleine biologische Kameras und ist das Gehirn ein Bilderarchiv, in dem optische Wahrnehmungen ähnlich wie in einem Videorekorder gespeichert werden? Diese Annahme erweist sich als rettungslos naiv, wenn man als Filmemacher erlebt, wie unterschiedlich ein Film wahrgenommen wird. Man muss sich damit abfinden, dass der Zuschauer nicht objektiv wahrnimmt, was wir ihm auf der Leinwand erzählen, sondern dass jeder nur sieht, was er mit eigenen Erfahrungen bestätigen kann. Der Satz, dass ein Film im Kopf des Zusehers entsteht, dass also jeder seinen eigenen Film sieht, bewahrheitet sich in immer neuen Formen des Missverstehens. [weiter hier]
Ein ganz anderes Buch habe ich wieder hervorgesucht, das vor 60 Jahren vielleicht ein Meilenstein des Erinnerns war. Vom Gymnasium Bielefeld aus, Fach Religion, hatten wir aber auch schon im Oktober 1956 die Betheler Anstalten besucht und in der Vorbereitung vom Euthanasie-Programm der Nazis erfahren.



 dazu Wikipedia hier
dazu Wikipedia hier
Nachtrag 3. Januar 2021 (Geburtstag meines Großvaters mütterlicherseits)
Es könnte ja sein, dass mich vielleicht eine allzuschnelle Begeisterung über schöne Bilder und Töne hingerissen hat, den oben genannten Film so herauszustellen, auch die „letzte“ Möglichkeit, ihn bis morgen noch einmal abzurufen. Ich muss zur Ergänzung die Meinung eines Freundes zitieren, dessen Perspektive ich schätze, ohne sie deshalb zu übernehmen. (A propos: Kann man Perspektiven überhaupt einfach übernehmen, wie eine fremde Brille beim Lesen?)
Ich war am Anfang von der Introduktion des Films begeistert, fasziniert, angezogen von dieser unglaublichen Geschichte – auch durch die guten Schauspieler! Sebastian Koch eindrucksvoll, der brutale Vollzug der Euthanasie (über die ich später nochmal im Wikipedia-Artikel über Gerhard Richter einiges erfuhr) gut inszeniert, der Werdegang des jungen Künstlers in der frühen DDR … alles durchaus glaubwürdig!
Aber dann: Mit dem Eintritt der Hauptfigur in den Westen und in die Düsseldorfer Kunstakademie leistet sich der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck einen Schnitzer nach dem anderen.
X.Y., die/der sich intensiv mit der Zeit (ZERO-Künstler), Günther Ücker u.a. befasst hatte, fand das genauso unglaubwürdig und klischeehaft wie ich (dieser aufgebläht „mystische“ Beuys … hab so viel von Beuys auch durch Dokumentarfilme begriffen, zu denen ich in einem Fall die Musik komponierte), dieser lächerliche „Kraftprotz“ von Ücker, die „Fontana“-Leinwandschnitte usw. usf.)
Es herrschte ein ganz anderer Geist zu dieser Zeit in der Kunst und in der D’dorfer Kunstakademie … Von Donnersmarck bringt es fertig, die dümmsten Klischees zu reproduzieren, die auch noch die dümmsten Vorurteile gegenüber diesen Künstlern mobilisieren (u.a. das Fett & Filz-Klischee bei Beuys).
Es war nur konsequent, dass sich Gerhard Richter von diesem Film distanzierte, der „es geschafft hat, meine Biografie zu missbrauchen und übel zu verzerren.“ Aber darüberhinaus eine ganze Künstlergeneration in eine unglaubwürdige Atmosphäre versetzt, um daraus eine „spannende Kinogeschichte“ zu machen …
So schreibt jemand in der Kunstzeitschrift MONOPOL m.E. zu recht:
„… Oliver Masucci als Joseph-Beuys-Verschnitt spachtelt riesige Fettecken und erzählt nochmal die beliebte – bei Donnersmarck nun wieder wahre – Tataren-Legende, während sein Student nach einer schlimmen Schaffenskrise endlich zur fotorealistischen Malerei findet. Zum Heureka erklingt Max Richters wabernde „Rheingold“-Musik. Wenn Kurt schließlich ein Bild malt, mit dem er den Schwiegervater-Schurken entlarvt, ist die Rosamunde-Pilcher-Höchstmarke erreicht. Das Ergebnis zählt? Mit „Werk ohne Autor“ verliert Florian Henckel von Donnersmarck nach Punkten.“
Nun ja, es sind wahrscheinlich – Du hast es angedeutet in Deinem Blog – ganz andere Assoziationen, die Dich über diese Schwächen des Films hinwegsehen ließen … Aber was Du geschrieben hast, wollte ich so nicht ohne Kommentar stehenlassen.
* * *
Was sage ich dazu? Bitte, ohne – weil das letzte Wort – damit recht behalten zu wollen! Ich erinnere nur daran, dass es nicht um die empirische Person Gerhard Richter ging. Auch die andern Künstler waren nicht mit „Echt-Namen“ versehen. Deshalb habe ich an die Auseinandersetzung Arnold Schönberg / Thomas Mann betreffend „Doktor Faustus“ erinnert. Niemand kann sich einen wirklichen Künstler mit allen biographischen und werkimmanenten Details in der bloßen Phantasie ausmalen… Nicht einmal Goethe.
* * *
Heinrich Arnhölter, geb. 3. Januar 1882 zu Solterwisch, Krs. Exter, gest. 14. Januar 1966, Lohe bei Bad Oeynhausen.