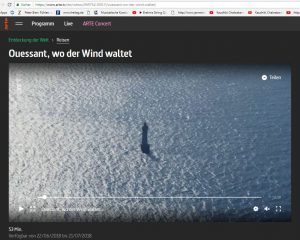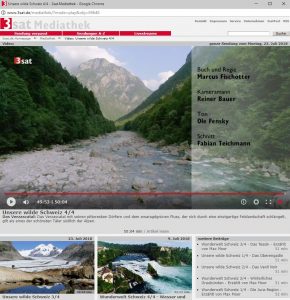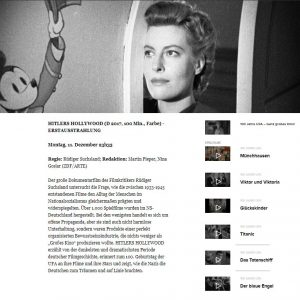Mehrere Themen, die mir unter den Nägeln brennen. Oder im Herzen, was schwülstiger klingt, aber besser zu dem geplanten Fortgang des Satzes passt: man muss sie behandeln, ehe sie erkalten.
1) Es geht um ein Lied, „La Chanson d’Hélène“ aus dem Film „Die Dinge des Lebens“, den ich erst spät, – aufgrund des Interviews mit Matthias Brandt -, kennengelernt habe. Ich glaube, eine wesentliche Komponente – jedenfalls einen Anteil, der die ausweglose Stimmung des Filmes zumindest vertieft und jederzeit wieder aufruft – bildet die wiederkehrende Melodie, und zwar mit der Stimme Romy Schneiders, die Cover-Fassungen kann ich nicht gelten lassen. Zu dem Erlebnis gehört, dass ich die Melodie letztlich nicht gut gemacht finde. Ein „Trotzdem“ gehört dazu.
2) Es geht um Rom. Da ich neuerdings wieder Max Weber auf CD-Rom durchstöbert habe, mich in mehreren Themen festgelesen habe, vor allem aber in dem Aufsatz „Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur“. Gleich am Anfang stellt er Fragen, die ich immer schon hätte stellen wollen, aber nicht ernst genommen habe. Etwa in der Art wie Brechts Fragen eines lesenden Arbeiters: „Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?“ Ich weiß: sie hatten nur Befehlsgewalt, aber warum haben sie im Fall Rom, das ja Hunderte von Jahren bestand, aufgehört zu befehlen. Warum ist es untergegangen? Ja, ich weiß, es gibt ein Geflecht von Gründen, aber letztlich steht der Grund, den Max Weber behandelt, auch in Brechts Gedicht. Aber wenn ich danach in die Geschichtsbücher schaue, etwa in den bewährten Überblick von Imanuel Geiss (Seite 118) oder in das frühe Buch von Herfried Münkler über „Imperien“, so suche ich vergeblich.
3) Und schließlich geht es wohl um ein Buch, das ich erst morgen besitzen werde: „Der Klang“, – es ist mir nicht ganz geheuer: es stammt von einem Geigenbauer, enthält offenbar viel Wissenswertes, aber auch ein Glaubensbekenntnis. Und das trifft mich als lesenden Geiger, der auch gern Fragen stellt, irgendwie auf dem falschen Bein. Habe ich doch gerade wieder kursorisch „Das Böse“ von Rüdiger Safranski rekapituliert und darin vorgemerkt, was Kant zu den Versuchen sagt, den Willen Gottes aus seinen Naturwerken oder denen seiner irdischen Helfershelfer herauslesen zu wollen. Er nennt es „Phantome“, und der Geigenklang ist zweifellos ein „Naturwunder“, gehört aber in diesem Sinne auch zu den Phantomen. Passend zur Weichheit, die sich des Gehirns der Menschen gern zur Weihnachtszeit bemächtigt. Auch meine Oma hat gern davon gesprochen und „bis ins kleinste die wunderbaren Zweckzusammenhänge und ihren Nutzen für den Menschen darzulegen“ (Safranski Seite 310) versucht, insbesondere am Beispiel der Blumenblüten und der Bienen. Sie wusste allerdings nichts von dem Fachbuch „Insecto-Theologie“, das im Jahre 1738 erschienen ist: ein „Vernunfft- und schrifftmäßiger Versuch wie ein Mensch durch aufmercksame Betrachtungen der sonst wenig geachteten Insecten zu lebendiger Erkänntnis und Bewunderung der Allmacht, Weißheit, der Güte und Gerechtigkeit des großen Gottes gelangen könne.“
Aber keine Angst: ich spotte nicht. Ich frage nur! Und staune. Hier.
Nachtrag 8.12.2016
Inzwischen besitze ich das zuletzt genannte Buch, nein, nicht die Insecto-, sondern eine Art Violino-Theologie, habe sie von Anfang bis Ende durchgeblättert. Im Namen der Geige: lesen werde ich das nicht. Vielleicht die „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ – aber diese aus historischen Gründen (1796).
Es gibt Übersetzungsfehler, die ähnlich dem – nach Freud – typischen „Versprecher“ eine Wahrheit ans Licht bringen, heute mehr denn je: Auf einer unserer Italien-Tourneen (Collegium Aureum mit dem Tölzer Knabenchor) sahen wir auf den Plakaten in der Stadt unter der Ankündigung in großen Lettern ORATORIO DI NATALE als deutschen Titel: Weichnachtsoratorium. (Siehe am Ende dieses Artikels!)
Nachtrag 20.12. zu Roms Niedergang (Max Weber)
Ich halte den Anfang von Webers Gedanken über Roms Niedergang lieber sofort griffbereit, ehe ich vergesse, was mir bei ihm besonders plausibel erschien. Egal ob es bei Karl Marx vielleicht längst detaillierter ausgeführt wurde. Das Hauptargument der Funktion der Sklaven sollte weiterführen. Zumal es möglich scheint, dass ihre Bedeutung im Christentum eine ganz andere wurde und das Christentum sich im Grunde die bürokratische Ordnung und Verwaltung des Römischen Reiches (der zivilisierten Welt) zunutze machte. Das habe ich undeutlich in Erinnerung, ohne einen konkreten Beleg vorweisen zu können: das Christentum als effektives Verwaltungssystem, das die äußere Ordnung durch eine innere (totalitäre!) ergänzte: die Erfassung jeder menschlichen Seele (samt Körper) von der Wiege bis zur Bahre… Wie gelingt es Weber, unser Interesse zu „erzwingen“? De te narratur fabula, sagt er. Und ich möchte naseweiß hinzufügen: Tua res agitur. Deine Sache wird betrieben. Jeder weiß, dass die Zeit, „da Pontius Pilatus Landpfleger war“ – samt nachfolgenden Jahrhunderten – uns nicht Hekuba sein kann…
Das Römische Reich wurde nicht von außen her zerstört, etwa infolge zahlenmäßiger Überlegenheit seiner Gegner oder der Unfähigkeit seiner politischen Leiter. Im letzten Jahrhundert seines Bestehens hatte Rom seine eisernen Kanzler: Heldengestalten wie Stilicho, germanische Kühnheit mit raffinierter diplomatischer Kunst vereinigend, standen an seiner Spitze. Warum gelang ihnen nicht, was die Analphabeten aus dem Merowinger-, Karolinger- und Sachsenstamme erreichten und gegen Sarazenen und Hunnen behaupteten? – Das Reich war längst nicht mehr es selbst; als es zerfiel, brach es nicht plötzlich unter einem gewaltigen Stoße zusammen. Die Völkerwanderung zog vielmehr nur das Fazit einer längst im Fluß befindlichen Entwicklung.
Vor allem aber: die Kultur des römischen Altertums ist nicht erst durch den Zerfall des Reiches zum Versinken gebracht worden. Ihre Blüte hat das römische Reich als politischer Verband um Jahrhunderte überdauert. Sie war längst dahin. Schon anfangs des dritten Jahrhunderts versiegte die römische Literatur. Die Kunst der Juristen verfiel wie ihre Schulen. Die griechische und lateinische Dichtung schliefen den Todesschlaf. Die Geschichtsschreibung verkümmerte bis zu fast völligem Verschwinden, und selbst die Inschriften begannen zu schweigen. Die lateinische Sprache war bald in voller Degeneration begriffen. – Als anderthalb Jahrhunderte später mit dem Erlöschen der weströmischen Kaiserwürde der äußere Abschluß erfolgt, hat man den Eindruck, daß die Barbarei längst von innen heraus gesiegt hatte. Auch entstehen im Gefolge der Völkerwanderung keineswegs etwa völlig neue Verhältnisse auf dem Boden des zerfallenen Reichs; das Merowingerreich, wenigstens in Gallien, trägt zunächst in allem noch ganz die Züge der römischen Provinz. – Und die Frage, die sich für uns erhebt, ist also: Woher jene Kulturdämmerung in der antiken Welt?
Mannigfache Erklärungen pflegen gegeben zu werden, teils ganz verfehlt, teils einen richtigen Gesichtspunkt in falsche Beleuchtung rückend:
Der Despotismus habe die antiken Menschen, ihr Staatsleben und ihre Kultur gewissermaßen psychisch erdrücken müssen. – Aber der Despotismus Friedrichs des Großen war ein Hebel des Aufschwungs. –
Der angebliche Luxus und die tatsächliche Sittenlosigkeit der höchsten Gesellschaftskreise haben das Rachegericht der Geschichte heraufbeschworen. – Aber beide sind ihrerseits Symptome. Weit gewaltigere Vorgänge als das Verschulden Einzelner waren es, wie wir sehen werden, welche die antike Kultur versinken ließen. –
Das emanzipierte römische Weib und die Sprengung der Festigkeit der Ehe in den herrschenden Klassen hätten die Grundlagen der Gesellschaft aufgelöst. Was ein tendenziöser Reaktionär, wie Tacitus, über die germanische Frau, jenes armselige Arbeitstier eines kriegerischen Bauern, fabelt, sprechen ähnlich Gestimmte ihm heute nach. In Wahrheit hat die unvermeidliche »deutsche Frau« so wenig den Sieg der Germanen entschieden, wie der unvermeidliche »preußische Schulmeister« die Schlacht bei Königgrätz. – Wir werden vielmehr sehen, daß die Wiederherstellung der Familie auf den unteren Schichten der Gesellschaft mit dem Niedergang der antiken Kultur zusammenhängt. –
Aus dem Altertum selbst dringt Plinius‘ Stimme zu uns: »Latifundia perdidere Italiam«. Also – heißt es von der einen Seite – die Junker waren es, die Rom verdarben. Ja – heißt es von der andern – aber nur weil sie dem fremden Getreideimport erlagen: mit dem Antrag Kanitz also säßen die Cäsaren noch heute auf ihrem Throne. Wir werden sehen, daß die erste Stufe zur Wiederherstellung des Bauernstandes mit dem Untergang der antiken Kultur erstiegen wird. –
Damit auch eine vermeintlich »Darwinistische« Hypothese nicht fehle, so meint ein Neuester u.a.: der Ausleseprozeß, der sich durch die Aushebung zum Heere vollzog und die Kräftigsten zur Ehelosigkeit verdammte, habe die antike Rasse degeneriert. – Wir werden sehen, daß vielmehr die zunehmende Ergänzung des Heeres aus sich selbst mit dem Untergang des Römerreichs Hand in Hand geht.
Genug davon. – Nur noch eine Bemerkung, ehe wir zur Sache kommen:
Es kommt dem Eindruck, den der Erzähler macht, zu gut, wenn sein Publikum die Empfindung hat: de te narratur fabula, und wenn er mit einem discite moniti! schließen kann. In dieser günstigen Lage befindet sich die folgende Erörterung nicht. Für unsere heutigen sozialen Probleme haben wir aus der Geschichte des Altertums wenig oder nichts zu lernen. Ein heutiger Proletarier und ein antiker Sklave verständen sich so wenig, wie ein Europäer und ein Chinese. Unsre Probleme sind völlig andrer Art. Nur ein historisches Interesse besitzt das Schauspiel, das wir betrachten, allerdings eines der eigenartigsten, das die Geschichte kennt: die innere Selbstauflösung einer alten Kultur.
Jene eben hervorgehobenen Eigentümlichkeiten der sozialen Struktur der antiken Gesellschaft sind es, die wir uns zunächst klar machen müssen. Wir werden sehen, daß durch sie der Kreislauf der antiken Kulturentwicklung bestimmt wurde. –
Die Kultur des Altertums ist ihrem Wesen nach zunächst: städtische Kultur. Die Stadt ist Trägerin des politischen Lebens wie der Kunst und Literatur. Auch ökonomisch eignet, wenigstens in der historischen Frühzeit, dem Altertum diejenige Wirtschaftsform, die wir heute »Stadtwirtschaft« zu nennen pflegen. Die Stadt des Altertums ist in hellenischer Zeit nicht wesentlich verschieden von der Stadt des Mittelalters. Soweit sie verschieden ist, handelt es sich um Unterschiede von Klima und Rasse des Mittelmeers gegen diejenigen Zentraleuropas, ähnlich wie noch jetzt englische und italienische Arbeiter und deutsche und italienische Handwerker sich unterscheiden. – Ökonomisch ruht auch die antike Stadt ursprünglich auf dem Austausch der Produkte des städtischen Gewerbes mit den Erzeugnissen eines engen ländlichen Umkreises auf dem städtischen Markt. Dieser Austausch unmittelbar vom Produzenten zum Konsumenten deckt im wesentlichen den Bedarf, ohne Zufuhr von außen. – Aristoteles‘ Ideal: die autarkeia (Selbstgenügsamkeit) der Stadt – war in der Mehrzahl der hellenischen Städte verwirklicht gewesen.
Quelle Max Weber: Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur. (1896)
Nur noch 2 herausgegriffene Zitate als Hinweis zum weiteren Verlauf des Gedankenganges:
Aber während aus dem Mittelalter die freie Arbeit und der Güterverkehr in zunehmendem Maß als Sieger hervorgehen, verläuft die Entwicklung des Altertums umgekehrt. Was ist der Grund? Es ist derselbe, der auch den technischen Fortschritten des Altertums ihre Schranken setzte: die »Billigkeit« der Menschen, wie sie durch den Charakter der unausgesetzten Kriege des Altertums hervorgebracht wurde. Der Krieg des Altertums ist zugleich Sklavenjagd; er bringt fortgesetzt Material auf den Sklavenmarkt und begünstigt so in unerhörter Weise die unfreie Arbeit und die Menschenanhäufung. Damit wurde das freie Gewerbe zum Stillstand auf der Stufe der besitzlosen Kunden-Lohnarbeit verurteilt. Es wurde verhindert, daß mit Entwicklung der Konkurrenz freier Unternehmer mit freier Lohnarbeit um den Absatz auf dem Markt diejenige ökonomische Prämie auf arbeitsparende Erfindungen entstand, welche die letzteren in der Neuzeit hervorrief. Hingegen schwillt im Altertum unausgesetzt das ökonomische Schwergewicht der unfreien Arbeit im »Oikos«. Nur die Sklavenbesitzer vermögen ihren Bedarf arbeitsteilig durch Sklavenarbeit zu versorgen und in ihrer Lebenshaltung aufzusteigen. Nur der Sklavenbetrieb vermag neben der Deckung des eigenen Bedarfs zunehmend für den Markt zu produzieren.
***
Die Sklavenkaserne vermochte sich nicht aus sich selbst zu reproduzieren, sie war auf den fortwährenden Zukauf von Sklaven zur Ergänzung angewiesen, und tatsächlich wird von den Agrarschriftstellern dieser Zukauf auch als regelmäßig stattfindend vorausgesetzt. Der antike Sklavenbetrieb ist gefräßig an Menschen, wie der moderne Hochofen an Kohlen. Der Sklavenmarkt und dessen regelmäßige und auskömmliche Versorgung mit Menschenmaterial ist unentbehrliche Voraussetzung der für den Markt produzierenden Sklavenkaserne. Man kaufte billig: Verbrecher und ähnliches billige Material solle man nehmen, empfiehlt Varro mit der charakteristischen Motivierung: – solches Gesindel sei meist »gerissener« (»velocior est animus hominum improgorum«).
***
Rückblende 1990 (Handy-Foto JR)

 Nachspann-Screenshots JR
Nachspann-Screenshots JR Namen zur Musik im Nachspann
Namen zur Musik im Nachspann Der Anfang der Reise (bis 24.4.67)
Der Anfang der Reise (bis 24.4.67)