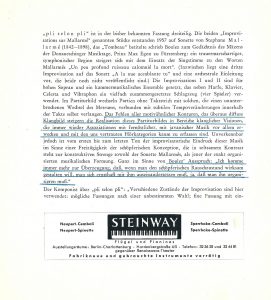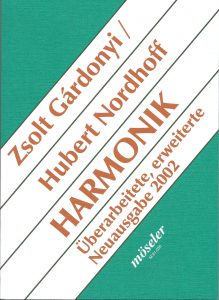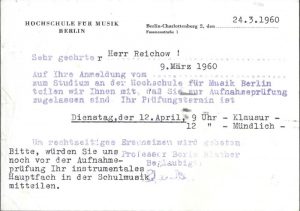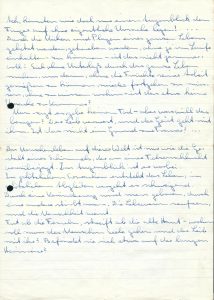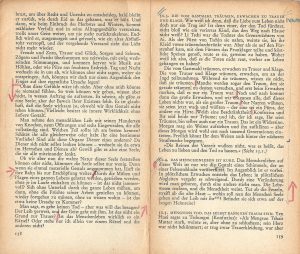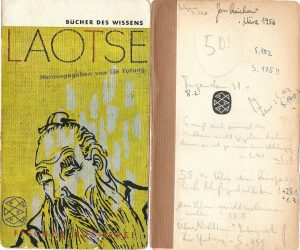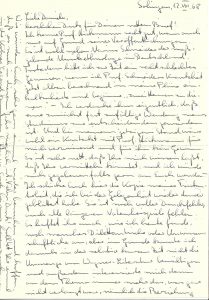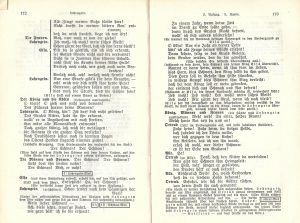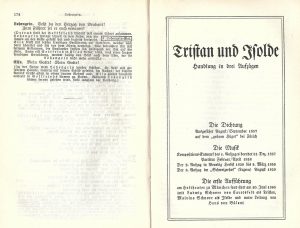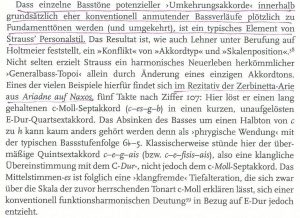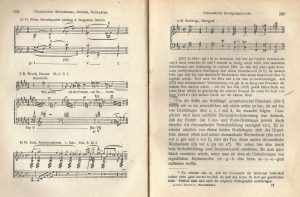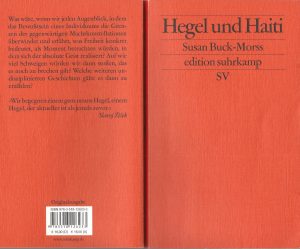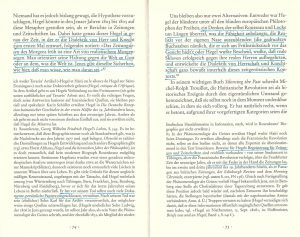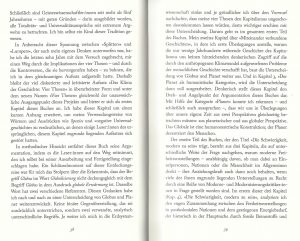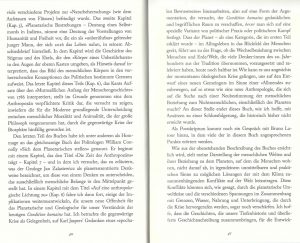Fragen vorm Isenheimer Altar
Neulich stellten sich angesichts einer Bildbetrachtung (siehe hier) scheinbar nebensächliche Fragen ein, die ich (mir) separat beantworten möchte. Man weiß ja, dass Leonardo da Vinci neben seinen berühmten Gemälden auch Kriegsgeräte für den praktischen Gebrauch hergestellt hat, also kann man wohl im Fall des Malers Grünewald bei zusätzlichen Berufsbezeichnungen ebenso davon ausgehen, dass er nicht nur gemalt, geschnitzt und gemeißelt hat, sondern dass er im Umgang mit der Materie noch ganz andere Fähigkeiten entwickelt hat. Aber es hat gedauert, ehe ich herausgefunden habe, wofür denn ein „Wasserkunstmacher“ zuständig ist. Inzwischen weiß ichs und halte die entsprechende Quelle für alle Zeiten fest, – siehe insbesondere einen der ersten Links im folgenden Text, von mir fettgedruckt:
Was ist ein Wasserkunstmacher? (Quelle: DeWiki Austria-Forum hier)
Wie bei vielen anderen Künstlern seiner Zeit umfasste das Berufsverständnis einen sehr weiten Bereich von Tätigkeiten. 1510 sollte er den Brunnen auf Burg Klopp bei Bingen am Rhein reparieren, er zählte daher zu den sogenannten Wasserkunstmachern (heute würde man wohl Wasserbauingenieur sagen). Als oberster Kunstbeamter bei Hofe hatte er aber auch Neubauten zu beaufsichtigen und leitete in dieser Funktion die Umbauarbeiten in der Aschaffenburger Burg, dem Vorgängerbau von Schloss Johannisburg. Seine dortige Tätigkeit wurde der Nachwelt wohl nur deshalb überliefert, weil die Arbeiten misslangen und es zu einem Prozess kam (Kemnatprozess 1514–16).
Die Prozessakte, die neben seinem Testament als eines der wichtigsten „Grünewalddokumente“ galt, jedoch im Zweiten Weltkrieg im Stadtarchiv Frankfurt verbrannte, ließ erkennen, dass der Künstler den Großteil der Zeit des Prozesses nicht selber anwesend war. Dies stimmt mit der überlieferten Entstehungszeit seines Hauptwerks, dem Isenheimer Altar, zusammen, den er wohl zwischen frühestens 1512 und spätestens 1516 schuf. Die jüngere Forschung hat ins Spiel gebracht, dass er in der genannten Zeitspanne nicht in Isenheim selbst, sondern der nächsten größeren Stadt, Straßburg, tätig war.
Danach, also etwa 1516, trat Grünewald als Hofmaler in den Dienst des neuen Erzbischofs von Mainz, Albrecht von Brandenburg. Für diesen war er erneut als oberster Kunstbeamter des erzbischöflichen Hofes in der Residenzstadt Halle an der Saale für die Überwachung von Bauvorhaben zuständig. In dieser Funktion wurde er beauftragt, als Wasserkunstmacher eine Wasserleitung von Haibach zur Stiftskirche in Aschaffenburg zu planen und deren Bau zu überwachen.
Um 1526 schied Grünewald aus dem Hofdienst und ließ sich in Frankfurt am Main nieder, was oft in Zusammenhang mit Sympathien für die rebellierenden Kräften des Bauernkrieges gesehen wird. In der freien Reichsstadt verdiente er seinen Lebensunterhalt als Seifenmacher; er wohnte in dem Haus Zum Einhorn bei dem Seidensticker Hans von Saarbrücken. Im Sommer 1527 übersiedelte er wieder an seine frühere Wirkungsstätte Halle, wo er eine Mühlenzeichnung für Magdeburg anfertigen sollte. Freunde des Künstlers teilten dem Magistrat der Stadt am 1. September 1528 mit, dass er verstorben sei.
Soweit so gut.
Aber was ist mit Grünewalds Körper? Mit seinem eigenen und mit seinem Gefühl für andere, z.B. den Körper Christi. Warum diese Frage gerade an ihn, den Ungreifbaren, den großen Unbekannten, von dem kein einziges, wirklich beglaubigtes Selbstportrait überliefert ist? Ich erinnere mich an die Theorie von den zwei Körpern des Königs (siehe hier) und an deren Erfinder (hier) Ernst Kantorowicz. Und hoffe, darüberhinaus dann zu meinem Ausgangspunkt, einer Seite der ZEIT vom 28. Juli 2022, zurückkehren zu können, wo sich eigentlich sehr bald musikalische Fragen eingestellt haben, nämlich zur „historisch informierten Praxis“.
 von Jörg Scheller
von Jörg Scheller
Natürlich ist mir als erstes aufgestoßen, dass dieser Artikel – leicht schockierend – sofort signalisiert, dass er eine höchst moderne Sicht auf die abgebildete Kreuzigungsszene vermitteln will. Und zwar mit den Worten: „Es ist ja nicht so, dass Jesus immer so drauf war. Am Anfang seiner Laufbahn wirkte er cool.“ (Das Wörtchen „fit“ fehlt mir grad noch.) Damit wird der imaginierte Blick zuerst auf eine andere Darstellung gelenkt, nämlich die erste überhaupt, die sich am 432 n. Chr. entworfenen Hauptportal der Basilika Santa Sabina auf dem Aventin in Rom befinden soll. Womit ein enormer Bildungsvorsprung des Autors umrissen ist, den ich ihm gern zugestehe und auch stante pede auszugleichen suche, indem ich das Internet bemühe, Wikipedia sei Dank!
 siehe Wikipedia hier
siehe Wikipedia hier
Irre ich mich? hier soll die erste bekannte Kreuzigungsszene der Geschichte zu sehen sein? Es passt nicht ganz. Zitat:
Jesus steht, die durchbohrten Hände den Betrachtern zugewendet, in Gekreuzigtenpose mit schwer zu deutendem Gesichtsausdruck vor einer Mauer. Kruzifixe der Romanik wiederum präsentieren ihn als Triumphator. Souverän erwidert er vom Kreuz herab die Blicke der Betrachter. Von Todeskampf keine Spur. Der Gefolterte ist evident fit und lebendig.
„Evident fit“, könnte stimmen, ja, allerdings irre ich mich! dies (oben) ist das Fresko in der Apsis, es geht aber um den Eingang der Kirche, die gemeinte Szene befindet sich aber keineswegs „am Hauptportal der Basilika“, sondern auf der Flügeltür dieses Hauptportals (siehe hier). Das obige Bild stammt aus dem Jahr 1569. Auf der Holztür von 432 erkennt man irgendwie den Bezug zur Kreuzigung, der „schwer zu deutende Gesichtsausdruck“ ist allerdings, wenn ich recht sehe, weder zu deuten noch überhaupt als Andeutung zu ahnen. Man vergrößere nur nach Belieben…

Das Hineinlegen ist manchmal attraktiver als das Auslegen, und so geht es weiter:
Grünewald war mit hoher Wahrscheinlichkeit von frühen lutherischen Predigten beeinflusst und entsprechend bemüht, die Heilsgeschichte auch ästhetisch zu reformieren, das heißt: unmittelbar erlebbar zu machen. Das mag aus heutiger Sicht überraschen, wird die Reformation doch vor allem mit Bilderstürmerei in Verbindung gebracht. [usw.]
Wenn der Isenheimer Altar tatsächlich in die Zeit 1512-1516 zu datieren ist, die Reformation aber mit den 95 Thesen begann, die Luther 1517 an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben soll, wie sollte Grünewald schon frühe Predigten Luthers gehört haben? Und wo? Zitat:
Luther hatte sich klar gegen kunstfeindliche Reformatoren abgegrenzt und betont, »daß ich nicht der Meinung bin, daß durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollte alle Künste, sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienst des, der sie geben und geschaffen hat«.
Das wäre schön gesagt, steht aber geschrieben erst im Vorwort des Geistlichen Gesangbüchleins von Johann Walther, das Luther mit einer Vorrede versehen hat: veröffentlicht im Jahre 1524. Mehr über die Wittenberger Ereignisse der Jahre vorher hier.
Die Leiden Christi mit großer Schärfe darzustellen, war in dieser Zeit aber seit etwa 1500 geradezu verbindlich geworden, wie man bei Altdorfer, Dürer, Cranach und anderen Meistern studieren kann. Neu war es vielleicht, die körperlichen Spuren der Leiden auch in Spitälern so drastisch zu demonstrieren, dass die kranken Menschen wirklich glaubten, damit nicht allein zu sein. Ein Sinn dahinter wurde unmittelbar nachvollziehbar. Das Antoniter-Kloster in Isenheim war eine durchaus katholische Einrichtung. Wenn der ZEIT-Autor auch an Luther anschließt:
Zudem richtete sich das ursprüngliche Retabel nicht nur an Kleriker, sondern auch an Kranke, die in der Antoniter-Präzeptorei von Isenheim, wo der Altar ursprünglich aufgestellt war, behandelt wurden. Vermutlich führte man sie vor die Bildwerke, um ihre physische Genesung metaphysisch zu unterstützen – Komplementärmedizin, wenn man so will. Im Gekreuzigten konnten sie eine veritable Identifikationsfigur finden: Schaut, auch der Messias hat gelitten! Und dieses Leiden war nicht abstrakt, sondern real. Entsprechend tut sich hinter Jesus ein innerweltlicher Himmel auf. Vor der Restaurierung schien sich dieser in weitestgehend homogenem Schwarz zu erschöpfen. Nun aber sind Graustufen erkennbar, die den realistischen Eindruck verstätken. Auf den übrigen Tafeln des Ensembles empfehlen sich Heilige wie Antonius, Sebastian, Maria und Paulus als charakterfeste Vorbilder.
Schließlich die Frage: Welchen Effekt hat die Restaurierung auf das komplexe Gesamtwerk? Dieses Beispiel – so der Autor – beweist, dass erst die restauratorische Kärrnerarbeit, die naturwissenschaftlich informierte Untersuchung und Sorge ums Detail, seriöse und werkadäquate Deutungen ermöglicht. Inwiefern?
Dank des restaurierten Zustands kann man jetzt viel stärker Bezüge zur Gegenwart herstellen und diese mit dem ganzen Körper erleben. Trennende Schichten zwischen Gestern und Heute sind im buchstäblichen Sinne abgetragen worden – auf dem Kettenhemd eines Soldaten in der Auferstehungsszene etwa tritt ein Blutfleck zutage, den der Firnis verborgen hatte. Vor allem das Leiden am Kreuze erscheint in seiner direkten Drastik als unzeitgemäßes, aber gerade deshalb erhellendes Symbol in Gesellschaften, die sich den Kampf gegen Schmerzen aller Art auf die Fahnen schreiben. In der Begegnung mit Grünewald spürt man, wie der Versuch, Schmerz gänzlich zu eliminieren – sei es durch freizügigen Gebrauch von Opioiden oder im Bemühen, noch die subtilste »Mikroaggression« zu unterbinden, mit dem Verlust von Intensität, Ekstase und vielleicht auch mit dem Verlust zumindest zeitweiliger Erlösung einhergehen kann.
Der Autor verweist schließlich auf den Philosophen Leszek Kolakowski als Kritiker einer (christlichen) Religion, die den Wert des Leidens nicht mehr akzeptiert. Bei einer notorischen Ausklammerung von Leid und Schmerz fehlten einer Kultur elementare Erfahrungen. Kolakowski: „Im körperlichen Schmerz werde ich vom Körper, der ich bin, aufgegeben. Ich höre auf, er zu sein, und werde zur Erfahrung dieses Körpers, das heißt eben zur Erfahrung des Leidens.“ Der Schmerz bedeute, dass man nicht einfach Körper ist, sondern dass ein Unterschied zwischen dem Selbst und seiner Physiologie bestehe. Es ist leicht, dies kritisch auf unsere Gesellschaft und ihre Techniken der Schmerzvermeidung zu beziehen. Der Autor kommt am Ende zu einem Fazit, das nicht so sehr überrascht, wenn man an den Kosmos der barocken Affekte vorausgedacht hat:
Der Isenheimer Altar erschöpft sich eben nicht in der Betonung von Verwesung und Verfall, Leid und Schmerz. Nur in geschlossenem Zustand des Altars stehen diese im Vordergrund. Hinter ihnen, gewissermaßen in der Latenz, explodieren in der zweiten und dritten Wandlung der Altarflügel Pracht, Luxus, Freude, Fantasie, Kreativität, Ekstase. Grünewald und Hagenau legen nahe, dass Schmerz und Freude, Leid und Sinnstiftung zwei Seiten derselben Medaille sind. Eliminiert man das eine, eliminiert man das andere.
Und wenn ich Bachs Weihnachtsoratorium neben seinen Passionen sehe, frage ich mich, worin der Unterschied in der Weltsicht besteht.
Des weiteren verliere ich mich in der seltsamen Sammlung eines Comic-Zeichners HIER. Dürer, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach usw.
Zum Abschied ein besonders cooles Foto vom Isenheimer Altar HEUTE (Herkunft privat) :