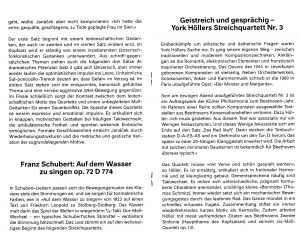Programmhefttext von Verena Großkreutz. Die schöne Kurz-Charakteristik des Schubertwerkes D 703 aus der Feder derselben Autorin sei hier noch zitiert:
(…) Schuberts einzeln gebliebener Quartettsatz c-Moll beginnt ausgesprochen rau. Geisterhaftes, kaltes, wildes Moll-Tremolo und auffahrende Gesten stehen auf der einen Seite, auf der anderen ein verträumtes, sehnendes Lied in Dur. Beide artikulieren sich nicht als festumrissene Themen, sondern eher als Klanggestalten, die zunächst relativ unvermittelt miteinander konfrontiert werden – ein interessantes Experiment mit der Sonatenform. Erst in der Durchführung durchdringen sich beide gegenseitig, mit dem Ergebnis, dass ihre Reihenfolge in der Reprise vertauscht wird. Weshalb der Satz mit dem wüsten Tremolo-Gedanken schließt.
Dies war das Quartett in der früheren Besetzung (über den Wechsel 2016 hier).
Das zu erwartende Programm hatte ursprünglich etwas (bzw. grundlegend) anders ausgesehen, mit dem großen G-dur-Quartett von Schubert im zweiten Teil, und genau dies war ausschlaggebend für mich, als mir mein Freund von heute auf morgen ermöglichte, das Konzert an seiner Stelle wahrzunehmen. Als zweites kam der Punkt Janáček, – dessen Quartett „Kreutzersonate“ ich auswendig zu kennen glaubte, seit der ersten LP mit dem Smetana-Quartett, dann mit dem Kreuzberger Quartett (in dem ein ehemaliger Solinger Spielfreund als Cellist mitwirkte), schließlich die Nonplusultra-Aufnahme mit dem Belcea-Quartett. Außerdem hatte ich in den 90er Jahren mit der Substanz dieses Streichquartetts viel Zeit verbracht, als ich den Booklettext für das Abeggtrio schrieb, das eine rekonstruierte Klaviertrio-Fassung des Werkes eingespielt hatte. Ach, und das Bonbon des Tolstoi-Walzers. Kurz: nachdem ich telefonisch erfuhr, dass es nicht möglich war, eine zweite Karte für das unter Corona-Bedingungen veränderte Konzert hinzuzukaufen (meine Frau hat im selben Semester wie York Höller Musik studiert, als ich sie 1964 kennenlernte), wollte ich den ganzen Plan fallen lassen. Die nagende Aussicht auf Janáček war letztlich ausschlaggebend, um 18 Uhr doch ins Auto zu steigen und allein nach Köln zu fahren. Zusätzliche Motive: der Quartettsatz in c-moll von Schubert, dem ich seit der Gymnasialzeit (im Laienquartett 1957) immer wieder begegnet bin, und Schulhoff ist immer interessant – und die Schubert-Lieder… der Streichquartettklang überhaupt … und und und …
Übrigens: die Realität von Kammermusik im Konzertsaal ist eine völlig andere Sache als in einer youtube-Aufnahme, die einer letzten Probe gleicht (s.u.). Der ferne Klang – real – aber völlig anders fern als auf dem nahen PC-Bildschirm, kaum zu beschreiben, wie man da in einem coronabedingt weit auseinandergezogenen Publikum sitzt, das sich mucksmäuschenstill verhält, – was für eine beklommene Intimität da zwischen Saal und Bühne entsteht, in der fahlen rosa-beigen Beleuchtung. Ein seltsamer, fast magischer Zauber. (Das vielfach bemühte Wort „magisch“ beruht meist auf Sprachnot; bitte: an dieser Stelle nicht.)
Tatsächlich glaubte ich, das Janáček-Quartett noch nie im Leben so gehört zu haben, das wilde Mosaik der Motive so disparat in den Raum gesplittet und doch so eng aneinander gekettet wahrzunehmen, eine hinreißende Polyphonie, so bohrend repetitiv sie sich auch gibt. Es ist eine Kombination der verschiedenen Ebenen, wie man sie von keinem andern Komponisten jener Zeit kennt. Adorno bezeichnete seine Kunst mit großem Respekt als exterritorial, und sie ist uns heute so nahe gerückt wie wenig anderes. Und dies gerade in einer solchen, wahrhaft kongenialen Interpretation, bei der mir auch die einzelnen Instrumente – ähnlich wie die Menschen im Publikum – weiter als sonst voneinander entfernt schienen, was den gelegentlichen Zusammenprall der Klänge um so kompakter wirken ließ.
Es waren diese Tugenden, die auch das neue Werk von York Höller zu so hervorragender Wirkung brachten. Es ist im Programmheft sehr treffend charakterisiert, frappierend, wie die Beethoven-Zitate, auch das schiere Dreiklangsthema der Zweiten, auftauchten und verschwanden, ohne den geistreichen, funkelnden Zusammenhang zu stören. Ich kenne kein einziges anderes Werk dieses Komponisten, würde mir jetzt aber für jedes andere Gelegenheit und Zeit nehmen. Aber schauen Sie hier, – ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Mehr zum Signum-Quartett HIER.
Bewegend, wie dieses kaum 200köpfige, im weiten Rund verteilte Publikum begeisterten Applaus spendete, buchstäblich nicht enden wollend, als das Quartett zuletzt noch einmal auf die Bühne zurückkam und die erhaltenen Blumen auf den Boden legte: jeder wusste, warum, und der Primgeiger Florian Donderer blieb vorne stehen, sichtlich gerührt, um seinen Dank auszusprechen: dass sie heute zum ersten Mal wieder nach drei Monaten ein Konzert geben dürfen, unter veränderten Umständen, so dass das große Werk, das ursprünglich am Ende des Programms stehen sollte, Schuberts letztes gewaltiges Streichquartett in G-dur, nicht in die vorgeschriebene Zeit von anderthalb Stunden passte. So hatten sie den Musikablauf grundlegend umgestaltet. Natürlich sei klar, dass sie die Wochen und Monate eisern geübt haben, ohne zu wissen, was folgen wird. Und viel nachgedacht, auch gezweifelt haben an der Rolle, die ihnen künftig noch offensteht. Dass sie rausmüssen, Musik ist alles, was sie haben und dazu gehören Menschen, die es miterleben wollen. Ich bin nicht sicher, ob ich alles akustisch korrekt verstanden habe, aber er schloss etwa folgendermaßen:
„…vielleicht ist auch die Musik, die wir machen und die Konzerte, die wir spielen, sehr in eine Routine eingebettet. Natürlich versuchen wir immer Besonderes herauszufiltern, aber dadurch, dass es nun ein so sonderbares und besonderes Konzert wurde, hat es mir, nein, ich glaube: uns allen besonders viel bedeutet. Und weil Sie so viel geklatscht haben, und weil Sie dies alles so durchhalten, – ich weiß, in welcher künstlichen Situation Sie hier sitzen und es so annehmen wie es ist -, deshalb spielen wir nach dem C-moll-Satz in diesem wunderschönen Raum, der – dieser Zugabe angemessen – so groß und schön klingt, ein letztes Schubert-Lied: „Du bist die Ruh“.
Und so geschah es. Dieses Streichquartett versteht es wirklich, und gewiss in jedem Saal, ein Schubertlied, ohne jeden Espressivo-Druck, auf unvorstellbar eindringliche Art zu singen. So dass es keines Textes mehr bedarf.
Du bist die Ruh, Der Friede mild, Die Sehnsucht du, Und was sie stillt. Ich weihe dir Voll Lust und Schmerz Zur Wohnung hier Mein Aug' und Herz. Kehr' ein bei mir, Und schließe du Still hinter dir Die Pforten zu. Treib andern Schmerz Aus dieser Brust. Voll sey dies Herz Von deiner Lust. Dies Augenzelt Von deinem Glanz Allein erhellt, O füll' es ganz.
Dank an den Kammermusik-Freund Hanns-Heinz für Überlassung der Abonnementskarte!!!
Ein Denkmal auch dem Singdrosselherrn, der mich von der Gartenseite her bei geöffnetem Fenster während der Schreibarbeit begleitet; hier sein Stellvertreter: