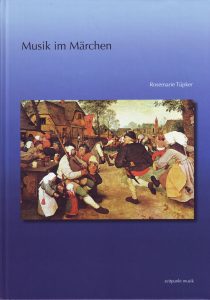Preisverleihung Samstag 26. Oktober 2016
Laudatio
zur Verleihung des „Wildweibchenpreises“ an Frau Prof. Dr. Rosemarie Tüpker am 26. Oktober 2019 in Reichelsheim (Odenwald)
von Jan Reichow
Wildweibchenpreis – ich glaube, das ist hier ein Begriff, schließlich wurde der Preis 24 Jahre hintereinander immer wieder verliehen, wobei einstweilen noch die Zahl der männlichen Preisträger überwiegt. Aber ich glaube, wenn die heute Geehrte, Frau Prof. Dr. Rosemarie Tüpker, im Münsterland davon erzählt hat, wird es ihr nicht anders ergangen sein als mir im Bergischen Land, – mit dem Wort „Wildweibchen“ zaubert man ein süffisantes Lächeln in die Gesichter. Da ist es wichtig, die Geschichte von der Felsformation bei Laudenau erzählen zu können, und dass diese an zwei Weiblein erinnert, die dort in einer Höhle gelebt haben sollen. Wahrscheinlich als gute Hexen, die von den Bauern Lebensmittel erhielten, wofür sie sich mit nützlichen Kräutern revanchierten. Und einen guten Spruch hatten sie drauf, der wörtlich überliefert ist, ein Rätselspruch, wie der der Sphinx: „Wenn die Bauern wüssten, zu was die wilden weißen Haiden und die wilden weißen Selben gut sind, dann könnten sie mit silbernen Karsten hacken.“ Also: mit kostbarsten Arbeitsgeräten. Das heißt: sie wären reich geworden. Offenbar hatten sie aber keine Ahnung von den pharmazeutischen Wirkungen der „weißen Haiden“ (Haide mit ai!) und der „weißen Selben“, denn ihre Arbeitsgeräte wurden nie versilbert; und erst in neuerer Zeit motorisiert. Und ich habe gerade erst gelernt, dass mit den weißen Selben wohl der Salbei gemeint war, während ich das Geheimnis der weißen Haiden auch mit Internet-Hilfe nicht habe lösen können. Ich wünschte, es hätte etwas mit Musik zu tun gehabt, man hätte die Rätselgeschichte ja mit der Loreley oder den Sirenen des Odysseus verbinden können. Diese schöne Landschaft hat ja längst einen Anfang gemacht, indem sie den Vers hervorbrachte: „In Laudenau da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau …“, das schreit doch nach Musik, und was den Text angeht, könnte die Märchensammlerin Rosemarie Tüpker dem Odenwälder Volksvermögen mit einigen Motiven aus ihrem Fundus noch ordentlich auf die Sprünge helfen. –
Meine Damen und Herren, dies sollte eine Laudatio sein, aber ich muss gestehen, dass ich Frau Tüpker gar nicht persönlich kannte, auch nicht der Generation ihrer Lehrer angehöre und noch weniger der ihrer Schüler. Ich kann also nicht sozusagen aus dem Hörsaal in Münster berichten oder vom gemeinsamen Studium in Köln, denn als sie dort nach ihrem Abitur begann, hatte ich mein drittes Studium abgeschlossen und war beim WDR Köln gelandet. Trotzdem kann ich nicht umhin, mich ein bisschen einzubeziehen, und das ist vielleicht schon ein therapeutischer Effekt.
Ich bin tatsächlich erst durch das wunderbare Buch „Musik im Märchen“ im Jahre 2011 aktiviert worden, da stand Frau Tüpker längst im Zenith ihrer Laufbahn als Wissenschaftlerin und Therapeutin. Und ich war nach 30 Jahren Rundfunkarbeit pensioniert, las viel und machte Musik, auch noch Musiksendungen, sobald ich auf interessante Themen stieß. Was mich begeisterte, als ich dieses Buch in die Finger bekam, war die merkwürdige Mischung aus Ästhetik und Tiefenpsychologie; das kannte ich nur von Sigmund Freud, bezogen auf den Moses von Michelangelo, dort aber ohne Verbindung zur Musik. Rosemarie Tüpker war die erste, die Musik so radikal einbezog in ihre therapeutische und wissenschaftliche Lebensplanung. Dies ist also eine Rede über das, was ich ihr verdanke.
Mich beeindruckte da – neben dem ernsthaften Deutungsansatz – vor allem der neue Ton, den sie in den Roma-Märchen herausarbeitete: in den frühen Sammlungen hieß das natürlich noch Zigeunermärchen, und eins der schönsten steht ziemlich am Anfang und geht mich besonders an: das Märchen von der Erschaffung der Geige. Was hätte das für mich bedeutet, als ich mit sechs oder sieben Jahren eine Viertelgeige bekam, die ich liebte, weil sie so glänzte; ich wollte sie mit keinem Tanzgeiger in Verbindung bringen, „der Jude im Dorn“ – das war eins, das ich kannte, aber ein Märchen zum Fürchten. Das Wort „antisemitisch“ gab es noch nicht oder es wurde umgangen. Später bekam ich eine ganze Geige, die ziemlich geschwärzt war, damit sie älter aussah; meine Eltern hatten sie, wie es hieß, bei einem Zigeuner gekauft, der auch selber fabelhaft drauf spielen konnte. Und das beflügelte mich. Kaum auszudenken, was aus mir geworden wäre, wenn ich da schon das Märchen gekannt hätte, das ich bei Rosemarie Tüpker gelesen habe: Von einem Jüngling, der so vermessen war, nach der Königstochter zu verlangen und deshalb in den Kerker geworfen wurde. Aber dann heißt es:
Kaum daß sie die Tür zugesperrt hatten, da wurde es hell und die Feenkönigin Matuya erschien, die den Armen in Bedrängnis hilfreich zur Seite steht. Sie sprach zum Jüngling: „Sei nicht traurig! Du sollst auch die Königstochter heiraten! Hier hast du eine kleine Kiste und ein Stäbchen! Reiß mir die Haare von meinem Kopf und spanne sie über die Kiste und das Stäbchen!“ Der Jüngling tat also, wie ihm die Matuya gesagt hatte.
Als er fertig war, sprach sie: „ Streich mit dem Stäbchen über die Haare der Kiste!“ Der Jüngling tat es. Hierauf sprach die Matuya: „Diese Kiste soll eine Geige werden und die Menschen froh oder traurig machen, je nachdem, wie du es willst.“ Hierauf nahm sie die Kiste und lachte hinein, dann begann sie zu weinen und ließ ihre Tränen in die Kiste fallen. Sie sprach nun zum Jüngling: „Streich nun über die Haare der Kiste!“
Der Jüngling tat es, und da strömten aus der Kiste Lieder, die das Herz bald traurig, bald fröhlich stimmten. Als die Matuya verschwand, rief der Jüngling den Knechten zu und ließ sich zum König führen. Er sprach zu ihm: „Nun also höre und sieh, was ich gemacht habe!“ Hierauf begann er zu spielen, und der König war außer sich vor Freude. Er gab dem Jüngling seine schöne Tochter zur Frau, und nun lebten sie alle in Glück und Freude. So kam die Geige auf die Welt.
Meine Damen und Herren, in diesem Sinne darf es ablaufen, wie wir’s in Märchen gerne hören, Königstochter inclusive; anders als im wirklichen Leben. Auch anders als im Leben der Sinti und Roma, aber wenn es in deren Märchen dann noch einmal ganz anders zugeht, sind wir befremdet, und Rosemarie Tüpker ist in ihrem Element. Mir fällt dabei ein, dass meine erste kleine Geige durchaus nicht der Freudenbringer war, sie glänzte zwar schön, aber was tat ich? Ich schaute durch die f-Löcher ins Innere und war erschüttert: alles hohl, nichts von dem, was ich z.B. gesehen hatte, wenn ich von hinten ins Innere eines Radios schaute, dies imponierende Gewimmel von Drähten, Spulen und Röhren, nichts davon, nur der Hohlraum. Als ich nun in Rosemarie Tüpkers großem Buch über Musik im Märchen zu einem ausgewachsenen Zigeunermärchen kam, da schlug das allem ins Gesicht, was ich von einem Märchen erwartete: es handelt zwar auch von einer Prinzessin und von einem Rom-Jungen, der nicht nur schmutzig genannt wird, sondern „rotzig“. Allerdings spielte er ausgezeichnet Geige und hatte die Gabe, dass er einen Menschen nur anschauen musste um zu wissen, welches sein Lieblingslied sei. Er gewinnt die Prinzessin, die bekommt bald ein Kind, und dieses hat nichts anderes im Sinn, als erstmal seinen eigenen Vater zu erschlagen, und das Märchen hat mehr unerwartete Wendungen, als ich sie mir einst im Innern meiner Geige erhofft hatte. Ich muss Ihnen daraus etwas vorlesen, damit Sie mein Befremden verstehen. Der Junge will mehr Kraft als sein Vater haben und geht deshalb auf die Suche nach zwei Schwestern, das sind Hexen, – wir treffen tatsächlich auch hier auf die ominösen Wildweibchen -, eine von den beiden hat sogar einen Sohn, der von Beruf Apotheker ist. Das kann zweifellos nützlich sein, wenn man seinen Vater loswerden will. Ich lese also einen winzigen Ausschnitt aus dem 7 Seiten langen Text:
Und der Kleine ging zu der zweiten Schwester. Aber da verwandelte sich die erste Hexe in ein Mädchen und lief ihm nach. In ein sagen wir – sechzehnjähriges , zwanzigjähriges Mädchen, sehr schön, nur im Bikini, in einem ganz kleinen Badeanzügchen, und sie tanzte um ihn herum: „Janku, Janku, dreh dich um, bin ich schön?“
„Lass mich in Ruhe. Ich bin ein neugeborenes Kindchen.“
„Schau mich an, wie schön ich bin, wie nackt ich bin! Mach keine Ausreden. Komm zu mir!“
Aber er ging weiter. Er war doch noch zu jung für solche Sachen. Das nächste Mal sprang sie zu ihm und wiederholte ihre Worte, aber er gab ihr eine solche Ohrfeige, dass sie zu Wagenschmiere wurde.
Der Kleine wusste genau, dass das die Hexe war. Er lief schnell zurück in ihre Hütte. Dort sah er einen Säbel, der von selbst tanzte und herumsprang und wie der Vollmond glitzerte. Er nahm den Säbel: „Jetzt kann ich die ganze Welt umbringen“. Da holte ihn schon sein Vater ein [und] versetzte ihm so einen Fußtritt in den Arsch, dass er bis nach Hause flog, direkt der Mutter in die Arme.
Viele irritierende Momente, von Anfang bis Ende, kein Fall für die Brüder Grimm, hier gab es keine ordnende Hand, und das macht diese Märchen so verwirrend und so zeitnah, ja: modern. Auch hier wird am Ende vielleicht alles gut, aber für eine stubenreine, pädagogisch einwandfreie Begriffswelt nicht befriedigend. Und Rosemarie Tüpker kennt diese Wirkung, sie schreibt:
Die anfänglich eindeutige emotionale Zuordnung gerät bei der intensivierten Beschäftigung immer wieder ins Wanken, kippt in ihr Gegenteil. Dies wird als eine ziemliche Zumutung erlebt, insbesondere weil man dies von einem Märchen nicht erwartet. (Seite 120)
Sie kennt das also, sie durchschaut es! Und arbeitet gerade dieses Umkippen heraus, diese Ambivalenzen, sieht aber obendrein noch die Gefahr, dass in der psychoanalytischen Behandlung der Märchen „die emotionale Heftigkeit verloren zu gehen“ scheint, die in diesen Märchen steckt. Um so wichtiger ist ihr, dass der in der studentischen Gruppenarbeit festgestellte Widerstand selbst thematisiert wird. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, man bekomme eine richtige Wut auf den Text, [habe] keine Lust, sich weiter damit zu beschäftigen. Und die Abneigung richte sich gegen die Grausamkeit und die grobe Sexualität, manches sei einfach widerlich, eklig, pervers, empörend oder einfach lächerlich. Und am Ende erwähnt die Professorin, dass in einer – an sich doch interessierten – Studentengruppe, in der das Märchen vorgelesen worden war, niemand die angebotene Kopie des Textes haben wollte, was sehr ungewöhnlich sei.
Meine Damen und Herren, ich kann hier nicht in aller Kürze zusammenfassen, wie die Strukturen und der Sinn des Märchens analysiert werden, und wie wir eingetaucht werden „in die Ebene des Primärprozesshaften, in dem es noch kein (erlösendes) Nacheinander, kein Maß und keine ausreichenden Regulierungen gibt.“ (Seite 122f) Und ich darf hinzufügen: noch keine Pädagogik des empathischen Verstehens, bei der sich letztlich alles in Wohlgefallen auflösen muss.
Und es ist genau das, was mich an dieser neuen Märchenkunde begeistert hat. Zu erleben, (ZITAT) „welch archaischen Bildwelten wir im Bereich der Märchen begegnen, wenn wir den Kreis dessen verlassen, was wir durch die bearbeiteten Fassungen der Brüder Grimm oder Bechstein gewohnt sind.“ (Seite 241)
Denken wir etwa an den Grimmschen Froschkönig, an die „alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat“, mit einem tiefen Wald, darin der König und die drei Töchter, die alle schön sind, „und die jüngste war so schön, dass sogar die Sonne, die doch schon so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.“
Das klingt verlockend genug, aber wenn wir mutig sind, lassen wir uns auch auf die etwas anderen Märchen ein, die Frau Tüpker präsentiert, zum Beispiel auf das von ihr interpretierte griechische Märchen: mir liegt es am Herzen, weil die Geige darin eine Schlüsselrolle spielt, – oder spielen könnte -, aber der böse Verlauf deutet sich schon in den ersten Zeilen an:
Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten drei Söhne, und nachdem diese bereits herangewachsen, gebar die Königin auch ein Mädchen; das war aber nicht wie andere Kinder, sondern verwandelte sich jeden Abend in eine bösartige Hexe, ging dann in den Marstall des Königs und erdrosselte dort ein Pferd, und am andern Morgen fand man es tot in seinem Stall liegen. Usw. usw., es tut mir leid, dass ich ans Ende springen muss, ohne bei der Stelle zu verweilen, wo der Bruder alias „Prinz“ die lebensgefährliche Schwester nach langer Suche in einem Gemach findet, wo sie dasitzt und – Geige spielt. Und sie hat offenbar viel Zeit dafür, denn sie hat alles Lebendige, was existierte, aufgefressen; abgesehen wohl von wenigen Pferden und einer Maus, die übrigens auch Geige spielen kann. Und nun soll der ebenfalls geigerisch begabte Jüngling dran glauben. Aber es endet folgendermaßen:
Am andern Morgen wartete er so lange, bis sie ihre Mahlzeit gehalten und dabei, wie sie gewohnt war, ein ganzes Pferd aufgefressen hatte, und [er] trat dann vor sie. Kaum erblickte sie ihn aber, so stürzte sie sich wütend auf ihn und sie rangen lange miteinander, bis er sie endlich erschlug, – man glaubt es kaum, das Märchen ist gleich zuende, da folgen nur noch die Worte: und der Prinz lebte von nun an allein.
Für mich ist das keine Enttäuschung: denn da er auch Geige spielen kann, wird er sich ja niemals langweilen, wenn er z.B. die Bach-Partiten zur Hand hat. Rosemarie Tüpker hat im Vergleich mit anderen Märchen ausgemacht, dass die Musik, wo auch immer sie auftaucht, jeweils einen eigenen seelischen Raum aufschließt, und ich bestätige das eben privat für J.S.Bach, viele Irish Fiddle Tunes, oder auch die Weisen auf der Schlüsselfiedel, die wir hier gehört haben – einen seelischen Raum, der sich deutlich von den existenziellen Lebensnotwendigkeiten abhebt (Seite 243), ohne dass dies expressis verbis herausgestellt werden muss. So auch in einem englischen Märchen, wo die Schalmei eines Hirtenknaben eine zauberische Funktion innehatte – sie klang wie das Lied eines Vögleins im fernen Walde –, diese Musik erzeugt Gefühle und steigert sie, und nebenbei vermag sie alte Kleiderlumpen in kostbare Gewänder zu verwandeln. Daraus folgt aber durchaus nicht, dass der dienstbare Hirte einen Anspruch auf das Mädchen erhebt, Musik ist nur der Katalysator, und als der Prinz schließlich das niedere Mägdlein unter Trompetenklängen zur Gemahlin nahm – da konnte sich der Hirte am Ende buchstäblich in Wohlgefallen auflösen. Er tut es, und da heißt es nur: er war verschwunden, und niemand weiß, was aus ihm geworden ist. (Seite 245)
Im Fall des Zigeunermärchens vorhin gab es ebenfalls ein (für uns!) ungewöhnliches Ende: Nicht etwa im Glanz des Königshofes wie hier, sondern in einer Roma-Hütte aus Lehm und Holz, genau dort lebten sie glücklich bis heute. Und er spielte immer in der Weinstube. (Seite 106) – – – Aus der Sicht meiner vorlesenden Oma gewiss ein Wermuthstropfen am Ende der Geschichte. Sie hätte ihn sicher lieber als Clou der Geschichte im bürgerlichen Wohnzimmer gesehen.
Ebenso die Quintessenz aus all den vorhin angedeuteten seltsamen Begebenheiten vom Kampf des Sohnes gegen den Vater, sie würde lauten:
„dass die Macht der Musik die Zerstörungswut des Heldentums besiegt, die ewige Dichotomie [Spaltung] von Bindendem und Trennendem, Struktur und Auflösung, Tod und Wiedergeburt.“ Was nicht heißt, so Rosemarie Tüpker, dass die Ebene der einfachen Geschichte aufgehoben wäre, für unwirksam oder ungültig erklärt würde. „Vielmehr können wir davon ausgehen, dass die heftigen oder schwer auszuhaltenden Affekte, die sich bei dieser intensiveren Auseinandersetzung einstellen, in der Geschichte aufgehoben sind. Das ist die Kunst der Erzählung: Schwierige Themen so einzubinden, dass wir die Auseinandersetzung mit ihnen nicht allzu sehr scheuen.“
Ein wunderbares Fazit.
Meine Damen und Herren, es wäre des Erzählens und des Lobens kein Ende. Aber eine echte Laudatio hat auch mit dem Lebenslauf, nein, mit dem Geduldsfaden eines Lebenswerkes zu tun. Ich frage einfach: wie kommt man zu diesem Lebensthema? – und das hätte sich die heute Geehrte sicher damals als Abiturientin ebenfalls gefragt. Denn sie hatte nichts anderes im Sinn als den ganzen Tag Musik zu machen, sie begann also an der Kölner Musikhochschule Klavier und Schlagzeug zu studieren. Zugleich schien ihr nichts faszinierender, als die Geheimnisse der musikalischen Sprache und ihrer Wirkungszusammenhänge zu ergründen, wobei in Köln eine lebendige Szene der Neuen Musik vielfältige Anregungen bot. Zugleich entdeckte die Musikstudentin im benachbarten Bonn eine Psychologie, die zu den spannenden Fragen des Seelischen und der Kreativität führten. Auf diesem Weg hoffte sie ihre verschiedenen Interessen zu einer Synthese zu bringen, und sie erlebte tatsächlich einen entsprechenden Glücksfall im Psychologischen Institut von Wilhelm Salber, wiederum in Köln: nämlich „eine Psychologie, die etwas von Kunst verstand“. Obendrein die Verbindung zur System[at]ischen Musikwissenschaft in Gestalt von Prof. Jobst Peter Fricke, der für musiktherapeutische Interessen ein offenes Ohr hatte. Ein zweijähriger Mentorenkurs für Musiktherapie in Herdecke wurde möglich und all dies führte 1987 zum Abschluss einer Dissertation über die morphologische Grundlegung der Musiktherapie, eine Form der Musiktherapie, die mithilfe einer tiefenpsychologischen und kunstanalogen Sichtweise auf seelische Prozesse einwirkt. In den folgenden Jahrzehnten erweiterte Rosemarie Tüpker diese Arbeit, sie wurde an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster berufen, seit 2005 war sie als Professorin tätig in Forschung und Lehre, darüberhinaus in der klinischen Musiktherapie. 2011 erschien ihr grundlegendes Buch über Musik im Märchen, das auch weit über die verschiedenen Fachbereiche hinaus Beachtung fand. So hat es auch mich elektrisiert und so kam ich zu einer Präsentation beim Klassiksender SWR2 (Musik aktuell). Ich erinnerte mich bei dieser Arbeit, dass zu meiner Studienzeit in der pädagogischen Literatur plötzlich Titel auftauchten wie dieser: „Böses kommt aus Kinderbüchern“, das ging vorrangig gegen den Struwwelpeter, aber damals sollte ja gerade die ganze Pädagogik neu erfunden werden. Einige Jahre später kam eine Rückwendung mit Bruno Bettelheims Entdeckung „Kinder brauchen Märchen“, und das war wie eine Erlösung. Da hatte Rosemarie Tüpker längst begonnen, das weite Feld zu erkunden, das in uns allen verborgen ist und von den Märchen aller Völker mit Leben erfüllt wird. Es geht uns an, ob wir uns nun erwachsen fühlen oder Kind geblieben sind: ein phantastisches Feld der morphologischen Verwandlungen, derselben narrativen Wendungen, die wir in anderer Gestalt aus der Musik kennen, mit ihr einüben.
Es ist eine fabelhafte Idee, solch eine nicht nur kindgemäße, sondern weit darüber hinaus menschenfreundliche Art der Forschung mit dem Wildweibchenpreis auszuzeichnen.
Ich gratuliere Frau Prof. Dr. Rosemarie Tüpker zu diesem Preis – und Ihnen hier in Reichelsheim zur Wahl gerade dieser Preisträgerin.
Alle Seitenangaben beziehen sich auf das Buch von Rosemarie Tüpker „Musik im Märchen“ zeitpunkt musik Reichert Verlag Wiesbaden 2011