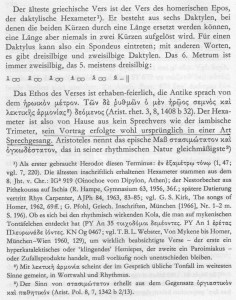Von Klang und Rhythmus
Selten hört man gut gesprochene Lyrik. Auch nicht von prominenten Schauspielerinnen oder Schauspielern, gerade von ihnen nicht. Diese Form der Sprache und des Sprechens kommt offenbar als Ausbildungsfach nicht vor. Sprechen? Es ist doch typisch, dass angesichts dieses Themas zuerst das Wort „hören“ auftauchte („Selten hört man gut gesprochene Lyrik“), nicht das Wort „sprechen“. In Bantels Lexikon „Grundbegriffe der Literatur“ (1962) lese ich: „die eigentliche lyrische Haltung … ist das liedhafte Sprechen“ (nach W.Kayser). Wie aber verwandeln sich Worte in Musik und Rhythmus? Indem ich sie als solches höre, – auch wenn das Gegenüber nicht erfreut ist, sagt schon mal jemand: ich höre deine Worte wie Musik. Sie mögen als bloßer Inhalt gemeint sein, in den Ohren der Liebe wird daraus Musik. Sie sind mit einem besonderen Fühlen verbunden, einem Fühlen, das Außen und Innen verbindet.
Manchmal findet man den lapidaren Satz: „Lyrik verlangt den Sprachklang, muß also laut gelesen werden“, so in meinem alten Schulbuch „Griechische Lyrik“ (Rudolf Beutler 1952), aber habe ich das je in einer deutschen Gedichtsammlung gefunden? Gewiss, Lautmalereien, Klangspielereien wurden in der Analyse erwähnt, aber sprach man darüber, wie es klingen muss, wenn man die Verse spricht, über den Tonfall, – der allerdings ebensoviel mit Sinn wie mit Melodie zu tun hat?
Wolfgang Kayser sagt in seinen Vorlesungen zur Geschichte des deutschen Verses (1960):
Sicher ist in den Jahrhunderten seit der Erfindung der Buchdruckerkunst und wohl besonders durch die allgemeine Schulpflicht unser Ohr zugunsten des Auges vernachlässigt worden. Andere Jahrhunderte und andere Kulturformen verfügten über ein ungleich feineres und geschulteres Gehör, als wir es heute besitzen. Nur so ist es zu erklären, daß in Rom die Plebs, also das literarische ungeschulte Volk, bei einem fehlerhaften Vers zu pfeifen begann; ich habe es in Portugal, wo ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht lesen und schreiben kann, selber erlebt, wie sich unter dem Volk Unbehagen ausbreitete, wenn beim Rezitieren siebensilbiger Verse eine Unregelmäßigkeit unterlief. Wer bei uns hört noch etwa inmitten des Blankverses sechshebige Zeilen, wie sie etwa bei Grillparzer vorkommen? Sicher ist unser Gehör, seitdem wir lesen können, für den rein akustischen reiz der Dichtung stumpfer geworden. Es steht dahin, ob wir diese Tatsache mit dem üblichen Hinweis, daß früher alles besser war, bedauern sollen. Es ist möglich, daß gewisse Vorgänge in der Versgeschichte mit dem Gehörverlust in Zusammenhang stehen. So scheint es, als ob die Zeile an Bedeutungsschwere eingebüßt hätte, ja als ob auch eine Tendenz bestünde, die Bedeutung der Strophe zu mindern, eine Bewegung, die wir etwa seit der Romantik, wie wir sehen werden, verfolgen können. (…)
Aber unsere akustisch beschränktere Aufnahmefähigkeit für Dichtung hat wohl noch einen anderen Grund: das Auswendiglernen, ein Prozeß, durch den das Gelesene ja auf die Ebene des gesprochenen Wortes gehoben wird, ist so gut wie ganz aus der Übung gekommen. Noch die vorige, also meine Generation, konnte eine Fülle von Gedichten ihrer Lieblingsschriftsteller: Rilke, George, Hofmannsthal auswendig. Die heutigen Studenten setzen mich immer wieder durch den Mangel an auswendig Gewußtem (par coeur, also vermittels des Herzens Gewußtem, wie der Franzose sagt) in Erstaunen.
Quelle Wolfgang Kayser: Geschichte des deutschen Verses / Zehn Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten / Francke Verlag Bern und München 1960 (Seite 12 f)
Wenn wir intuitiv zu wissen glauben, wie ein Gedichtvortrag klingen sollte, muss es uns eigentlich erstaunen, dass der offenbar völlig andere Vortrag eines antiken Gedichtes nicht mehr Aufmerksamkeit erregt hat und intensiver diskutiert wurde; meist genügte – auch in der Fachliteratur – der Hinweis, dass es sich um quantitierende Metrik handelt. Kein Wort darüber, dass selbst die im Alltag gesprochene Sprache der alten Griechen quantitierend ablief, die absolute Länge oder Kürze der Silben lag nicht im Ermessen der Sprecher. Und die Akzente, die man heute in den griechischen Wörtern sieht und als „Akzente“ auffasst, bedeuteten lediglich Tonhöhen-Unterschiede! Sicherlich keine willkürlichen, sondern etwa eine Quinte…
Hat man es gewusst? Hat man darüber gestaunt? Hat man je in Betracht gezogen, dass ein ganz anderes Denken und Fühlen dahinterstecken muss?
Hat man wahrgenommen, dass ein Buch wie „Musik und Rhythmus bei den Griechen“ von Georgiades eine Revolution bedeuten musste? Man kann es nicht beiläufig zitieren, wie dieser Fachmann altgriechischer Metrik. Er w u n d e r t sich nicht, er tut so, als sei die Sprach-Musik im Alltag eine alltägliche Geschichte:
Die griechische Dichtung ist q u a n t i t i e r e n d, sie beruht auf dem geregelten Wechsel langer und kurzer Silben im Gegensatz zur byzantinischen und modernen Dichtung, die akzentuierend ist, d.h. einen dynamischen, expiratorischen Iktus hat. Auch der bei Marsch- und Arbeitsliedern hinzutretende Rhythmus gibt dem griechischen Wort keinen dynamischen Akzent; das Fehlen des Iktus ist eine linguistische Erscheinung, die nicht durch Tanzen, Marschieren, Dreschen, Mahlen, Schmieden u.ä. während des Singens aufgehoben werden kann. Die Akzente bezeichnen musikalische Tonhöhen (Barytonese, Oxytonese), durch die gerade ein Sprechtonfall (Iktus) ausgeschaltet wird. Der Rhythmus der griechischen Sprache ist also zugleich sprachlicher und musikalischer Natur.
Quelle Dietmar Korzeniewski: Griechische Metrik / Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1968
Und genau anschließend an diesen Satz findet man die Anmerkung mit der Nennung des Georgiades-Buches, aber auch zweier winziger Artikel, worin sich zeigen mag, dass die Wissenschaft längst informiert ist, aber niemand sich wundert und der Erwähnung wert findet, dass hier ein riesiges Potential an Erkenntnis zu erschließen wäre.
Nur noch ein einziger Hinweis zum musikalischen Anteil findet sich im Kapitel zum Hexameter:
Der Hexameter ist also von Haus aus kein Sprechvers wie der iambische Trimeter, sein Vortrag erfolgte wohl ursprünglich in einer Art Sprechgesang.
Es ist diese merkwürdige Erfahrung, die dem Musikethnologen geläufig ist: unter allen Kulturäußerungen anderer Völker werden die musikalischen am wenigsten wichtig genommen. Weil die Ohren dafür nicht ausgebildet sind. Und was man nicht aufschreiben kann, ist nicht recht vorhanden. – Man könnte einwenden: niemand von uns hat Homer sein Epos vortragen hören. Gut, aber haben Sie sich schon mal Zeit genommen, einem Epensänger aus Japan oder aus Niger zu lauschen? (Das ist nicht das gleiche, natürlich nicht, aber – unser Interesse könnte das gleiche sein.)
Es entstehen viele Fragen, auf die Georgiades eingeht: wann die griechische Sprache etwa ihren quantitierenden Charakter verloren hat, wie sich diese Einheit von Rhythmus, Musik und Sprache (musikē) auflösen konnte, – was geschah geistesgeschichtlich, bewusstseins-geschichtlich? Ich zitiere etwas wahllos:
Es scheint, daß Ansätze zu einer Wandlung ziemlich früh vorhanden sind: Gegen Ende des 5. Jahrhunderts v.Chr., also noch in der Blüte der klassischen Zeit, findet man gewisse Anzeichen, die man dahingehend deuten muß. Um diese Zeit entstand der ’neue Dithyrambos‘, dessen Neuerungen die konservativ Eingestellten sehr beunruhigten. Man warf PHRYNIS und TIMOTHEOS vor, daß darin die musikalische Komponente zu selbständig sei, daß sie eigene Wege gehe. Hier also begann wohl eine Trennung zwischen ‚Dichten‘ und ‚Komponieren‘. Sie zeigten sich wahrscheinlich am deutlichsten in der Rhythmik: Bis dahin hatte allein die Sprache den Rhythmus bestimmt. Das Verhältnis der langen zu den kurzen Silben war in der Sprache gegeben. Jetzt begann man, die Silben freier zu behandeln. (…)
Die Sprache verlor ihre rhythmisch-körperhafte Festigkeit. Die Wörter verloren ihren Eigenwillen. Sie leisteten keinen festen Widerstand mehr. Sie bekamen etwas Schattenhaftes. Sie ließen sich nicht nur neinem selbständigen musikalischen Rhythmus, sondern auch dem Willen des Subjekts anpassen. Sie wurden willige, geschmeidige Instrumente im Dienste des Sprechenden. Eine neue Art des Sprechens bahnte sich an: das, was wir heute unter ‚Sprechen‘ verstehen, ein Sprechton, der dem Bedeutungszusammenhang dient und darüber hinaus auch eine in jeder Hinsicht subjektive Färbung annehmen kann (…). (Seite 49 f)
Der antike, der Musikē innewohnende Rhythmus scheint aber so tief in der Seele jener Menschen verwurzelt gewesen zu sein, daß er für sich weiterzuleben vermochte, selbst nachdem die Einheit, die Musikē, sich aufgelöst hatte. Als der altgriechische feste Leib der Sprache, der Musikē, zusammenschrumpfte und sich in die abendländische Sprache verwandelte, hinterließ er die Hülle, die nunmehr ein Eigenleben zu führen begann, als ‚Musik‘ und als rein musikalische, von der Sprache unabhängige Rhythmik. (Seite 53)
(Fortsetzung folgt)
Ach, noch leben die Sänger; nur fehlen die Taten, die Lyra
Freudig zu wecken, es fehlt, ach! ein empfangendes Ohr.
(Friedrich Schiller)