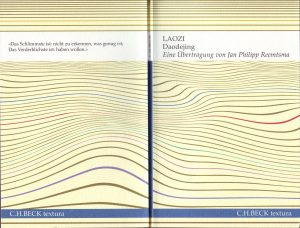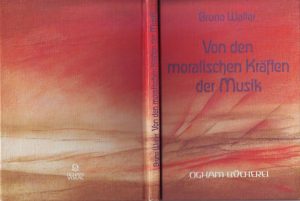Wieder einmal zu Bach
Es ist mir völlig egal, ob es zu früh in der Ohligser Innenstadt oder in Düsseldorfer Geschäftszentren weihnachtet. Es ist nie zu früh, sich darüber aufzuregen, und ich hätte mir auch eine neue Johannespassion gekauft. Man muss nichts Neues haben, weil es neu ist, und auch nicht für immer das Alte behalten, weil es sich nun mal bewährt hat (RIAS-Kammerchor unter René Jacobs 1997, Windsbacher 2000, The Sixteen Choir, auch „wir“ mit den Tölzern vor 44 Jahren und bis in die 90er auf allerhand Tourneen). In diesem Fall genügte ein winziges Motiv, das C und das y in dem Wort Gächinger Cantorey, oder war’s nur die Mitwirkung der Sängerin Anna Lucia Richter? Ich hätte es gar nicht gemerkt, ohne mir die Stellen vorzumerken. Bei der Aria „Schlafe mein Liebster“ habe ich allerdings ins Booklet geschaut, um mir den Namen der Altistin einzuprägen.
Ich finde es toll, dass im Booklet daran erinnert wird, wie es Bach selbst mit der Vorbereitung des Publikums („Hörerinnen und Hörer“) auf seine Musik hielt:
Damit den Leipzigern 1734/35 der gesungene Wortlaut zur persönlichen Vorbereitung zum Mitlesen in den Gottesdiensten sowie zum betrachtenden Nachlesen zur Verfügung stand, hatte Bach ein Textheft rechtzeitig in Druck gegeben und in Umlauf gesetzt. Dies war auch deshalb wichtig, weil sich die Liturgische Aufführungspraxis ja vom 25. Dezember bis zum 6. Januar erstreckt hat. Vermutlich hoffte Bach, dass zumindest einige Hörerinnen und Hörer den gesamten sinnlich-sinnvollen Spannungsbogen erfasst hatten, wenn er am 6. Januar 1735 das Gesamtwerk mit eben jener Choralmelodie schloss, die bereits am 25. Dezember als erste Liedstrophe erklungen war.
Ich stehe auf gründliche Vorbereitung, wenn ein gutes Konzert winkt, auch wenn ich damit nicht fertig werde, wir kürzlich beim Debussy, und eine gründliche Nachbereitung und Fortführung wesentlich wäre. Zumindest weiß ich gleichzeitig, dass Benjamin Britten keinen ähnlichen Druck oder Eindruck hinterlassen hat. Vielleicht mein Fehler.
Im ersten Teil hören wir den überaus vokal empfundenen, zudem adventlich-erwartungsvollen vierstimmigen Bachchoral Wie soll ich dich empfangen?, am Ende dann ein orchestrales Finale mitsamt Trompeten-Feuerwerk, in welches dieselbe phrygische Melodie, jetzt auf die Worte „Nun seid ihr wohl gerochen an eurer Feinde Schar“ und in triumphierende Dur-Harmonien gekleidet, zeilenweise „eingebaut“ ist.
Textautor: ©Meinrad Walter (für Carus CD 83.311) – Siehe dazu auch das MGG-Zitat am Ende des Blogartikels hier.
Und wenn ich bedenke, dass ich schon Mitte der 50er Jahre in Bielefeld das Werk mitgespielt habe (in Bethel und Jöllenbeck!) und mich noch früher regelmäßig im Gemeindehaus mit einem Freund traf, Sohn des Küsters, um die dort vorhandene Gesamtaufnahme aus der Archiv-Reihe mit Silber-Etiketten aufzulegen. Dass aber nicht viel später der kleine Laotse-Band in meine Hände kam und mir (ohne tieferen Grund bzw. ohne Musik) ähnlich viel bedeutete. Und nun wieder. Das kann kein Zufall sein. Ist es natürlich auch nicht…
Ich liebe die Umschlaggestaltung. Sie ist von „Kunst oder Reklame “ , München. Ähnelt den Wänden der Elbphilharmonie, spielt aber offenbar an auf das berühmte Kapitel 78, das folgendermaßen anhebt:
Nichts auf der Welt
ist weicher und fügsamer als das Wasser,
und doch höhlt es den härtesten Stein.
Es kann das, weil es nicht hart ist.
So bei Jan Philipp Reemtsma. Er überschreibt den am Ende folgenden kleinen Essay „EIN PAAR BEMERKUNGEN HERNACH“, womit er wohl im Sinne das chinesischen Weisen etwas altertümelt, beginnt mit drei schönen Zitaten über das Mystische von David Hume, Søren Kiekegaard und Ludwig Wittgenstein, und dann folgt Bertold Brechts sehr bekannte „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“, 13 Strophen à 5 Zeilen. Zugleich relativiert er deren Bedeutung:
Peter Rühmkorf nannte das Gedicht einmal „unseres Fortschrittsphilistertums beliebteste Erbauungsballade“. Diese Spitze will ich hier nicht diskutieren, auch meinen Verdacht nicht, daß Brecht das Daodejing eher aus kursorischer Lektüre kannte – schließlich bezieht er sich nur auf das 78. Kapitel und macht den Versuch, es auf einen alltagssinnlichen Nenner zu bringen, was bei anderen Kapiteln schwerlich hätte gelingen können. Das Daodejing ist viel mehr, wovon gleich die Rede sein wird.
Es lohnt sich auch hier, mit neuem Impetus (nicht zu stark, nicht zu schwach?) zu lesen.
Das Schwache besiegt das Starke,
das Weiche besiegt das Harte.
Jeder weiß das.
Warum lebt keiner so?
Hat mit Moral-Predigt nichts zu tun. Mein damaliger Freund übrigens, von dem die Rede war, der Küsterssohn, spielte Trompete, jeden Samstagabend Choräle vom Turm der Bielefelder Pauluskirche, in alle vier Himmelsrichtungen, ich liebte dieses Wochenend-Signal. Und er hat bei unseren Hearings immer wieder die Bass-Arie (mit Solo-Trompete) aufgelegt: „Großer Herr, o starker König“. Gelegentlich bat ich ihn, wieder mit dem Anfangschor zu beginnen oder wenigstens mit dem Choral-Rezitativ: „Er ist auf Erden kommen arm.“ (Bei meiner Konfirmation war ich ein frommes Kind. Aber seit der Vorschulzeit in Greifswald bewahrte ich ein kleines japanisches Püppchen auf, übrigens bis heute.)
Sehr lesenswert übrigens im Booklettext auch der Abschnitt über Bachs „Parodie“-Verfahren, das natürlich mit Parodie nichts zu tun hat: die Wiederverwendung abgrundtief weltlicher Texte in heiligem Zusammenhang.
Was Bach anno 1734 nicht wissen konnte: bei der Wiederentdeckung seiner geistlichen Vokalmusik im 19. Jahrhundert fällt ein Schatten ausgerechnet auf das Weihnachtsoratorium. Zwei wichtige ästhetische Kritereen schienen damals fraglich im Blick auf dieses Werk. Vor allem aber kritisierte man die mangelnde Originalität! Bachs Übernahme fast aller Arien und großen Chöre aus weltlichen Glückwunschkantaten wie Blühet, ihr Linden in Sachsen wie Zedern – daraus wird mittels Umtextierung „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“, die festliche Rahmung von Teil III – schien mit dem Makel des Sekundären, jedenfalls nicht Originalen behaftet. Bach aber denkt anders. Er will besonders gelungenen Sätzen aus Werken mit einmaligem Aufführungsanlass einen dauerhaften Platz in seinem Œuvre zuweisen, also die Musik sozusagen „retten“. Und das gelingt im musicopoetischen Teamwork mit seinem Textdichter Picander so überzeugend, dass man gerne Details über die Zusammenarbeit erfahren würde. Darüber jedoch schweigen die Quellen.
Die […] „Echo-Arie“ stammt aus der sogenannten Herkules-Kantate zum elften Geburtstag des Kurprinzen Friedrich Christian von Sachsen. In Picanders weltlicher Dichtung singt Herkules: „Treues Echo dieser Orten, soll ich bei den Schmeichelworten süßer Leitung irrig sein. Gib mir doch die Antwort Nein!“. Und mit „Nein, nein!“ oder „Ja, ja!“ antwortet jeweils das Echo. Bach aber verändert bereits in der weltlichen Fassung ein Wort. Er intensiviert die Bitte des Herkules zu „Gib mir deine Antwort“. Damit eröffnet er die Möglichkeit, jeweils am Schluss des vokal-instrumentalen Spiels von Echo und Doppelecho kompositorisch aus dem Prinzip auszubrechen. Jetzt singt der zweite Sopransolist nicht mehr nur das nach, was ihm zuvor in den Mund gelegt wurde. Vielmehr beantwortet das Echo – nun in der geistlich-weihnachtlichen Fassung – die Bitte „Nein, du sagst ja selber …“ mit einem klaren „Nein!“ und „ja, du Heiland sprichst selbst …“ mit einem frei einsetzenden „Ja!“. Doch genau daran entzündete sich eine weitere Kritik an Bach. Sein großer Biograph Philipp Spitta nämlich tadelt, dass das Echo zweimal „unaufgefordert redet“. Die Stimme Christi wiederholt nicht nur bestätigend die menschliche Bitte. Sie antwortet vielmehr aus freien Stücken, und das benennt Bach nicht nur, er inszeniert es.
Textautor: ©Meinrad Walter im Booklet (für Carus CD 83.311)
Das sind interessante Aspekte. Ich habe es bei hundert Aufführungen nicht bemerkt, obwohl man als Geiger in dieser Arie nichts anderes zu tun hat als zuzuhören.
* * *
Letzte Nacht bin ich aufgewacht und habe ein Büchlein gelesen, das ich nie im Leben beachtet habe, erst jetzt, wo ich eigentlich eine andere Aufgabe vor mir herschiebe, die das Böse betrifft, das ja in allen Zeitungen mit Recht, aber auch bis zum Überdruss beschworen wird. Ich setze das (provozierende?) Cover hierher, um die halb bedrückte, halb polemische Stimmung der Nacht bei Gelegenheit wiederzuerwecken:
Bruno Walter (Seite 30f):
… im grenzenlosen Reich der Musik gibt es auch Bezirke des „Wilden“ und des „Interessanten“; diese stellt sie dem Bösen zur Verfügung. Es sind Grenzbezirke, die dem Triebhaften, beziehungsweise dem Verstandesmäßigen der menschlichen Natur entsprechen. Aber man höre die […] Pizarro-Musik im Fidelio neben Leonores und Florestans Gesängen und man wird die astronomische Distanz zwischen dem Gebiet der ersteren und den Sphären der letzteren, in denen die höchsten Kräfte der Musik walten, wahrnehmen. Wieviel weniger wirkliche Musik dem moralisch Tiefen gegeben ist, erhellt auch, wenn man sie sich ohne Worte vorstellt; die Musik der höheren Gefühle dagegen ergreift uns fast mit derselben Macht auch bei fortgelassenem Text: Man denke an die Arie „Erbarme dich“ aus der Matthäuspassion oder an Leonores „Komm Hoffnung“ in Fidelio. Was gibt Mozart dem Intriganten Bartolo zu singen und was der seelenvollen Gräfin, der liebenswürdigen Susanne?
Übrigens kann ich es nicht dabei bewenden lassen (siehe nächster Beitrag). Und mein Lob des Booklets relativiert sich etwas, wenn ich in die Schallplattenaufnahme der Harmonia Mundi von 1973 schaue und vor allem in das Vorwort dieses Klavierauszugs. Alfred Dürr schrieb es im Juni 1961.
Und den Lobpreis der neuen Aufnahme nehme ich etwas zurück. Schon der Anfangschor, – zwar ist das Tempo sehr, sehr schnell: aber reißt er mich „jauchzend und fohlockend“ vom Stuhl? Wo greift mich ein Accompagnato zum erstenmal ans Herz?