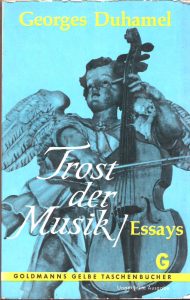Von den Grenzen menschlicher Phantasie
Die Skizze Beethovens zu einer Zehnten Symphonie, die nun mithilfe künstlicher Intelligenz zuende komponiert werden soll. Ein Fall für die Aktuelle Stunde? HIER.
Man möchte meinen, dieses Projekt könne nur ironisch behandelt werden. Aber weit gefehlt. Die Ahnungslosigkeit darüber, was eine Beethoven-Sinfonie ausmacht, ist ebenso allumfassend wie der Respekt vor der Macht Künstlicher Intelligenz.
Wir wissen, dass Beethovens ruheloser Geist immer wieder neue Wege einschlug. Nach der ersten Sinfonie in C und der zweiten in D hätte man also leicht darauf kommen können, dass eine dritte in Es oder E fällig war, aber auch, dass ein Dreiklangsthema wie in der ersten und zweiten auf jeden Fall verbindlich war. Warum nicht eins des göttlichen Kindes Mozart? Schon haben wir eine Sinfonie, die die Verdienste der beiden anderen vereint und übertrifft. Ja, und so die klassische Musikgeschichte krönt! Ein kleiner Webfehler: Diese Logik grenzt an Schwachsinn.
Es ist nicht zu fassen, was für ein Abgrund an Naivität sich auftut, sobald man das Computerdenken mit den Muskeln spielen lässt, die aus Drähten bestehen. Erschütternd selbst, worauf sich respektable Kunstkenner wie Hanno Rauterberg einlassen, wenn es um Beethoven im KI-Outfit geht. Zitat:
Der moderne Mensch schätzt alles, was anders, sehr unverständlich zu sein scheint, so wie Algorithmen, von denen es heißt, sie kennten den tieferen Sinn einer Beethoven-Symphonie. Zugleich tritt das Unverständliche hier nicht als etwas ganz Fremdes auf, sondern eben in der menschengemachten Form der Kunst. Und das hat etwas Tröstliches an sich.
Oh Gott. Ein Gespenst tritt auf: die Magd als Göttin. Mein ängstlicher Blick trifft auf ein ungelesenes Nachkriegsbüchlein im Regal:
Das Rauterberg-Zitat stammt aus der letzten Ausgabe der ZEIT (12. Dezember 2019). Mit Duhamel hat es nichts zu tun. Der Artikel beginnt nämlich in bewährter Weise bei den alten Griechen, also in der Menschheitsdämmerung, wo gerade jene Nachahmung der Natur, die bis zur verwechselbaren Ähnlichkeit ging, als allerhöchste Kunst galt, sofern man überhaupt dies Wort kannte.
ZITAT
Eine schöne, sehr seltsame Geschichte: Sie handelt von dem Bildhauer Pygmalion, der eine Skulptur aus Elfenbein erschafft, eine lebensgroße Frau, in die er sich derart verliebt, dass die tote Materie zu atmen und die Kunstfigur zu leben beginnt. Damit schien sich, zumindest dieses eine Mal, die alte Hoffnung der Menschen zu erfüllen: dass die Welt sie so sehr lieben möge wie sie die Welt.
Bis heute ist der antike Mythos überaus lebendig, nur dass es jetzt vor allem Techniker sind, die ihren kalten Objekten einen subjektiven Geist einhauchen wollen. Sie möchten beseelen, was keine Seele hat: Computer, die längst alle Lebenssphären durchdringen und den Menschen so nahe rücken, dass sie ihr Smartphone öfter streicheln als ihre Liebsten. Die Leute sind ihren Geräten ähnlich verfallen wie einst Pygmalion seinem Elfenbein. Und so scheint es fast schon unausweichlich, dass die digitale Technik endlich zu atmen beginnt oder zumindest andere menschliche Regungen zeigt.
Am vergangenen Wochenende kam die Meldung, gerade sei ein machtvoller Computer dabei, eines der wichtigsten Meisterwerke der Musikgeschichte zu komponieren. Dank großer Rechenleistung soll er vollenden, was seit 200 Jahren, seit dem Tod Ludwig Beethovens […]
Nein! er hatte noch 7 Jahre zu leben, das gesamte Spätwerk ab Missa solemnis fehlte, niemand hätte sich ausmalen können, wie es aussehen würde: die letzten Klaviersonaten, die letzten Streichquartette. Warum? Es war unberechenbar, – nicht so sehr die Themen oder das, was man, wenn man Beethoven heißt, so als erstes notiert. Man sehe sich in Beethovens Skizzenbüchern nur die Gestaltwerdung des Themas an, mit dem – am Ende der Prozedur – der langsame Satz der Fünften Sinfonie beginnt. Es ist so einfach, so „natürlich“, der IT-Projektmanager hätte seine Freude dran: lassen Sie ihn doch auch das Spätwerk Beethovens vereinfachen. Die allenthalben überforderte Welt würde es ihm danken.
Ach, es geht anders, – lesen Sie doch selbst nach:
Quelle DIE ZEIT 12. Dezember 2019 Seite 57 Malende Maschinen Neuerdings sollen Computer so kreativ sein wie Rembrandt oder Beethoven. Dahinter steckt eine alte Sehnsucht. Von Hanno Rauterberg. [Online mit kleinen Hindernissen auf folgendem Wege: Hier.]
Die Hybris liegt nicht darin, Künstliche Intelligenz damit zu befassen, ein Kunstwerk zu schaffen – wenn es gelingt: warum nicht? – sondern darin, die musikalische Intelligenz eines bestimmten historischen Ausnahmemenschen so zu simulieren, dass notwendigerweise ein Kunstwerk entsteht, das er geschaffen haben könnte. Schon das Wort Intelligenz ist – auf die Musik bezogen – viel zu eng gefasst. Kann KI eigentlich Ausdruckswerte erfassen? Oder nur bestimmte Abweichungen von der Norm? Ein Werk von Palestrina, Mozart oder Puccini hätte niemals bei einem gravierenden Mangel an Intelligenz entstehen können, – aber erst recht nicht ohne eine vollendete Ausbildung der Musikalität. Und diese erfordert soviel Differenzierung des Geschmacks, die wiederum mit einer solchen Vielfalt von (auch zeitgebundenen) Imponderabilien verwoben ist, dass sich die kritischen Bedingungen der genialen Musikproduktion vervielfachen.
Da ich kein Kunsthistoriker bin, neige ich zu der Annahme, dass ein Kunstgegenstand (ob Skulptur oder Gemälde) schon aufgrund der Materialität leichter zu simulieren ist als ein musikalisches Meisterwerk. Wohlgemerkt: ein vollständiges Werk, nicht – sagen wir – 16 Takte. Es kommt auch darauf an, wie hoch der Anteil des „bloßen“ Handwerks ist, das jeder Musiker beherrschen lernt, z.B. einen Kanon zu schreiben, eine Fugen-Exposition oder eine modulierende Überleitung. Zudem ist die Komplexität – unabhängig von der künstlerischen Substanz – entscheidend: ein Mondrian ist im Detail weniger problematisch als ein Rembrandt.
Was dem Computer fehlt, sind die alltäglichen lebendigen Wechselwirkungen mit dem realen Leben, mit der eigenen und fremden Arbeit, mit dem Trieb, etwas zu verändern, Widerstand zu leisten, mit der Neigung, ein Spannungsfeld zu etablieren, eine ferne Geliebte zu spüren, einen Neffen erziehen zu wollen, eine Utopie von Menschheit in Töne zu fassen. Es geht nicht um die „Intelligenz“ des Komponisten, denn die ist vollkommen verflochten mit seinem Lebensgefühl, seiner konkreten Welt, – und merkwürdigerweise ist in Rauterbergs Deutung alles Konkrete ausgeschaltet: er spricht von den Genies des 18. und 19. Jahrhunderts, der Erforschung der Weltgesetze und von der technischen Entwicklung allgemein, aber dann plötzlich von den metaphysischen Bedürfnissen der Gegenwart, die sich „lieber auf die Kunst und ihre Hervorbringungen“ richten. Als habe in der Vergangenheit die Kunst je außerhalb der technischen Entwicklung des Menschen agiert. Sie war freilich immer viel mehr als das. Daher reagiert der Musiker weiterhin so empfindlich auf eine gewollte oder behauptete Reduktion seiner Wirklichkeit.
ZITAT
Doch in der innigen Umarmung von digitaler Innovation und ästhetischer Kreativität, wie sie nun in Bonn und anderswo inszeniert wird, spiegelt sich etwas von der alten Hoffnung auf eine neue Übereinkunft. Die nackte, maschinenhafte Rationalität, so die Idee, soll nicht länger im Widerstreit mit einer schönen, zweckfreien Kunst stehen. Sie wird selbst schön und zweckfrei, aus sich selbst heraus bedeutend. Und das soll heißen: Sobald der Computer als Künstler auftritt, muss er sich nicht länger legitimieren. Er wird unhinterfragbar und scheint einer eigenen, nicht programmierten Gesetzmäßigkeit zu folgen, ganz so, als erfülle sich in ihm ein höherer Ratschluss der Geschichte.
Quelle Rauterberg a.a.O.
Es ist überflüssig zu erwähnen – aber ich glaube doch, dass die Pygmalion-Geschichte, die Rauterberg am Anfang seines Artikels erzählt, auch heute noch vor Missverständnissen geschützt werden müsste: als ob die Lebensechtheit abgebildeter Dinge einen Maßstab für das künstlerische Niveau eines Gemäldes hergibt. Vielleicht wäre es ergiebiger, die Täuschbarkeit des männlichen Blicks zu untersuchen, der auf physiologisch „echte“ Signale reagiert, wie der Pawlowsche Hund auf den Glockenton. Mit dem Unterschied, dass er daraus eine ganze Ästhetik des Schönen entwickelt.
(Fortsetzung folgt)