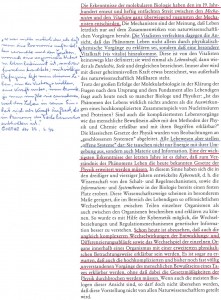Pflanzen – Tiere – Wir
GOETHE:
Soviel aber können wir sagen, daß die aus einer kaum zu sondernden Verwandtschaft als Pflanzen und Tiere nach und nach hervortretenden Geschöpfe nach zwei entgegengesetzten Seiten sich vervollkommnen, so daß die Pflanze sich zuletzt im Baum dauernd und starr, das Tier im Menschen zur höchsten Beweglichkeit und Freiheit sich verherrlicht.
Quelle Johann Wolfgang Goethe, dtv Gesamtausgabe München 1963 Bd. 39 Seite 11 „Bildung und Umbildung organischer Naturen“
Hugh Johnson:
Das Herz eines Baumes ist tot. Sein ganzes Leben spielt sich unmittelbar unter seiner Oberfläche ab, in einem Zellengürtel, der nicht dicker als eine Folie ist und zwischen dem Holz und der Rinde liegt.
Quelle Hugh Johnson: Buch der Bäume Seite 18
GOETHE:
(…) ein wichtiger Grundsatz der Organisation: daß kein Leben auf einer Oberfläche wirken und daselbst seine hervorbringende Kraft äußern könne; sondern die ganze Lebenstätigkeit verlangt eine Hülle, die gegen das äußere rohe Element, es sei Wasser oder Luft oder Licht, sie schütze, ihr zartes Wesen bewahre, damit sie das, was ihrem Innern spezifisch obliegt, vollbringe. Diese Hülle mag nun als Rinde, Haut oder Schale erscheinen; alles was lebendig wirken soll, muß eingehüllt sein.“
Quelle Johann Wolfgang Goethe, dtv Bd. 39 (wie oben) Seite 12
Michael Lohmann:
Pflanzen haben kein Innenleben. Alles an ihnen ist Oberfläche. Ihr Zentrum liegt – paradox gesagt – in ihrer Umwelt. Darin unterscheiden sie sich grundlegend vom Tier, das sich nach außen abschließt, ein inneres Zentrum (und damit „Innerlichkeit“) ausbildet (…).
Wer also das Wesen des Pflanzlichen begreifen will, muß sich insbesondere den Beziehungen zwischen Pflanze und Umwelt zuwenden, muß vor allem ihr Verhältnis zu den vier „Sphären“, Wasser, Mineralstoffe , Luft und Licht/Wärme, betrachten. Und er muß die Beziehungen studieren, die zwischen den Pflanzen bestehen. Denn die Pflanzengesellschaft, die Vegetation, ist so etwas wie ein Überorganismus, eine höhere Organisationsstufe, so wie der Organismus die einzelne Zelle, das einzelne Organ übergreift.
Quelle Michael Lohmann: Öko-Gärten als Lebensraum / Grundlagen und praktische Anleitungen für einen Naturgarten / BLV Verlagsgesellschaft München Wien Zürich 1983 Seite 39
Die Organe der Pflanze sind ganz der Umwelt zugewandt, geöffnet. Das Tier verbirgt seine Organe, schließt sich gegen seine Umwelt ab, mit der es nur durch Leibesöffnungen kommuniziert. Man könnte sagen, Tiere seien „umgestülpte“ Pflanzen. Und es ist wohl nicht zu weit hergeholt, wenn man diese Ausbildung eines Innenraums (einer Innenwelt) mit der Entwicklung von „Innerlichkeit“ (Erlebniswelt, Psyche oder wie immer) in Verbindung bringt (…).
Quelle Michael Lohmann (wie oben) Seite 53
ZITAT
Den neuesten entwicklungspsychologischen Forschungen können wir entnehmen, dass wir die anderen Menschen wirklich vom ersten Augenblick an, in dem wir sie sehen, als Menschen wahrnehmen. Eine Person zu sein bedeutet, einen Geist und einen Körper, ein Innen und ein Außen zu haben. Jemanden als Person wahrzunehmen bedeutet, ein Gesicht zu sehen und keine Maske, ein „Du“ und kein „Es“. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir bereits eine Reihe tief verwurzelter Vorstellungen davon, auf welche Weise andere Menschen uns ähneln und wir selbst anderen Menschen ähneln.
Aber die Forschung sagt uns auch, dass diese angeborenen Vorstellungen nicht das Ende, sondern erst der Anfang auf dem Weg zum Verständnis des menschlichen Geistes sind.Die Essenz der Persönlichkeit, das Du eines jeden Menschen zu erkennen mag Gott und Martin Buber genügen, aber uns, , dem sündigen Rest der Menschheit, genügt es offensichtlich nicht. Wir müssen auch lernen, mit welcher Art von Du wir es jeweils genau zu tun haben. Mag er Brokkoli wirklich? Wird sie in die Luft gehen, wenn ich diese Vase auch nur anrühre? Hat dieser Junge auf dem Spielplatz, der gesagt hat, dass Golfbälle explodieren, wenn man hineinschneidet, gelogen oder wusste er es nicht besser oder ist er gar ein gefährlicher Verrückter? Solcher Art sind die Probleme, mit denen sich Kinder konfrontiert sehen und die sie lösen, wenn sie älter werden.
Die Menschen um einen herum zu verstehen ist auch ein Teil des Prozesses, in dem man selbst zu einer bestimmten Art von Mensch wird. Wenn Kinder allmählich verstehen, wie der Geist anderer Menschen beschaffen ist, lernen sie gleichzeitig, wie ihr eigener beschaffen ist. Sie lernen, wie es ist, einen altgriechischen Geist zu haben, einen holländischen aus dem 16. Jahrhundert oder einen, der an die amerikanische Westküste des ausgehenden 20. Jahrhunderts gehört. (Eines unserer Kinder, gerade drei Jahre alt, schlug an einem Langweiligen Regentag vor, dass wir jetzt wirklich mal losgehen sollten, um einen Caffe latte zu trinken und in ein paar Buchläden zu schauen.) Volksgemeinschaften denken und fühlen, essen und kleiden sich auf eine ganz bestimmte Weise und Kinder müssen diese Lebensweise von den Erwachsenen erlernen, die sie umgeben.
Quelle Alison Gopik, Patricia Kuhl, Andrew Meltzoff: Forschergeist in Windeln / Wie Ihr Kind die Welt begreift / Piper Münchebn 2003 / Seite 41 f.
Zur erweiterten Thematik s.a. hier
Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Nähnadel
In diesem Zusammenhang verdienen die Erfindung und der Einsatz der am Kopf durchlochten Nähnadel aus Knochen besondere Aufmerksamkeit. Dieses Werkzeug war von entscheidender Bedeutung, weil es eine erhebliche Verbesserung der Nähtechnik ermöglichte. Die Nähte der Kleidung ließen sich mit solch einer Nähnadel weit besser abdichten als früher, und auch die Verbindung von Leder- und Fellmaterialien konnte perfektioniert werden. Schließlich wurde dadurch die Wärmedurchlässigkeit jener „kulturellen Membranen“, wie man frühe Bekleidung bezeichnen könnte, deutlich reduziert. Der Erfolg zeigte sich vor 20 000 Jahren, als ein weiteres Kältemaximum zu einem erneuten Vorstoß der Gletscher, einem neuerlich kälter und trockener werdenden Klima und dem Ende des Gravettien geführt hatte. Damals kam es nicht mehr wie noch in früheren Zeiten zu einem teilweisen Zusammenbruch ganzer Populationen. Der Mensch hatte einen entscheidenden Schritt getan, sich nochmals besser an die veränderten Umweltverhältnisse anzupassen, und verstand es nun, sich mit Hilfe seiner Technologie den aufkommenden Widrigkeiten erfolgreich zu widersetzen.
Quelle Hermann Parzinger: Die Kinder des Prometheus. Eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. C.H.Beck München 2014 / 2015 Seite 69