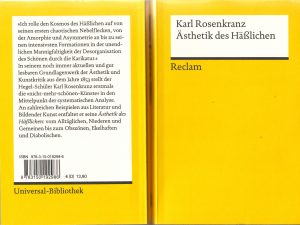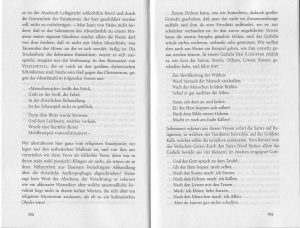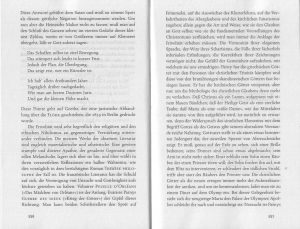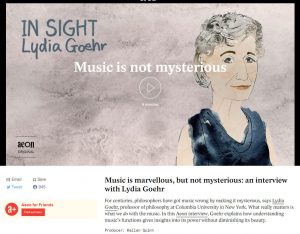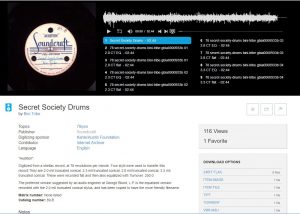Erste Annäherung
Der Text klingt auf den ersten Blick vielleicht kompliziert, andererseits aber gilt es ja gerade die falsche Abkürzung zu vermeiden und nicht zu sagen: mir geht es ums bloße (voraussetzungslose) Hören. Denn das ist keine Tugend. Damit landet man ganz schnell bei leerer Meditationsmusik.
ZITAT
Gewöhnlich knüpfen kultur- und sozialwissenschaftliche Resonanzkonzepte in direkter oder metaphorischer Redeweise an musikalische Vorstellungen an, in denen ein extrem performativ ausgerichteter Musikbegriff zum Tragen kommt und Musik nicht als Gegenstand – weder als abstrakter noch als singulärer – begriffen wird, sondern eine „reine Beziehung“ sein soll; nicht entscheidbar, ob innen oder außen befindlich, im Raum oder im Hörer angesiedelt, vielmehr beides gleichermaßen. Kunst wird als Erfahrung gedacht, die mit dem Ausdruck „Resonanz“ gebündelt werden soll. Resonanz sei eine Erfahrung, die affektiv nicht neutral sei, sondern ein mehr oder minder intensives Erleben beinhalte. Musik als Medium konkreter Inhalte, als Medium definierten Sinns hingegen wird verneint. Definierter Sinn, der immer der Objektivierung bedarf, und Resonanz werden auseinandergehalten. Musik vermittelt demnach keine Inhalte, sie vermittelt leiblich und emotional Grundstimmungen.5 Das Erleben steht im Vordergrund, die Rolle kognitiver Vermittlung für das Erleben wird umgangen. Musik sei das Medium, „das Modi, Transformationern und Intensitäten der Weltbeziehungen unmittelbar, das heißt ohne kognitive Projektion oder Vermittlung, zum Ausdruck zu bringen vermag“6, schreibt Hartmut Rosa. Ein wenig differenzierter sieht dies Christian Grüny. In der Musik erlebte Resonanz hängt für ihn auch von der Vertrautheit mit bestimmten, je nach Musik verschiedenen Regeln ab, etwa denen der Tonalität, der Harmonik etc. Wer nicht über derlei Regeln verfüge, nicht an sie gewöhnt sei, dem mangele es unter Umständen an der Resonanzfähigkeit für die ihnen entsprechende Musik. Gleichwohl konstatiert auch er für die Resonanz ein „Überwiegen des pathischen Moments, von einem primären Bewegtwerden, das deutlich über einen bloßen Anstoß hinausgeht“.7 Von denselben oder zumindest sehr eng verwandten Vorstellungen von Musik geht Sören Kierkegaard bei der metaphorischen Bestimmung des musikalisch Dämonischen aus, freilich mit ganz anderem Resultat.
Quelle Boris Voigt: Metapherntanz auf dem Brocken / Musik & Ästhetik Klett-Cotta Stuttgart Juli 2020 (Seite 38f, in den Anmerkungen 5-7 auffindbare Quellenangaben folgen als Scan, dabei interessiert insbesondere: Christian Grüny: Die Kunst des Übergangs. Philosophische Konstellationen zur Musik, Weilerswist 2014)

In diesem Moment kann ich rückkoppeln und mich zugleich hindern, bei einem früheren Ansatz stehenzubleiben: siehe „Wann ist Musik?“ hier. Christian Grüny hat auch Susanne K. Langers großes Werk „Fühlen und Form“ übersetzt und mit einer großen Einleitung versehen. In seinem Werk „Kunst des Übergangs“ widmet er das dritte Kapitel dem Phänomen „Resonanz“ und bezieht sich darin ausführlich auf Ernst Kurth und Viktor Zuckerkandl. Zugleich wird ein kritischer Neuansatz unumgänglich.
Der Aufsatz von Boris Voigt wirkt in diesem Zusammenhang noch willkommener, weil er eine Verbindung zur „Ästhetik des Hässlichen“ nahelegt, die mich in den letzten Tagen aufs neue ernsthaft beschäftigt hat. Um diese Verbindung plausibel zu machen, zitiere ich auch den weiteren Text, der sich dem Negativen zuwendet:
Interessanter noch als die begrifflich problematische Konstitution der Resonanzkonzepte ist ein anderer Umstand. Trotz ihrer weiten Ausdehnung finden in sie bestimmte Phänomene keinen Eingang, die aber erheblich näher an dem sind, was mit dem Ausdruck „Resonanz“ möglicherweise gemeint sein könnte, als viele der von den Verfassern von Resonanzkonzepten betrachteten Gegenstände. Das wären etwa Phänomene wie Jagd, Kampf, Krieg oder Progrom, manche Spielarten des Betrugs wären ebenfalls einzubeziehen. Letztere deshalb, da einige Formen von Betrug erst durch hohe Empathie mit dem Betrugsopfer möglich werden. Die destruktive Seite dessen, worauf der Ausdruck „Resonanz“ angewandt wird, erfährt eine nahezu systematische Ausblendung, abgesehen von dem Zugeständnis, Resonanz sei auch Macht- und Herrschaftsverhältnissen einbezogen.8 Grüny ist insofern eine Ausnahme, als er eingehend den Einsatz von Musik als Folterinstrument erörtert, den er ausdrücklich als „Resonanzfolter“ bezeichnet.9
Quelle Boris Voigt: Metapherntanz auf dem Brocken a.a.O.



Notizen zum späteren Gebrauch
Spiegel! …. Noch eine Rückkopplung: hier !
Musik-Folter Grüny Seite 117 Link nicht auffindbar – aber Text hier
Eminem „Real Slim Shady“ / David Gray „Babylon“
In der Tat spielt nun auch in dem (innerhalb desselben Heftes Musik & Ästhetik) vorhergehenden Artikel von Pfleiderer und Rosa, der die Resonanz zum Thema hat, das Hässliche – oder sagen wir: das weniger Schöne – eine Rolle, etwa in Schuberts „Leiermann“. Zugegeben: ich habe es nie im Leben so, wie andere Lieder der „Winterreise“ – etwa „Das Wirtshaus“ – separat aufgerufen, um es zu genießen. Ich fand es bedeutend, aber nicht „schön“, nur trostlos. ABER… (es lässt sich gut didaktisch „behandeln“, und zwar auch von Leuten, die sich nicht besonders für Schuberts Schönheit interessieren).
Eben eingetroffen:
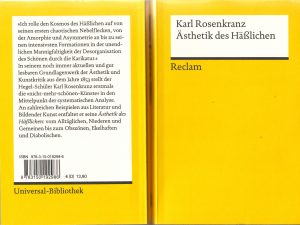 1853 Digitalisat des Originals hier / Man behalte im Sinn, dass wir uns hier in der Zeit befinden, in der Baudelaire seine „Fleurs du Mal“ („Blumen des Bösen“) veröffentlichte.
1853 Digitalisat des Originals hier / Man behalte im Sinn, dass wir uns hier in der Zeit befinden, in der Baudelaire seine „Fleurs du Mal“ („Blumen des Bösen“) veröffentlichte.


Die Systematik vermittelt bereits eine leise Ahnung, wie konservativ und sittenstreng der Hegelschüler mit den hässlichen Dingen verfahren wird. Die folgenden Seiten zeigen, wie er ein glänzend loses Mundwerk wie das des Dichters Heinrich Heine (gest.1856) unter dem Stichwort „Das Rohe“ abstraft:
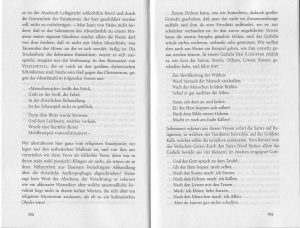
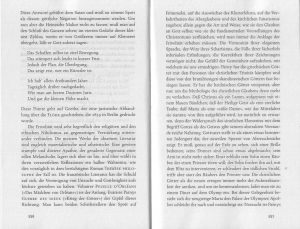
Quelle Karl Rosenkranz: „Ästhetik des Häßlichen“ Reclam Universalbibliothek Nr. 19298 Stuttgart 1990, 2015
Lesenswertes Nachwort von Dieter Kliche: Pathologie des Schönen – Die „Ästhetik des Häßlichen“ von Karl Rosenkranz ab Seite 458, auch hier fällt schließlich der Name Baudelaire, der den Umschwung der Ästhetik bezeichnet.
[Rosenkranz] versteht das Häßliche, das „Negativ-Schöne“, als einen Teil der Ästhetik, auf gleiche Weise ihr zugehörig wie zur Biologie die Krankheit, zur Ethik das Böse, zur Rechtswissenschaft das Unrecht und zur Religionswissenschaft die Sünde. (…)
Die lange und sorgsam gehegte ästhetische Werteeinheit des Wahren, Guten und Schönen steckte tief in der Krise, und der späte Heinrich Heine sah mit dem Heraufkommen des Proletariats und von dem drohenden „Gespenst des Kommunismus“ die Schönheit überhaupt in ihrem Bestand bedroht.
Über solche und ähnliche Gründe für die Emanzipation des Häßlichen gegenüber dem Schönen spricht Rosenkranz kaum. Allenfalls im Subtext (…)
[endet mit den Sätzen S. 481f:]
Dem Aufklärer und Hegelianer Karl Rosenkranz lag natürlich daran, diese Zweifel an der Vernünftigkeit der Welt zu entkräften, aber die bohrenden Fragen blieben. Damit wurde es aber auch zweifelhaft, ob das Schöne noch die Macht sein konnte, „welche die Empörung des Häßlichen seiner Herrschaft wieder unterwirft“. Mit dieser neuen, schärferen Negativität des Häßlichen wurde ein neuer Zyklus seiner Geschichte eröffnet, der jenseits von Rosenkranz‘ „Ästhetik des Häßlichen“ beginnt und in Charles Baudelaire seinen ersten poetischen Protagonisten hat. Die „Blumen des Bösen“ von 1857 sind eine neue und neuartige Ästhetik des Häßlichen.
* * *
Ich hatte nicht geahnt, dass diese neue Lektüre-Saison mich dazu führen würde, diesem Vertreter einer alten Ästhetik doch ein gewisses historisierendes Verständnis abzugewinnen, das den Umschwung zur „Struktur der modernen Lyrik“ dann um so schärfer erfassen lässt. Noch weniger, dass der grundlegende Artikel über „Musik als Resonanzsphäre“, der dem von Boris Voigt vorausgeht, nach einigen Repetitionen eine immer stärkere Aversion auslöst. Es erinnerte mich an die frühe Begegnung mit Joachim E. Berendt. Wahrscheinlich ist es die Klassikferne, die gerade dort zutage tritt, wo sie überwunden scheint, indem das Performative hervorgekehrt wird. Das könnte mich als ausübenden Künstler erfreuen, andererseits ist es so, dass mich das Werk im emphatischen Sinne mehr interessiert als das, was ein beliebiger Rezipient dabei empfindet. Seine Resonanzerfahrung langweilt mich. Die Gründe dafür müsste ich natürlich ausführlicher darstellen, nehme mir daher vor, das Thema im übernächsten Blog-Artikel noch einmal vorzunehmen, um vorher bei den Bachschen Werken BWV 1001-1006 zu verweilen, von denen jedes ein opus perfectum et absolutum verkörpert, und zugleich eine Darstellung verlangt, die nicht statuarisch wirkt, sondern von Leben sprüht. Eine neue Aufnahme, in sensationeller Perfektion, – bietet sie eine neue Resonanzerfahrung? Das Label ECM könnte darauf hoffen lassen.
Quelle Martin Pfleiderer und Hartmut Rosa: Musik als Resonanzsphäre / Musik & Ästhetik 24,3 / 2020, 5-16 Klett-Cotta Stuttgart Juli 2020
 Übersicht des vorgesehenen Programms
Übersicht des vorgesehenen Programms