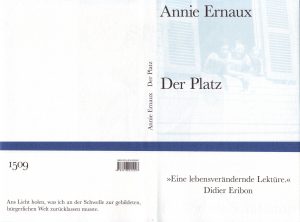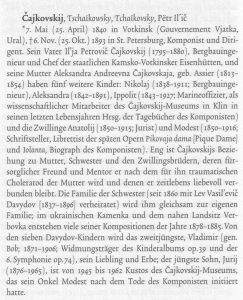Beiläufiges beim Lesen und Musikhören
Über eine Bemerkung in der Zeitschrift Landlust März/April 2019 (Foto: Heinz Duttmann) stolperte ich: „In der freien Natur kommt Lungenkraut kaum noch vor, die Bestände sollten geschont werden.“ Davon wusste ich nichts, und Wikipedia wohl auch nicht. Bei mir ist genug davon im Garten, Treffpunkt der Bienen, der Pelzbienen. Siehe im Blog unter Mein Rasenstück. So sah ich es vor etwa einem Jahr, und jetzt beginnts gerade auch wieder zu blühen, viele Einzelbienen, die ziemlich eilig von Blüte zu Blüte wechseln, umgeben von Bärlauch, dessen Knospen sich noch unter den Blättern verbergen.
Neu:
Annie Ernaux – „Der Platz“ ist angekommen (s. hier). Über ihren Vater, der Seite 52 auf dem Weg nach oben die Grenze seines gesellschaftlich niederen Standortes mit Mühe hinter sich gelassen hat. [Ich denke an alle Orte, wo ich solche Grenzen wahrgenommen habe. Meine Großeltern in Lohe bei Bad Oeynhausen, meine Mutter, die bei Besuchen dort plötzlich mit den Nachbarn westfälisches Platt sprach, mein Vater aus Hinterpommern, der „Viertel elf“ sagte oder „ich habe dort ein Buch zu liegen“, in Bielefeld, wo man eben anders sprach, in Köln-Niehl das Kölsch meiner Zimmerwirtin, in Solingen allenthalben die Reste eines altertümlichen Bergisch Platt.]
Meine Großeltern sprachen nur patois, das normannische Platt.
Manche Leute finden das Patois und das Französisch der unteren Schichten pittoresk. So zählte Proust Françoises Fehler und veraltete Ausdrücke auf. Ihn interessiert nur die Ästhetik, weil Françoise sein Hausmädchen war, nicht seine Mutter. Und weil ihm diese Wendungen selbst nie spontan über die Lippen gekommen wären.
Für meinen Vater war das Patois etwas Altes, Hässliches, ein Zeichen gesellschaftlicher Unterlegenheit. Er war stolz darauf, es teilweise abgelegt zu haben, und selbst wenn er kein schönes Französisch sprach, war es immerhin Französisch. Auf dem Jahrmarkt von Y… führten Laienschauspieler in normannischer Tracht Sketche in Patois auf, und das Publikum lachte. In der Lokalzeitung gab es zur Belustigung der Leser eine normannische Chronik. Wenn der Arzt oder ein anderes hohes Tier im Gespräch eine regionale Redewendung gebrauchte, zum Beispiel „elle pète par la sente„, wiederholte mein Vater die Worte voller Genugtuung gegenüber meiner Mutter, glücklich, weil er annehmen konnte, dass diese feinen Leute noch etwas mit uns gemein hatten, eine kleine Schwäche. Er war fest überzeugt, dass ihnen der Ausdruck versehentlich rausgerutscht war. Weil es für ihn undenkbar war, dass man ohne Anstrengung „richtig“ sprechen konnte. Weißkittel oder Pfaffe, immer musste man sich zusammenreißen und aufmerksam zuhören, nur zu Hause konnte man sich gehen lassen.
Er, der in der Kneipe und in der Familie viel redete, schwieg in der Gegenwart von Leuten, die gutes Französisch sprachen, oder er brach mitten im Satz ab, sagte „finden Sie nicht?“ oder nur „nicht?“ und bedeutete seinem Gegenüber mit einer Handbewegung, den Satz für ihn zu beenden. Beim Sprechen immer vorsichtig sein, unsagbare Angst vor dem falschen Wort, was genauso schlimm wäre wie in der Öffentlichkeit einen fahren lassen.
Aber er hasste auch große Phrasen und neumodische Ausdrücke, die „Blödsinn“ waren. Irgendwann sagten alle ständig „sicher nicht“, und er verstand nicht, warum man zwei Wörter kombinierte, die einander widersprechen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die kultiviert wirken wollte und Gehörtes oder Gelesenes beherzt ausprobierte, mit nur leichter Unsicherheit, weigerte er sich, ein Vokabular zu verwenden, das nicht seins war.
Wenn ich als Kind versuchte, mich besser auszudrücken, habe ich immer das Gefühl, mich in einen Abgrund zu stürzen.
Eine meiner geheimen Ängste: einen Lehrer als Vater haben, sodass ich die ganze Zeit auf meine Ausdrucksweise achten müsste und die Endungen nicht verschlucken dürfte. Wir redeten mit dem ganzen Mund.
Weil die Grundschullehrerin mich immer „verbesserte“, verbesserte ich später meinen Vater, ich eröffnete ihm, dass Wendungen wie se parterrer (sich auf den Boden schmeißen) oder quart moins d’onze heures (Viertel elf) im Französischen nicht existierten. Er bekam einen Wutanfall. Ein anderes Mal: „Wie soll ich in der Schule richtig sprechen, wenn ihr euch die ganze Zeit so schlecht ausdrückt!“ Ich weinte. Er war unglücklich. In meiner Erinnerung führte alles, was mit Sprache zu tun hatte, zu Ärger und Streit, viel mehr als Geld.
Quelle: Annie Ernaux: Der Platz / Aus dem Französischen von Sonja Finck / Suhrkamp Verlag Berlin 2019 ISBN 978-3-518-22509-7.
Habe heute die Orthodoxen Liturgietexte gesucht und gefunden („tas thyras!“), Aufnahme 1982 in Athen und anschließende Riesenarbeit (für Deutsche Harmonia Mundi), die zu nichts führte, außer dass ich sagen kann: einige Liturgie-Sendungen im WDR und ein wunderbares, gewaltiges Ton-Dokument im Schallarchiv des Senders, endlich wieder zu etwas nütze: hier.
Gestern Tacet-CD gehört, Tschaikowski-Quartette, gespielt vom Bartók-Quartett, dessen Besetzung sich im Laufe der 50jährigen Geschichte offenbar geändert hat. Als Ergänzung zur Wikipedia-Angabe lese ich an anderer Stelle:
05/10/2017 Der ungarische Geiger Péter Komlós, Gründer und erster Geiger des Bartók-Quartetts, ist im Alter von 81 Jahren in Budapest gestorben. 1957 gründete er zusammen mit Sándor Devich, Géza Németh and László Mező das Komlós Quartett, das sich 1963 in Bartók Quartett umbenannte.
Mir liegt daran, weil ich Sándor Devich 1986 in Szombathély erlebt habe, und es damals hieß, er sei zweiter Geiger im Bartók-Quartett gewesen. Vielleicht ist er gerade bei der Umbenennung ausgestiegen? Unwichtig in diesem Zusammenhang: es geht um Tschaikowski und verschiedene Wahrnehmungsweisen.
Diese schöne CD enthält keinen Text zu den Werken, sondern allein zum Programm der Tacet-Reihe „Summary“ allgemein. Empfehlenswerte Einführungen zu op. 11 findet man hier, zu op. 22 hier. Ich notiere das an dieser Stelle, weil ich den berühmten zweiten Satz von op. 11, der mich plötzlich sehr ergriff, für eine (oder die?) Zarenhymne hielt; beim Recherchieren erwies die Melodie sich als ein ukrainisches Volkslied. Ebenso merkwürdig: dass Tolstoj von dieser Melodie zu Tränen gerührt wurde. Für mich – wie immer – Anlass zu analytischen Überlegungen. Wobei ich nicht unterstelle, dass ER aus den gleichen Gründen gerührt war wie ich. Schließlich war er mit dem Flair der russischen (und ukrainischen) Lieder seit früher Jugend vertraut, während mich etwas Fremdes (Exotisches) daran beeindruckt. Die Wirkung verdankt sich zu einem nicht geringen Teil der Harmonik (modal), ich konzentriere mich aber an dieser Stelle nur auf den Melodieverlauf.
Ist es die eigenartige Verschiebung der Balance in den ersten 4 Takten? Der eingeschobene Dreiertakt? Ein Viertel „zuviel“, 9 Viertel Gesamtlänge; während die nächsten 4 Takte ganz gleichmäßig antworten, mit 8 Vierteln Gesamtlänge. Es wäre leicht, einen Kompromiss zu finden, – aber der Reiz wäre dahin.
Nein, wie wären um das C betrogen, obwohl es vorhanden ist. Wenn ich es dingfest machen müsste, würde ich sagen: im dritten Takt beginnt mich die Melodie zu faszinieren, und beim Übergang zum vierten spüre ich, dass die Tränen kommen wollen. Merkwürdig: genau so, wie der Komponist das Crescendo gesetzt hat, aber dieses ist nicht die Ursache, die auf mich wirkt. Ich vermute – der Komponist reagiert genau wie ich oder wohl wir alle, und er setzt deshalb das Crescendo, um die Interpretation darauf einzuschwören. In der zweiten Hälfte der Melodie gibt es einen ähnlich neuralgischen Punkt, der aber nicht das Ziel des auch hier eingezeichneten Crescendos ist… sondern… welcher Ton?
Für Außenstehende ist schwer vorstellbar, warum Musiker lange grübeln können, wie eigentlich der erste Takt dieses Themas gewichtet ist. Eine Schaukelbewegung hat immer etwas Unernstes, Unentschlossenes, aber vielleicht ist das Wort schon falsch; denn die beiden Zweiergruppen sind ja nicht gleich, sie schaukeln nicht, sie vermeiden den Ton der dazwischenliegt. Aber sie wollen zum ersten Ton des nächsten Taktes, zum ES. Ist dieser Takt also auftaktig zu verstehen? Versuchen wir doch ein paar Varianten:
Ich erspare mir an dieser Stelle drei Texte, Musiker würden debattieren, singen und spielen, der „dazwischenliegende“ und übergangene Ton würde eine Rolle spielen, er macht den dritten Takt so stark, das C mit dem nachgelieferten G, das pendelt, aber zurückwill (zum C), ein F nur spielerisch vorwegnehmend, dann zum C, dort wieder „pendelt“, um dann auf dem F einen vorläufigen (!) Ruhepunkt zu finden. Der nächste Takt, Beginn der zweiten Hälfte, greift auf die Bewegung des ersten Taktes in den zweiten zurück (also die Schleife F-D-G bezogen auf D-B-ES), und so wird auch der Septsprung verständlich, in Wahrheit die Wiederaufnahme des Tones C. Aber welcher Ton ist das wirkliche Ereignis der zweiten Hälfte? Keinesfalls das hohe C, ebensowenig der Zielton F, der den letzten Ton der ersten Hälfte wieder aufnimmt. Es ist der Ton A, der in der ganzen „Reihe“ bisher fehlt, der aber an dieser Stelle keinesfalls betont werden darf (nur mit Liebe gespielt werden muss).
Zur Intensivierung der Diskussion stelle man ähnliche Überlegungen an bei dem berühmten Thema der Haydn-Variation von Brahms: zwei fünf(!)taktige Hälften, – ist der erste Takt auftaktig zu verstehen? Ist der zweite Takt stärker als der erste? Vergleiche das Forte in Takt 6 und die Akzente auf den vier Melodietönen der danach folgenden Takte. Erfinde Varianten für den allerersten Takt nach dem Muster des vorigen Beispiels.
* * *
David Oistrach bleibt zum Glück sehr dicht am Original, – auch in den Bindungen? Oder? – spielt er etwa einfach die 1. Geige des Quartetts?
Zum Abgewöhnen auch noch die zweite Melodie des Andantes, siehe Notentext Mitte Zeile 7, in der Version von 1940. Möglicherweise auch wieder zum Weinen.
Abschiedsfrage: wie schreibt man eigentlich Tschaikowski? Hätte er sich selbst in unserm größten Musiklexikon MGG eigentlich wiedergefunden? (Um so lesenswerter der Artikel, der von Thomas Kohlhase stammt.)
11.04.2019
In WDR 3 gehört (Klassikforum zwischen 10 und 11, Freund Hanns-Heinz rief aufgeregt an) : Tschaikowski Violinkonzert / Kopatchinskaja Musica Aeterna Currentzis: Ich hatte allerhand Vorbehalte gegenüber ihrer Behandlung Beethovens und anderer Klassiker, aber dieser Tschaikowski wischt alle Bedenken weg, auch der Zusammenklang von Violine und Orchester, der Wechsel der Farben, das äußerste Pianissimo, die minimalsten Nuancierungen, z.B. Wechsel zwischen Violine und Klarinette oder Flöte, deren Gleichberechtigung nach Bedarf. Am Übergang zwischen zweitem Satz und Finale mögen sich die Geister scheiden (siehe Link unten: tritt nicht doch eine gewisse Zickigkeit zutage?), aber es ist einfach unerhört, der Kontrast der Temperamente, die übersprudelnde Virtuosität, die Wildheit, die Oasen der Lyrik. Keine Wiederentdeckung des Komponisten, sondern die Erstentdeckung.
Repeat! Wo ist die Taste? Ich muss die CD haben und jedes Detail zu studieren. (Neugier daher auch auf „Les Noces“!) Den Link habe ich erst nachträglich entdeckt (kaum zu glauben der Hinweis auf Darmsaiten!), das alles stammt von 2016, wo bin ich nur gewesen?? Prüfen Sie nur selbst und zwar hier.
23.04.19
Die CD ist da, und der Sturm hat sich gelegt. Es ist nützlich zu warten, bis eine gewisse Ruhe der Betrachtung wiederkehrt. Welchen Sinn hätte es, in Raserei zu verfallen, oder einer Wahnidee nachzujagen, einer Phantasieromantik? Ein neuer Versuch der Annäherung und Distanzierung, vielleicht hier.