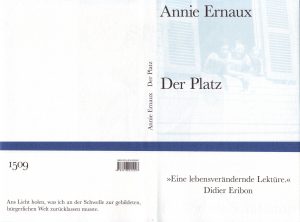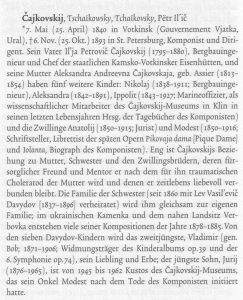Es geht um schwere Geschütze in den Medien
LANZ-Sendung 29.September 2022: Über das Twittern (ab etwa 40:00)
17:40 MELANIE AMANN (an Precht): Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht: ich glaube, da stehen viele Dinge drin, die viele Leute so denken. Da stehen aber auch viele Dinge drin, die … etwas mehr Recherche verdient hätten. Weil: Sie haben ja nicht systematisch ausgewertet, wie wir über den Krieg berichtet haben. Sondern Sie haben berichtet, wie Sie wahrnehmen, Sie haben beschrieben, wie Sie wahrnehmen, wie wir über den Krieg berichtet haben. Es ist ja nicht so, dass Sie da irgendwie jetzt in irgend ’ner Weise qualitativ quantitativ untersucht hätten, wie haben die Medien über den Krieg berichtet. (Precht: das geht ja doch gar nicht!) Doch, natürlich geht das! Das dauert halt ’n bisschen länger als zwei, drei Monate, ich weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben, das Buch zu schreiben, – es ist sozusagen wie ein geschriebener Podcast, in dem mal sozusagen dargestellt wird, wie die Welt so wahrgenommen wird. Und inhaltlich – würd ich sagen – dass die Positionen, die Sie einfordern, das Zögern, das Zweifeln, das Vor-Ort-Recherchieren, das Berichten, die Unsicherheit der Berichterstattung, das wurde umfassend thematisiert. Was sich auch wiederfindet, sind die unterschiedlichen Meinungen, über die wurde extrem – beim Spiegel, ich war ja teilweise selber beteiligt -, berichtet in allen Qualitätsmedien. Also der Vorwurf, dass abweichende Meinungen nicht stattfinden, der ist objektiv falsch. (Precht: Ja, den gibts auch nicht!) Wo man drüber diskutieren kann, was ich eher sehe, ist: haben die Journalisten selber in ihren Kommentierungen mehrheitlich eine Position gehabt oder haben sie eine Fifty-Fifty-Bandbreite von Positionen gehabt? da würde ich sagen: es stimmt, dass es ein Übergewicht einer Meinung gab, aber das ist im Journalismus eher selten. Also – Ihre Unterstellung, die ja leider der Verlagsankündigung ja so ’n bisschen mit diesem hässlichen nationalsozialistischen Wort der Selbstgleichschaltung umschrieben war, (LANZ: das ist aber ein Begriff, der im Buch nicht fällt -) ja, wir alle sind hier Buchautoren, und wir sind … 19:36
41:10 PRECHT Die Frage ist sozusagen, warum man Stilmittel, – wenn man gezwungen ist, sich auf 280 Zeichen zu reduzieren -, Stilmittel wie eben die extreme Personalisierung, die Dekontextualisierung, die Sätze aus dem Kontext reißen und mal kurz die Meinung dazu geben, – warum solche Dinge als Stilmittel auch in den Leitmedien auftreten, und das hat in letzter Zeit wahnsinnig zugenommen, und meine Kritik daran ist: nicht, dass der eine oder der andere beleidigt ist, sondern die Kritik daran ist: das geht auf Kosten unserer demokratischen Debattenkultur.
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-29-september-2022-100.html
Und eine der Reaktionen aus den Medien
Jens Jessen ist ein Journalist, den ich schätze. Precht und Lanz kommen oft genug in diesem Blog vor, ich kann nicht leugnen, dass ihre Themen mich oft beschäftigen, was nicht bedeutet, dass ich ihrer Argumentation, ihren Diskussionen oder Gesprächen stets mit einhelliger Begeisterung folge. Ausdrücklich würde ich jederzeit gute Journalist:innen wie Melanie Amann und Robin Alexander hervorheben, die mindestens ebenso klar denken und reden wie der Gastgeber und der Philosoph.
Einstweilen warte ich allerdings begierig auf das neue Buch von Jürgen Habermas: hier „Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik“ Suhrkamp Verlag – ZITAT:
Kernstück des Buches ist ein Essay, in dem er sich ausführlich mit den neuen Medien und ihrem Plattformcharakter beschäftigt, die traditionelle Massenmedien – maßgebliche Antreiber des »alten« Strukturwandels – zunehmend in den Hintergrund drängen. Fluchtpunkt seiner Überlegungen ist die Vermutung, dass die neuen Formen der Kommunikation die Selbstwahrnehmung der politischen Öffentlichkeit als solcher beschädigen. Das wäre ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, mit gravierenden Konsequenzen für den deliberativen Prozess demokratischer Meinungs- und Willensbildung.
Etwas ganz Anderes vom 6. 10.22
Eine Meldung von heute Morgen, die mich eigentlich nicht überrascht, aber sehr gefreut hat: Nobelpreis für Annie Ernaux. Hatte ich sie womöglich vergessen?
 siehe im Blog hier, hier und hier.
siehe im Blog hier, hier und hier.
Ich wollte alles sagen, über meinen Vater schreiben, über sein Leben und über die Distanz, die in meiner Jugend zwischen ihm und mir entstanden ist. Eine Klassendistanz, die zugleich aber auch sehr persönlich ist, die keinen Namen hat. Eine Art distanzierte Liebe.
Daraufhin begann ich einen Roman zu schreiben, mit ihm als Hauptfigur. Mittendrin ein Gefühl des Ekels.
Seit Kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist. Um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht »spannend« oder »berührend« schreiben wollen. Ich werde die Worte, Gesten, Vorlieben meines Vaters zusammentragen, das, was sein Leben geprägt hat, die objektiven Beweise einer Existenz, von der ich ein Teil gewesen bin.
Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfern. Der sachliche Ton fällt mir leicht, es ist derselbe Ton, in dem ich früher meinen Eltern schrieb, um ihnen von wichtigen Neuigkeiten zu berichten.
Aus: Annie Ernaux: Der Platz / Aus dem Französischen von Sonja Finck / Bibliothek Suhrkamp Berlin 2019 ( Seite 19f)
Und am 7.10.22 – als aktueller Epilog – am Tag des Friedensnobelpreises
Mehr darüber: hier von Jan Dafeld / Shervin Hajipours Song „baraye“ entwickelt sich zur Hymne der Protestwelle im Iran. Tausende singen das Lied bei Demonstrationen, iranische Schülerinnen stellen ihre eigene Version ins Netz. Das Video des 25-Jährigen wird wenig später gelöscht, der Künstler festgenommen. (Quelle RTL News)
Andere Quelle: hier (DW Akademie)
* * *
12. Oktober 22 Habermas – Neu, endlich angekommen (schon 2. Auflage):
 Allerdings: prüfen Sie doch bitte, ob die Seiten, die in meinem Exemplar doppelt vorhanden sind – Seite 81 bis 96 -, womöglich anderswo fehlen…
Allerdings: prüfen Sie doch bitte, ob die Seiten, die in meinem Exemplar doppelt vorhanden sind – Seite 81 bis 96 -, womöglich anderswo fehlen…
 Und wenn Sie gerade die Lektüre unterbrechen, – informieren Sie sich vielleicht auch bei Wikipedia, was über „Deliberative Demokratie“ vorweg zu lernen ist…
Und wenn Sie gerade die Lektüre unterbrechen, – informieren Sie sich vielleicht auch bei Wikipedia, was über „Deliberative Demokratie“ vorweg zu lernen ist…