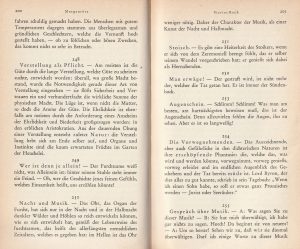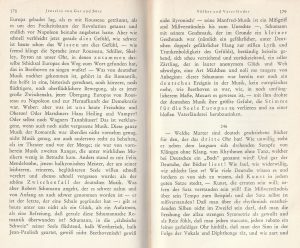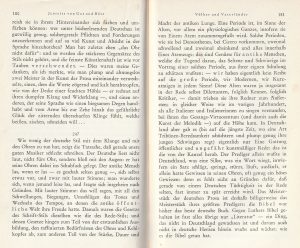Um es festzuhalten
Ich gehe aus von Peter Szendy, der mich schon einmal in recht skeptische Stimmung versetzt hat (siehe hier , später habe ich das Thema wohl aufgegeben, ratlos), sein neuer Aufsatz begegnete mir jetzt in dem Magazin „Musik & Ästhetik“ (Heft 109, Januar 2024, S, 5-15): „Wie viele Ohren? Oder : Der Adressat des Hörens“.
Das „dritte Ohr“ als Thema ist nicht neu, zu der Kurz-Übersicht eines sehr tüchtigen Bloggers fand ich durch google, hier, wobei mich wiederum skeptisch stimmt, dass ich alle in diesem Zusammenhang wichtigen Namen falsch geschrieben sehe, nämlich so: Theodor Reick, Joachim E. Behrendt und auch Siegmund Freud.
Da mir Szendy nach wie vor aus dem Nietzsche-Aphorismus etwas anderes herauszuhören scheint als drinsteckt, etwas „Anderes“, oder gar die „Andersheit“, möchte ich die ausschlaggebenden Texte vollständig wiedergeben, um zu prüfen, ob meine intuitive Weise des Verstehens auf einem fehlenden dritten Ohr beruht, – das mir schon bei Berendt aus der Luft gegriffen schien, nachgebildet dem „dritten Auge“ der Inder. Aus Nietzsches „Morgenröte“ (alte Kröner-Ausgabe 1952) Nr. 255:
Von einem dritten Ohr ist im Gespräch zwischen A und B keineswegs die Rede: „Horch“ heißt es da, als die Musik von neuem beginnt, von der B überwältigt war, während A aufklärerisch von einem Drama spricht , das B „beim ersten Hören“ wohl nicht habe sehen können oder wollen, obwohl jener, wie er sagt, „zwei Ohren und mehr hat, wenn es nötig ist“. Deshalb ermuntert er A, ihm Näheres zu erklären. Und d e r flüstert seinen Kommentar offenbar parallel zur laufenden Musik.
Es ist also Person A, die nun den Aufbau der Melodie charakterisiert, die Abfolge der Motive, die sich zu einem größeren Zusammenhang formen wollen: vielmehr er hält es für die Stimme des Komponisten, die da in der Musik zu hören ist, der Anfang „ist es noch nicht, was er uns sagen will, er verspricht bisher nur, daß er etwas sagen werde, etwas Unerhörtes, wie er mit diesen Gebärden zu verstehen gibt. Denn Gebärden sind es. Wie er winkt! sich hoch aufrichtet! die Arme wirft! Und jetzt scheint ihm der höchste Augenblick der Spannung gekommen: noch zwei Fanfaren, und er führt sein Thema vor, prächtig und geputzt, wie klirrend von edlen Steinen.“
Ich sehe das Thema im Cello vor meinem geistigen Auge, wie es aus einzelnen Gebärden entsteht. Dass Musik eine Gebärdensprache ist, gilt ja als ausgemacht, es ist ein geläufiges Bild; ich stelle mir die stufenweise ausgreifenden Gesten des berühmten Mendelssohn-Trios vor, erst die „zwei Fanfaren“ kann ich nicht zuordnen, aber sonst „passt es“ überraschend: „So verschüttet er seine Melodie unter Süßigkeiten – jetzt ruft er sogar unsere gröberen Sinne an, um uns aufzuregen, und so wieder unter seine Gewalt zu bringen. Hören Sie, wie er das Elementarísche stürmischer und donnernder Rhythmen beschwört!“ – Hören Sie es auch?
Versuchen Sie jetzt nur nicht, jede musikalische Wendung auf Nietzsches Text zu beziehen, er hat sich gewiss nicht Mendelssohn dazu vorgestellt, vielleicht eher Wagner oder etwas Eigenes, es geht lediglich um die Tatsache, dass man eine Musik so beschreiben und – herabsetzen kann, wenn man sie in jedem Punkt mit einer Absicht verbindet. Zugleich sind wir wirklich erschüttert und glauben gern, „unsere Betäubung und Erschütterung sei die Wirkung seines Wunder-Themas.“ – S.o. im wiedergegebenen Text, den Sie zur Musik hören könnten…
– – –
Ein weiterer Nietzsche-Text, den Szendy zitiert, schlicht, weil er auch mit den Ohren zu tun hat, sei wiederum aus meiner alten Ausgabe wiedergegeben, samt dem Umfeld in „Jenseits von Gut und Böse“ Nr 246:
Festzuhalten ist, dass der erste Nietzsche-Text sich eindeutig auf Musik bezieht, dieser zweite aber auf das Bücherlesen, und nur hier taucht explizit das d r i t t e Ohr auf. Es ist zweifellos ein innerer Sinn, mit dem wir in geschriebenen Texten auch den Klang der Sprache wahrnehmen, der den Rhythmus, das Tempo, „den Sinn in der Folge der Vokale und Diphtonge rät, und wie zart und reich sie in ihrem Hintereinander sich färben und umfärben können: wer unter bücherlesenden Deutschen ist gutwillig genug, solchergestalt Pflichten und Forderungen anzuerkennen und auf so viel Kunst und Absicht in der Sprache hinzuhorchen? Man hat zuletzt eben ‚das Ohr nicht dafür‘ : und so werden die stärksten Gegensätze des Stils nicht gehört, und die feinste Künstlerschaft ist wie vor Tauben v e r s c h w e n d e t . -“
Klarer kann man es kaum sagen: es ist der Klang der Sprache, der auch beim stummen Lesen eine große Rolle spielen sollte, aber nicht mit dem Klang von Musik zu verwechseln ist. Das Wort Musik kommt in diesen beiden Aphorismen nicht vor, allerdings die Musiker, da es denn doch verwunderlich ist, dass auch sie wie alle Deutschen beim Schreiben und Lesen die Ohren ins Schubfach gelegt haben. Dann folgt die ausgedehnte Eloge auf die antike Redekunst (hörbar!) und schließlich das ferne deutsche Abbild, die Predigt von der Kanzel und das schriftliche Meisterstück der deutschen Prosa, Luthers Bibel.
Szendy, der allerdings von dem Psychoanalytiker Theodor Reik die (fragwürdige) Gleichsetzung des dritten Ohres mit dem inneren Ohr übernehmen will und auch noch Conan Doyle und des Heiligen Augustinus‘ „Ohren des Herzens“ zwischenschaltet, will über das dritte Ohr als das Ohr des Anderen und überhaupt über Andersheit reden. Von daher erhält die Aufteilung des Dialogs zwischen A und B eine Bedeutung, die bei Nietzsche nicht vorgegeben ist, und das geht so:
Hier „finde nicht einfach ein Austausch zwischen zwei Hörern darüber statt, was sie hören in dem Moment in Nietzsches Gespräch über Musik, in dem B in seiner Antwort auf A das dritte Ohr erwähnt («Ich habe zwei Ohren und mehr wenn nöthig»). Jeder Hörer trägt jeweils in sich, in ihren oder in seinen Ohren die Möglichkeit, mehr als zwei oder weniger als zwei Ohren zu haben, was es unmöglich macht, sie zu zählen.“ Wo steht das bei Nietzsche? Wo erwähnt B von sein drittes Ohr?
Einesteils eine unerlaubte Begriffsverengung von dem „Zwei-Ohren-und mehr“-Satz auf das eine, das dritte Ohr, andererseits eine absurde Begriffserweiterung von B’s Ohren-Satz auf – alle Ohren im folgenden Satz: „Jeder Hörer trägt jeweils in sich…“
Später heißt es – wiederum kurzschlüssig – es handle sich bei dem Dialog nicht etwa um einen Duolog, „weil einer der beiden Charaktere, B, mehr als zwei Ohren hat, die ihn oder sie zu mehr als einer Person machen.“ Er hat sie nicht in dem Sinne, wie er eine Person ist, sie stehen ihm imaginär zur Verfügung. (Plötzlich beginnt er zu genderisieren oder zu pluralisieren, um es nicht zu einfach zu machen.)
(Abgebrochen am Ohrenmontag)